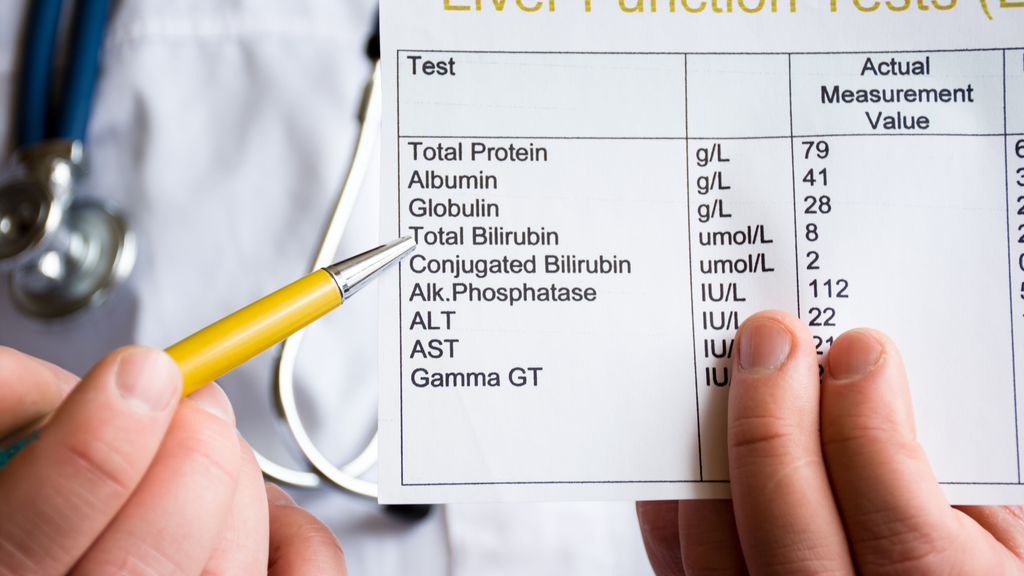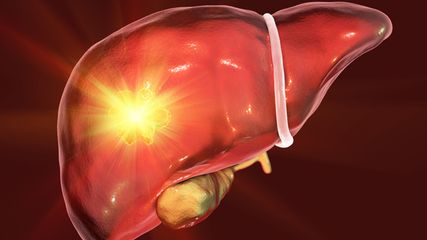<p class="article-intro">Im Rahmen des SGAIM-Frühjahrskongresses sprach PD Dr. med. Philip Bruggmann, Chefarzt der Inneren Medizin am Arud Zentrum für Suchtmedizin in Zürich, Research Fellow am Institut für Hausarztmedizin der Universität Zürich und Präsident von «Hepatitis Schweiz», zum Thema Hepatitis-C-Elimination in der Schweiz. Er berichtete über die Ziele von «HepCare» sowie die bisherigen Bemühungen und erklärte, wie Hausärzte wesentlich dazu beitragen können, Hepatitis C zu eliminieren.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Eine Hepatitis-C-Elimination in der Schweiz ist möglich und kostengünstig umsetzbar.</li> <li>Natürlich sind Anstrengungen auch finanzieller Natur nötig, um Bewusstsein zu schaffen und die Diagnostik und den Zugang zur Behandlung zu verbessern. Dann kann Hepatitis C in den nächsten 11 Jahren eliminiert werden.</li> <li>«HepCare» kann gemeinsam mit Hausärzten einen wichtigen Beitrag zum Erfolg leisten.</li> </ul> </div> <p>Hepatitis C betrifft 40 000 Personen in der Schweiz (Prävalenz von etwa 0,5 %) und stellt damit die Hauptursache für Leberkrebs, Leberzirrhose und in weiterer Folge für Lebertransplantationen dar. Die Mortalität aufgrund von Hepatitis C liegt bei 200 Todesfällen pro Jahr, die Krankheitslast ist für die Betroffenen zum Teil erheblich.<sup>1, 2</sup><br /> «In der Therapie von HIV ist die Schweiz bereits ein führendes Land», so Bruggmann. «Ziel ist es, dies auch bei der Elimination von Hepatitis C zu erreichen.»<br /> Epidemiologisch gibt es ein eindeutiges Verteilungsmuster unter den Erkrankten: Betroffen sind hauptsächlich Personen mit Jahrgang 1950 bis 1985 mit einem Peak um die Mitte der 1960er-Jahre, kurz, die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter. In diesen Jahren geborene Personen weisen eine 4 x höhere Prävalenz auf als der Rest der Bevölkerung und sollten wenigstens einmal im Leben auf Hepatitis C getestet werden. In vielen Ländern geht man noch weiter und rät dazu, die gesamte erwachsene Bevölkerung einmal im Leben zu testen, wie es etwa in Frankreich seit zwei Jahren empfohlen wird.</p>
<p class="article-intro">Im Rahmen des SGAIM-Frühjahrskongresses sprach PD Dr. med. Philip Bruggmann, Chefarzt der Inneren Medizin am Arud Zentrum für Suchtmedizin in Zürich, Research Fellow am Institut für Hausarztmedizin der Universität Zürich und Präsident von «Hepatitis Schweiz», zum Thema Hepatitis-C-Elimination in der Schweiz. Er berichtete über die Ziele von «HepCare» sowie die bisherigen Bemühungen und erklärte, wie Hausärzte wesentlich dazu beitragen können, Hepatitis C zu eliminieren.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Eine Hepatitis-C-Elimination in der Schweiz ist möglich und kostengünstig umsetzbar.</li> <li>Natürlich sind Anstrengungen auch finanzieller Natur nötig, um Bewusstsein zu schaffen und die Diagnostik und den Zugang zur Behandlung zu verbessern. Dann kann Hepatitis C in den nächsten 11 Jahren eliminiert werden.</li> <li>«HepCare» kann gemeinsam mit Hausärzten einen wichtigen Beitrag zum Erfolg leisten.</li> </ul> </div> <p>Hepatitis C betrifft 40 000 Personen in der Schweiz (Prävalenz von etwa 0,5 %) und stellt damit die Hauptursache für Leberkrebs, Leberzirrhose und in weiterer Folge für Lebertransplantationen dar. Die Mortalität aufgrund von Hepatitis C liegt bei 200 Todesfällen pro Jahr, die Krankheitslast ist für die Betroffenen zum Teil erheblich.<sup>1, 2</sup><br /> «In der Therapie von HIV ist die Schweiz bereits ein führendes Land», so Bruggmann. «Ziel ist es, dies auch bei der Elimination von Hepatitis C zu erreichen.»<br /> Epidemiologisch gibt es ein eindeutiges Verteilungsmuster unter den Erkrankten: Betroffen sind hauptsächlich Personen mit Jahrgang 1950 bis 1985 mit einem Peak um die Mitte der 1960er-Jahre, kurz, die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter. In diesen Jahren geborene Personen weisen eine 4 x höhere Prävalenz auf als der Rest der Bevölkerung und sollten wenigstens einmal im Leben auf Hepatitis C getestet werden. In vielen Ländern geht man noch weiter und rät dazu, die gesamte erwachsene Bevölkerung einmal im Leben zu testen, wie es etwa in Frankreich seit zwei Jahren empfohlen wird.</p> <h2>Die Ansteckungswege</h2> <p>Eine Ansteckung mit Hepatitis C erfolgt durch infiziertes Blut, das Virus muss direkt in die Blutbahn gelangen. Das Hepatitis- B-Virus hingegen kann auch sexuell, also über Schleimhautkontakt, übertragen werden. Das Hepatitis-C-Virus (HCV) überlebt im Gegensatz zu HIV auch ausserhalb des Körpers und auch in beim Drogenkonsum gebrauchten Utensilien (z. B. Spritzen, Nadeln, Filter).<br /> In 50 % der Erkrankungsfälle in der Schweiz erfolgte die Übertragung jedoch auf andere Weise, etwa durch Bluttransfusionen, die vor den 1990er-Jahren durchgeführt wurden, also noch bevor der Erreger entdeckt wurde. Ebenso gab es im medizinischen Setting aufgrund mangelhafter Sterilisation der Instrumente zahlreiche Ansteckungen, z. B. bei endoskopischen Untersuchungen oder bei Kontrastmitteluntersuchungen. Auch heute kommt es auf diesem Wege noch vereinzelt zu Ansteckungen, insbesondere in Ländern mit niedrigem medizinischem Standard.<br /> Hierzulande ist vor allem die Infektion mit HCV durch Tätowierungen ein Thema. Auch die mangelnde Hygiene bei der Maniküre in Nagelstudios oder in Barbershops ist eine mögliche Ansteckungsursache. Die sexuelle Ansteckung unter heterosexuellen Paaren ist nicht häufig, jedoch treten bei HIV-positiven homosexuellen Männern, die ungeschützten Geschlechtsverkehr haben, gehäuft Ansteckungen mit HCV auf.</p> <p>Folgekrankheiten einer Hepatitis C können neben Lebererkrankungen auch Fatigue, reduzierte Leistungsfähigkeit, Depression, Diabetes mellitus Typ 2, Arthritis, verschiedene Hauterkrankungen, Glomerulonephritis oder Lymphome sein. Nicht jeder – nur etwa ein Drittel der Patienten – entwickelt diese Folgeerkrankungen; vor allem bei Vorliegen weiterer lebertoxischer Faktoren, wie Alkoholismus oder chronischer Medikamenteneinnahme, steigt das Risiko.<sup>3−6</sup><br /> Das HCV ist ein Virus, welches den ganzen Körper befallen und auch die Blut- Hirn-Schranke überwinden kann. Häufig kann Fatigue auftreten, die zu einer starken Beeinträchtigung der Lebensqualität bis hin zur Einschränkung der Arbeitsfähigkeit führen kann. Hepatitis C ist eine systemische Erkrankung, die laut internationalen Empfehlungen möglichst frühzeitig therapiert werden sollte. Nur dann können diese Folgeerkrankungen erfolgreich verhindert werden.<br /> Ein grosses Problem ist zudem der Umgang mit Hepatitis-C-Betroffenen im Beruf und im sozialen Umfeld, der stark an die Stigmatisierung HIV-Infizierter erinnert.</p> <h2>Fallbeispiel</h2> <p>Anhand eines Fallbeispiels erklärte Bruggmann die aktuelle Behandlungsstrategie gegen Hepatitis C im Vergleich zu früheren Behandlungsmethoden.<br /> Eine 48-jährige Kellnerin hatte sich vor über 10 Jahren beim Drogenkonsum durch das Teilen von Utensilien mit Hepatitis C angesteckt. Sie befand sich in einer Substitutionstherapie mit Methadon. Die Patientin litt unter unspezifischen Symptomen wie hochgradiger, einschränkender Fatigue und Gelenkschmerzen und hatte eine moderater Leberfibrose (Stadium F1).<br /> Die Behandlung der HCV-Infektion erfolgte 2011 mit Interferon und Ribavirin, dauerte ein Jahr und war nebenwirkungsintensiv. Die Patientin litt sehr unter der Therapie, entwickelte depressive Symptome und verlor ihre Haare. Letztendlich blieb die Behandlung jedoch erfolglos, Viren waren nach kurzer Zeit wieder im Blut nachweisbar.<br /> Der Hepatitis-C-Test ist ein einfacher Antikörper-Suchtest (Kosten: CHF 25.−). Werden HCV-Antikörper gefunden, kann das Blut in weiterer Folge auf vorhandene Viren getestet und die sogenannte Viruslast bestimmt werden. Erst dann ist eine aktive Hepatitis-C-Infektion gesichert. Die Hepatitis-C-Antikörper bleiben lebenslang im Blut nachweisbar, auch nach Ausheilung der Erkrankung. Bei einer erneuten Infektion muss dann die Viruslast bestimmt werden. Dieser Test ist mit CHF 180.− deutlich teurer.<br /> Für die Patientin gab es schliesslich ein Happy End. Nach nur 8-wöchiger Therapie mit den heute verfügbaren antiviralen Therapien war die Erkrankung ausgeheilt. Die Fatigue war verschwunden und die Patientin fühlte sich wieder energiegeladen und war sehr zufrieden.</p> <h2>Hepatitis-C-Therapie früher und heute</h2> <p>Heutzutage besteht eine 60 %ige Chance für Betroffene, adäquat auf Hepatitis C getestet zu werden, wie eine Studie von Bregenzer et al. zeigt.<sup>7</sup> «Das ist ein sehr bedenklicher Zustand der Versorgungssituation », sagt Bruggmann.<br /> «Die Behandlung der Hepatitis C ist heute eine einfache Geschichte geworden», so Bruggmann weiter. Mit Interferon/Ribavirin konnte früher die Hälfte der Patienten geheilt werden. Dieser Wert hat sich dank neuer antiviraler Präparate in den letzten Jahren dramatisch verbessert. Seit 2015 kann man in der Schweiz interferonfrei therapieren und Interferon ist heute keine Therapieoption mehr.<sup>8</sup><br /> Heute behandelt man mit antiviralen Kombinationstherapien («direct acting antivirals », DAA) in Tablettenform. Es gibt keine Injektionen mehr. Die Therapien sind mit 8–12 Wochen recht kurz und mit 1–3 Tabletten pro Tag deutlich schonender für den Patienten, mit wenigen, nur milden Nebenwirkungen. Der Preis einer Behandlung ist mit ca. CHF 30 000.− pro Therapie immer noch sehr hoch. Eine Interferon- Therapie kostete jedoch auch CHF 15 000.− bis 30 000.−.<sup>8</sup><br /> Aktuell können über 95 % der Betroffenen geheilt werden. Die einzige Einschränkung, die es noch gibt: Die Therapieverschreibung darf nur durch Spezialisten, also Infektiologen, Hepatologen und Gastroenterologen sowie eine Reihe von Suchtmedizinern, erfolgen. Der Hausarzt darf diese Therapeutika bis heute noch nicht selbst verschreiben.</p> <h2>Wie Elimination erreichen?</h2> <p>In der Schweiz gibt es eine Hepatitis-Strategie, die von einem Netzwerk der zivilen Gesellschaft und Fachleuten initiiert wurde. Wie auch bei der globalen Hepatitis-C- Strategie der WHO, die seit 2016 existiert, ist das Ziel der Schweizerischen Hepatitis-Strategie, Hepatitis C bis 2030 in der Schweiz zu eliminieren. Eliminieren heisst in diesem Fall, die Erkrankung unter Kontrolle zu bringen sowie Erkrankungsfälle und Mortalität massiv zu verringern.<br /> 2017/2018 wurden etwa 3000 Personen pro Jahr behandelt und etwa 1400 Neudiagnosen gestellt. Bei einer Vorgehensweise wie bisher würden die Fallzahlen bis 2030 leicht sinken und die Mortalität auf circa 150 Fälle pro Jahr zurückgehen (Abb. 1). Das BAG findet diese Entwicklung zufriedenstellend, die Schweizerische Hepatitis- Strategie will aber einen Schritt weiter gehen und hat eine mathematische Modellstudie durchgeführt. Diese zeigt, dass die Diagnose- sowie die Behandlungsrate um 30 % erhöht werden müssten, um bei den Fallzahlen und der Mortalität gegen null zu kommen.<sup>9</sup> Das ist machbar, erfordert aber gewisse Anstrengungen, auch im Bereich der Aufklärung.<br /> Eine weitere Studie, die das BAG in Auftrag gegeben hat, bestätigt die Kosteneffizienz der Behandlung gegen Hepatitis C.<sup>10</sup><br /> Eine Erkrankung mit Hepatitis C verursacht auch volkswirtschaftliche Kosten, etwa durch den Ausfall von Arbeitskräften. Dies verursacht erhebliche Kosten, die laut Studien aus den USA knapp doppelt so hoch sind wie bei Nichtinfizierten.<sup>11, 12</sup><br /> Um eine Elimination von HCV zu erreichen, müssten im Jahr 2019 4000 Patienten behandelt werden. Momentan beläuft sich die Rate jedoch auf < 2000 für das Jahr 2019. Wie kann das sein? Es wird vermutet, dass zu wenig Erkrankte neu diagnostiziert und zu wenig diagnostizierte Patienten einer Therapie zugeführt werden. Hier gilt es anzusetzen. Das BAG stellt etwa CHF 300 000.– für die Bekämpfung dieser Epidemie zur Verfügung, was laut Bruggmann völlig ungenügend ist.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Leading Opinions_Innere_1904_Weblinks_lo_innere_1904_s48_abb1.jpg" alt="" width="2151" height="859" /></p> <h2>Das «HepCare»-Projekt, ein Projekt von Hepatitis Schweiz</h2> <p>Allgemeinmediziner spielen eine wichtige Rolle in der Behandlung von Hepatitis- C-Patienten. Ziel des «HepCare»-Projekts ist, die neue Hepatitis-C-Therapie direkt in der Hausarztpraxis anzubieten. So wird Patienten ein leichterer Zugang zur Therapie ermöglicht, das Aufsuchen eines Spezialisten ist nicht mehr unbedingt notwendig. Das Projekt bietet zur Therapiebegleitung und Unterstützung von Hausärzten, die eine Hepatitis-C-Therapie in ihrer Praxis durchführen möchten, ein Netzwerk von Spezialisten an. Der Hausarzt füllt eine Checkliste mit Laborwerten aus und schickt diese – nach Aufklärung und Zustimmung des Patienten – an den Spezialisten, welcher wiederum ein Rezept ausstellt. Alle notwendigen Formulare (Checklisten, Schulungsmaterialien, Leitfaden für Hausärzte etc.) werden vom Projekt online zur Verfügung gestellt. Alle Unterlagen sind auch auf Französisch verfügbar.<br /> Das Projekt wurde bisher in den Kantonen Zürich, St. Gallen und Aargau gestartet. Auch in der Romandie und der restlichen Schweiz wird das Projekt in Kürze anlaufen. Interessierte Hausärzte können sich unter info@hepcare.ch melden.</p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: SGAIM-Frühjahrskongress, 5.–7. Juni 2019, Basel
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Kaiser O et al.: Trends in hepatitis C-related mortality in Switzerland. J Viral Hepat 2017; 1-9 <strong>2</strong> Zahnd C et al.: Analyse de situation des hépatites B et C en Suisse, Université Berne, März 2017 <strong>3</strong> Negro F et al.: Extrahepatic morbidity and mortality of chronic hepatitis C. Gastroenterology 2015; 149: 1345-60 <strong>4</strong> Youossi Z et al.: Extrahepatic manifestations of mepatitis C: a meta-analysis of prevalence, quality of life, and economic burden. Gastroenterology 2016; 150: 1599-608 <strong>5</strong> Bruggmann P: Die Hepatitis-C-Epidemiologie in der Schweiz und die Rolle der Grundversorgung. Praxis 2016; 105: 885-9 <strong>6</strong> Keiser O et al.: Trends in hepatitis C-related mortality in Switzerland. J Viral Hepat 2018; 25: 152-60 <strong>7</strong> Bregenzer A et al.: Management of hepatitis C in decentralised versus centralised drug substitution programmes and minimally invasive point-of-care tests to close gaps in the HCV cascade. Swiss Med Wkly 2017; 147: w14544 <strong>8</strong> Moradpour D, Müllhaupt B: Hepatitis C: aktuelle Therapie. Schweiz Med Forum 2015; 15: 367-70 <strong>9</strong> Müllhaupt B et al.: Progress toward implementing the Swiss Hepatitis Strategy: Is HCV elimination possible by 2030? PLoS One 2018, 13: e0209374 <strong>10</strong> Blach S et al.: Cost-effectiveness analysis of strategies to manage the disease burden of hepatitis C virus in Switzerland. Swiss Med Wkly 2019; 149: w20026 <strong>11</strong> Su J et al.: The impact of hepatitis C virus infection on work absence, productivity, and healthcare benefit costs. Hepatology 2010; 52: 436- 42 <strong>12</strong> El Khoury AC et al.: The burden of untreated hepatitis C virus infection: a US patients’ perspective. Dig Dis Sci 2012; 57: 2995-3003</p>
</div>
</p>