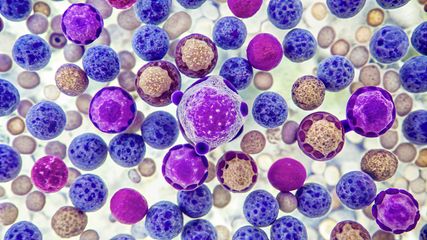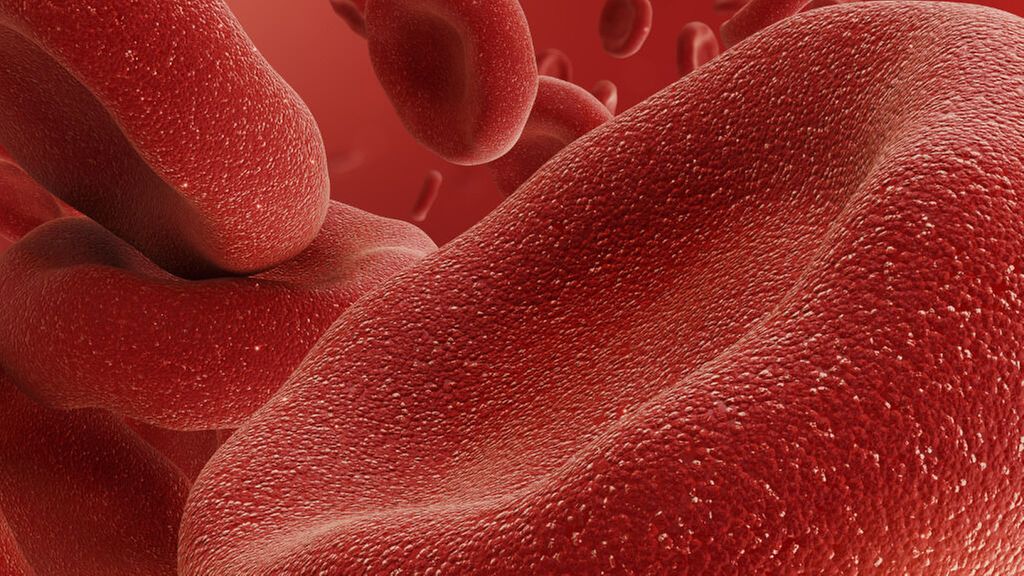
Die Möglichkeiten der Hämostaseregulation werden vielfältiger
Jatros
Autor:
Mag. Thomas Schindl
Autor:
Dr. Alexander Kretzschmar
30
Min. Lesezeit
25.05.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Das wissenschaftliche Programm der Jahrestagung der Gesellschaft für Thrombose- und Hämostaseforschung (GTH) reflektierte den kräftigen Innovationsschub, der in den vergangenen Jahren wichtige neue Ansätze zum Verständnis der Hämophilie sowie zur Entwicklung neuer Therapieoptionen gebracht hatte. Es profitieren nicht nur Prophylaxe und Therapie durch Faktorpräparate. Auch neue Targets zur Hämostaseregulation werden untersucht. Ein großer Hoffnungsträger für die weitere Zukunft einer kurativen Behandlung ist die Gentherapie. </p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Seit wenigen Jahren stehen gentechnisch hergestellte Faktorenkonzentrate mit verlängerter Wirkdauer zur Verfügung. Grundlage dafür sind unterschiedliche Ansätze wie die Modifikationen der FVIII-Protein-Sequenz, Fusionen der Gerinnungsfaktoren VIII und IX mit einem Albumin oder mit der Fc-Domäne von IgG sowie die Pegylierung, bei der es sich um eine chemische Modifikation der FVIII/FIX-Proteine (Tab. 1 und 2) handelt. Durch Anwendung dieser verschiedenen Methoden ist es möglich geworden, die Halbwertszeit für den Gerinnungsfaktor VIII im besten Fall von 12 auf 18 Stunden (Abb. 1) und für den Faktor IX von 20 auf 100 Stunden zu verlängern (Abb. 2). „Bei Patienten mit Hämophilie A kann damit die Zahl der Infusionen im Rahmen eines prophylaktischen Therapieregimes von dreimal wöchentlich auf zweimal pro Woche reduziert werden“, so Univ.-Prof. Dr. Christoph Male von der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde am AKH Wien. Die klinischen Daten zeigen eine gute Response der Patienten, die Blutungsraten konnten im Vergleich zu den bisherigen Therapieoptionen reduziert werden.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Onko_1703_Weblinks_s8_1.jpg" alt="" width="2151" height="584" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Onko_1703_Weblinks_s8_3.jpg" alt="" width="2151" height="480" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Onko_1703_Weblinks_s8_2.jpg" alt="" width="1456" height="870" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Onko_1703_Weblinks_s10_2.jpg" alt="" width="1456" height="637" /></p> <p>Bei der Mehrzahl der Patienten werden mit den neuen FIX-Präparaten nach 7–14 Tagen Trough-Levels ≥1IU/dl erreicht. Im Gegensatz zu den neuen FVIII-Präparaten ist mit den FIX-Präparaten im Vergleich zur Vortherapie eine weitaus deutlichere Reduktion der notwendigen Faktormenge möglich. Die Response ist mit einer relevanten Verringerung der Blutungsrate ebenfalls gut. Bislang wurde bei vortherapierten Patienten (PTP) mit den neuen Präparaten kein vermehrtes Auftreten von Inhibitoren gegen den verabreichten FVIII oder FIX beobachtet. Prof. Male sieht mit den neuen Präparaten eine deutliche Verbesserung der Anwenderfreundlichkeit, der Wirksamkeit und des FIX-Verbrauchs gegeben. <br />Zum praktischen Einsatz jedoch stehen für ihn noch einige Fragen offen. Zum Nachweis der Wirksamkeit werden weitere Studiendaten benötigt, insbesondere aus randomisierten Untersuchungen, ebenso zur Anwendung über längere Zeiträume und zum Einsatz bei akuten Blutungen und chirurgischen Eingriffen. Davon erhofft sich Male auch weitere Erkenntnisse zum tatsächlichen Nutzen einer längeren HWZ, beispielsweise zur Ausdehnung der Applikationsintervalle, ohne die Blutungsintervalle zu erhöhen. Unzureichend ist die Datenlage auch zur Immunogenität bei zuvor unbehandelten Patienten (PUP), zu Anti-PEP-Antikörpern und PEG-Akkumulation im Gewebe. Unklar ist zudem, wie das optimale Therapiemanagement für Kinder und Jugendliche aussehen soll, und welches der geeignete Zeitpunkt für ein Labormonitoring ist.</p> <h2>Paradigmenwechsel in der Hämophilietherapie?</h2> <p>Auf der GTH-Jahrestagung wurden auch verschiedene Möglichkeiten zur Wiederherstellung der Homöostase abseits des intrinsischen Xase-Komplexes bei Hämophiliepatienten diskutiert. Mittels dieser neuen Ansätze könnte sich die bisherige Behandlung im Hinblick auf eine Erhöhung der Wirksamkeitsspiegel (Trough-Level), der Akzeptanz von Blutungen bei schlecht kontrollierten Patienten und einer individualisierten Therapie verändern. <br />Zu den Highlights des Jahres 2016 zählt Prof. Dr. Robert Klammroth, Berlin, die Entwicklung von Prophylaktika für Patienten mit Hämophilie A und FVIII-Hemmkörpern. Betroffen sind davon etwa 30 % der Patienten mit Hämophilie A. Um diese Immunreaktion zu umgehen, wurde mit Emicizumab ein bispezifischer Antikörper entwickelt, der gleichzeitig an Faktor X und an Faktor IX bindet und Letzteren zu Faktor IXa aktiviert. Der Antikörper wirkt wie natürlicher Faktor VIII, ist aber gegen Hemmkörper unempfindlich. Die Pharmakokinetik zeigt bei gesunden Probanden einen dosisproportionalen Anstieg der Cmax und der AUC, die mittlere Halbwertszeit beträgt etwa 4–5 Wochen.<sup>1</sup> Die Plasmaspiegel von FIX und FX werden nicht beeinflusst. Der Antikörper muss nur einmal wöchentlich subkutan gegeben werden.<br />In einer Pilotstudie mit gesunden japanischen Probanden erwies sich Emicizumab in Dosierungen bis zu 1mg/kg als gut verträglich, es traten keine schweren unerwünschten Ereignisse oder Thrombosen auf. Eine offene Dosiseskalationsstudie behandelte 18 japanische Patienten mit schwerer Hämophilie A mit 0,3, 1,0 oder 3,0mg/kg KG. Damit konnte die Blutungsinzidenz dosisabhängig um bis zu 100 % verringert werden. Durchbruchblutungen konnten erfolgreich behandelt werden. In der randomisierten, offenen Phase-III-Studie HAVEN 1 (NCT02622321) zeigte eine Prophylaxe mit Emicizumab bei Personen ≥12 Jahre mit Hämophilie A und FVIII-Hemmkörpern eine statistisch signifikante Verringerung der Blutungsereignisse im Vergleich zu Patienten mit episodischer FVIII-Therapie, aber ohne Prophylaxe (primärer Endpunkt). Die Studie erreichte nach Herstellerangaben alle sekundären Endpunkte, konkrete Ergebnisse waren auf dem GTH noch nicht verfügbar. Als häufigste Nebenwirkungen wurden – wie bereits in früheren Studien – Reaktionen an der Injektionsstelle beobachtet. Die Auswertung zeigte allerdings auch, dass offenbar nicht nur die Wirksamkeit, sondern auch das Thromboserisiko dosisabhängig steigt, so Prof. Klammroth. Ein Todesfall (Analblutung) ist nach Angaben der Entwicklerfirmen nicht mit der Einnahme von Emicizumab assoziiert.<br />Der klinische Stellenwert von Emicizumab wird in Zukunft, so Prof. Klammroth, stark vom Sicherheitsprofil des Antikörpers abhängen. Eine der offenen Fragen ist für ihn, inwiefern die Gabe von Emicizumab und Prothrombinkomplex-Konzentraten (aPCC) synergistische Effekte zeitigt und ob aufgrund dessen die Dosis von aPCC eventuell limitiert werden muss. Möglicherweise lassen sich auch vergleichbare Effekte mit rekombinantem aktiviertem FVIIa erreichen. Für die Praxis bedeutsam sind auch die künftigen Anforderungen an das klinische Monitoring einer Emicizumab-Prophylaxe.<br />Das aktivierte Protein C (APC) unterdrückt als natürlicher Gerinnungshemmer die weitere Thrombingenerierung, indem es die Gerinnungskofaktoren Va und VIIIa proteolytisch spaltet. Seine proteolytische Aktivität im Plasma wird vor allem von den Serpinen Protein-C-Inhibitor (PCI), Plasminogenaktivator-Inhibitor-1 (PAI-1) und Alpha-1-Proteinase-Inhibitor (α1-PI) reguliert. Durch die Gabe von mutierten, hochspezifischen APC-Serpinen konnte nun im Mausmodell die Generierung von Thrombin erhöht und die physiologische Ablagerung von Fibrin und Thrombozyten bei Gefäßwandschädigungen verbessert werden, berichtete Prof. Anne Angelillo-Scherrer, Bern.<sup>2</sup> Zu den Innovationen in der Hämophilietherapie gehört auch die Entwicklung von Tissue-Factor-Pathway-Inhibitoren (TFPI) und von Protein S (PS) als Kofaktor von TFPI sowie Antithrombin-Inhibitoren (AT3-I) auf der Basis von Antikörpern, Adaptameren oder mit „RNA interference technology“ hergestellten RNA-Molekülen. Wenn diese „nicht-Faktor-basierten“ Konzepte bis zur Praxisreife geführt werden, könnte dies laut Dr. Sara Calzavarini, Bern, in einigen Jahren zu einem Paradigmenwechsel in der Hämophilietherapie führen und die Prophylaxe von Gelenkblutungen und Arthropathien erheblich verbessern.</p> <h2>Schwangerschaft und Blutungsrisiko</h2> <p>Frauen mit einem Von-Willebrand-Syndrom (VWS) leiden außer an Menorrha­gien auch unter gehäuften endometrialen Komplikationen in Verbindung mit Blutgerinnungsstörungen. Insbesondere während einer Schwangerschaft kommt es zu wechselnden Veränderungen der Homöostase, wie Dr. Ute Scholz, Leipzig, erklärte (Tab. 3). Sie kritisierte, dass insbesondere in Deutschland die Leitlinien nicht dem aktuellen Stand des Wissens entsprechen. Zielführender ist für sie ein Blick auf die internationalen Guidelines.<sup>3</sup> VWS-assoziierte Blutungen treten während der Schwangerschaft deutlich seltener auf als post partum. Nach der Geburt sollte die Patientin länger als bisher üblich – in den ersten sechs Wochen – engmaschig überwacht werden.<br />Eine Forschergruppe um Prof. Dr. Rainer Zotz, Düsseldorf, wies in einer prospektiven Studie<sup>4</sup> nach, dass schwangere Frauen mit einer positiven Anamnese eines thrombovenösen Ereignisses (VTE) und erhöhten Konzentrationen der Prothrombinfragmente F1 + F2 ein signifikant höheres Thromboserisiko hatten als Schwangere mit normalen Blutwerten (p<0,0001).<sup>4</sup> In den Ergebnissen sind der schwangerschaftsbedingte Anstieg der Prothrombinfragmente F1 + F2 sowie eine Heparinprophylaxe berücksichtigt. Pathologisch hohe Konzentrationen der Prothrombinfragmente F1 + F2 sind auch assoziiert mit einem Faktor-V-Leiden (APC-Resistenz) und der Prothrombinmutation G20210A (p=0,011).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Onko_1703_Weblinks_s8_4.jpg" alt="" width="1419" height="968" /></p> <h2>Weiterhin Hoffnung auf Gentherapie</h2> <p>Die Entwicklung gentherapeutischer Strategien zur kurativen Therapie der Hämophilie blickt mittlerweile auf mehrere Jahrzehnte an Forschungsarbeit zurück. Rezent vermehrt ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt sind insbesondere Ansätze, wonach DNA-Sequenzen zur Synthese von Gerinnungsfaktoren mittels viraler Vektoren künstlich in Hepatozyten von betroffenen Patienten eingeschleust werden sollen. Ein Problem stellen dabei bislang jedoch die Immunreaktionen des Körpers gegen die Vektoren dar. Als Transportvehikel – Genfähren oder Genvektoren – werden heute bevorzugt Adeno-assoziierte Viren (AAV) aus der Familie der Parvoviren eingesetzt. Im Fokus der Gentherapie steht vor allem die Hämophilie B, da das FIX-Protein lediglich aus 461 Aminosäuren besteht, während sich das FVIII-Protein aus 2351 Aminosäuren zusammensetzt; das F9-Gen ist dementsprechend kleiner. Zudem scheint die FIX-Expression weniger kompliziert zu sein als jene von FVIII. Eine derzeit favorisierte Strategie ist die Verwendung von FIX Padua. Es bindet 8- bis 12-mal stärker als Wildtyp-FIX. Damit soll der goldene Mittelweg gefunden werden, um bei Patienten mit Hämophilie A oder B FVIII-/FIX-Wirkspiegel >30 % als Wirksamkeitsschwelle zu erreichen und damit spontane Blutungen zu verhindern, ohne Thrombosen oder Immunreaktionen wie die Hemmkörperbildung oder intolerable Hepatitiden zu verursachen, berichtete Prof. Dr. Thierry Vandendriessche, Brüssel. AAV-Vektoren können jedoch nur bei Patienten ohne präformierte adenovirale Antikörper als Vehikel eingesetzt werden, um keine Hemmkörperbildung zu provozieren.<br />Vandendriessche stellte aktuelle Daten aus dem Studienprogramm SPK-9001 vor.<sup>5</sup> Dieses erhielt Mitte 2016 von der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA und Anfang März 2017 von der EMA den „Breakthrough Designation Therapy“-Status.<sup>6, 7</sup><br />Das Studienprogramm, das einen neuartigen, gentechnisch veränderten AAV-Vektor für den natürlichen humanen Gerinnungsfaktor IX („FIX Padua“-Gen) untersucht, befindet sich aktuell in der Phase II der klinischen Prüfung. In einer Phase-I/II-Studie (NCT02484092)<sup>5</sup>, die Patienten mit schwerer Hämophilie B eingeschlossen hatte, stieg nach einmaliger Gabe bei jenen neun Patienten, die einen Behandlungszeitraum von 12 Wochen nach der Infusion absolviert hatten, die Faktor-IX-Konzentration von <2 % auf im Mittel 28,5 % . Zwei der neun Patienten entwickelten einen asymptomatischen Anstieg der AST/ALT-Spiegel. Nach einer Dosis von 60mg Prednisolon, ausschleichend dosiert, verbesserte sich der ALT-Wert innerhalb von 42 bis 72 Stunden. Außer bei einem Patienten, der mit Verdacht auf eine Sprunggelenkblutung zwei Tage nach der Vektorinfusion FIX substituierte, trat nach der Gentherapie bei keinem Patienten eine Blutung auf.</p> <p><strong>Quelle: </strong></p> <p>61. Jahrestagung der Gesellschaft für Thrombose- und Hämostaseforschung, 15.–18. Februar 2017, Basel</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Uchida N et al: Blood 2016; 127: 1633-1641 <strong>2</strong> Polderijk SG et al: Blood 2017; 129(1): 105-113 <strong>3</strong> Nichols WL et al: Haemophilia 2008; 14(2): 171-232 <strong>4</strong> Zotz RB et al: Highlight Session IV, GTH 2017 <strong>5</strong> George LA et al: 32<sup>nd</sup> International Congress of the World Federation of Hemophilia 2016, Post 30-MP-M <strong>6</strong> Pressemitteilung von Spark Therapeutics (ONCE) und Pfizer Inc. (PFE) vom 21. 7. 2017 <strong>7</strong> Pressemitteilung der EMA vom 8. 3. 2017</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Highlights zu Lymphomen
Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1
Hautmanifestationen bei onkologischen Erkrankungen
Krebserkrankungen verschiedener Organsysteme können auch mit Symptomen an der Haut einhergehen, die manchmal bereits als frühe Warnzeichen auftreten. Dazu zählt ausgeprägter Pruritus. ...
Interessante Daten zu neuen Therapieoptionen
Am hämatologischen Jahreskongress der American Society of Hematology (ASH) wurden Updates von Studien wie TRIANGLE und POLARIX präsentiert, ohne dass sich hierbei grundlegende neue ...