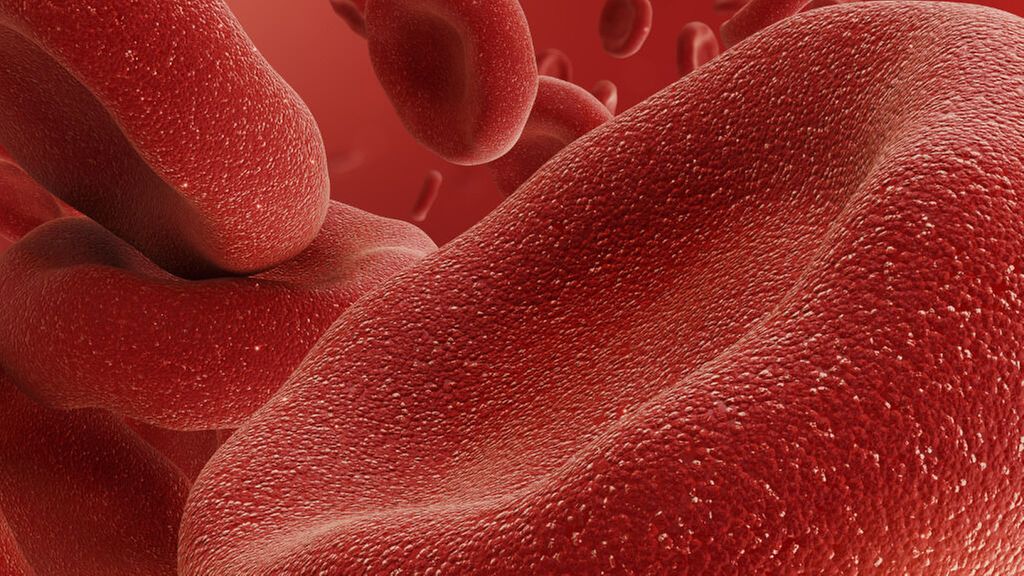
Aktuelles zur Immunthrombopenie
Leading Opinions
Autor:
Dr. med. Rudolf Benz
Leitender Arzt Hämatologie<br> Kantonsspital Münsterlingen<br> E-Mail: rudolf.benz@stgag.ch
30
Min. Lesezeit
11.04.2019
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die Immunthrombopenie, früher bekannt als idiopathische thrombozytopene Purpura, ist eine Autoimmunerkrankung, deren Diagnose auf einem Ausschlussverfahren beruht. Dieser Beitrag beleuchtet die Herausforderungen in der Differenzialdiagnose und gibt Auskunft über den derzeitigen Stand der therapeutischen Optionen.</p>
<hr />
<p class="article-content"><h2>Einleitung</h2> <p>Die Abkürzung ITP steht heute für Immunthrombopenie und nicht mehr für idiopathische thrombozytopene Purpura, da der Begriff die Pathogenese besser darstellt. Die ITP ist eine Autoimmunerkrankung, die je nach Quellenangabe eine Inzidenz von 20–100/Million/Jahr hat.<sup>1, 2</sup> Die grosse Streuung hat am ehesten mit der Tatsache zu tun, dass die ITP eine Ausschlussdiagnose ist. Im Allgemeinen wird ein Thrombozytenwert <100G/l für die Diagnose gefordert.<sup>3</sup> Die Erkrankung hat zwei Altersgipfel. Der eine ist im Kindesund Jugendalter und der andere bei Personen über 60 Jahre. Die ITP verläuft nur bei etwa einem Drittel der Kinder chronisch, während bei Erwachsenen in zwei Dritteln ein chronischer Verlauf erwartet werden muss. Entsprechend der Dauer der Erkrankung wird bei einem Verlauf von unter 3 Monaten von neu diagnostizierter, bei einem Verlauf von 3–12 Monaten von persistierender und bei über 12 Monaten von chronischer ITP gesprochen. Je nachdem, ob in der Abklärung eine begleitende Erkrankung im Zusammenhang mit der ITP gefunden werden kann, spricht man von sekundärer ITP oder bei Fehlen einer solchen von primärer ITP.</p> <h2>Abklärung der Thrombopenie</h2> <p>Da die ITP eine Ausschlussdiagnose ist, müssen anderweitige Ursachen ausgeschlossen werden (Tab. 1). Nach dem Ausschluss einer Pseudothrombopenie steht fest, dass die Thrombopenie nicht nur ein Laborphänomen ist. Eine mehr oder weniger standardisierte Abklärung ist empfohlen (Tab. 2). Die Abklärung muss neben dem Ausschluss von anderen Erkrankungen zwischen sekundären und primären Formen unterscheiden können und zusätzliche Gerinnungsstörungen erfassen. Die klinische Untersuchung konzentriert sich vor allem auf Blutungszeichen, Lymphadenopathien, Splenomegalien und Leberveränderungen und bei Kindern auf Hinweise für syndromale Störungen.<sup>4</sup> Oftmals findet man bei angeborenen Störungen eine positive Familienanamnese von Thrombopenien. Auch ist auf eine genaue Medikamentenanamnese zu achten.<sup>5</sup> Gängige Medikamente wie Paracetamol oder Piperacillin wurden bereits mit der ITP in Verbindung gebracht.<sup>5</sup> Eine Heparinexposition muss immer aktiv ausgeschlossen werden, da auch eine kurze Heparinexposition für eine Heparin-induzierte Thrombozytopenie (HIT) ausreichen kann.<sup>6</sup> Sie wird als prothrombogener Zustand anders als eine ITP behandelt. Das Auftreten einer ITP nach Impfungen, insbesondere der MMR(Masern/Mumps/Röteln)-Impfung, ist gut bekannt.<sup>7</sup> Da eigentlich immer eine spontane Heilung eintritt und eine geringere Rate an ITP als bei normalen Infektionen durch diese Krankheitserreger besteht, ist dies kein Vorwand, auf Impfungen zu verzichten. Bei einer ITP in der Anamnese sind Impfungen zudem nicht kontraindiziert. Steht man vor einer Zweitimpfung, zum Beispiel nach MMR-induzierter ITP, ist eine Impftiterbestimmung empfohlen.<sup>8</sup></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Leading Opinions_Onko_1902_Weblinks_lo_onko_1902_s33_tab1.jpg" alt="" width="550" height="547" /></p> <h2><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Leading Opinions_Onko_1902_Weblinks_lo_onko_1902_s34_tab2.jpg" alt="" width="550" height="348" /></h2> <h2>Risiko und Symptome der ITP</h2> <p>Die Gefahr der ITP sind Blutungen. Der Zusammenhang zwischen niedrigen Thrombozytenwerten im Rahmen der ITP und Morbidität wie auch Mortalität ist gut belegt.<sup>9, 10</sup> Eine Behandlung wird daher bei Thrombozytenwerten <30G/l, bei Blutungen auch bei höheren Werten oder bei raschem Abfall der Thrombozyten empfohlen.<sup>8</sup><br /> Neben den Blutungen findet sich nicht selten eine allgemeine Müdigkeit, die jedoch unter Therapie positiv beeinflusst werden konnte.<sup>11</sup></p> <h2>Therapie</h2> <p>Vor spezifischen Massnahmen sollten bei jeder bestätigten Thrombopenie Medikamente, die die Gerinnung beeinflussen, abgesetzt werden, z.B. nichtsteroidale Antirheumatika. Auch Tranexamsäure kann als initiale, unspezifische Massnahme bei Blutungen in Betracht gezogen werden. Der Einsatz muss aber immer im Verhältnis zum potenziellen Thromboserisiko abgewogen werden, denn auch bei niedrigen Thrombozytenwerten besteht ein Risiko für Thrombosen.<br /> Bei neu diagnostizierter ITP im Erwachsenenalter ohne sekundäre Ursachen und ohne schwere Blutung steht eine Erstlinientherapie mittels Steroiden im Vordergrund. Bei allfälligen Kontraindikationen gegen Steroide oder möglichem Lymphom sind alternativ Immunglobuline empfohlen, da damit die Beurteilung einer allfälligen Lymphoproliferation nicht beeinträchtigt wird. Vor der Gabe der Immunglobuline sollte ein Serumröhrchen abgenommen werden, um serologische Resultate nicht zu verändern. Eine längerfristige Kontrolle der Thrombozytenzahl ist aber mit Immunglobulinen nicht möglich, obwohl mit dieser Therapie meist der schnellste Anstieg an Thrombozyten erreicht werden kann.<sup>12</sup> Thrombozyten sollten nur in Ausnahmefällen bei lebensbedrohlichen Blutungen zum Einsatz kommen, da diese durch die Antikörper ebenfalls rasch eliminiert werden. Wenn sie eingesetzt werden, ist die Bestimmung eines Stundenwertes wichtig, da so die Diagnose weiter untermauert oder infrage gestellt werden kann. Die Dosierungen und Vor- bzw. Nachteile der Therapien sind in Tabelle 3 aufgeführt. Konkret ist bei der Prednison-Therapie darauf zu achten, dass die Therapie langsam ausgeschlichen wird.<sup>13</sup> Aufgrund der längerfristigen Nebenwirkungen sollte aber eine Steroidtherapie als gescheitert angesehen werden, wenn die Prednison-Dosis nicht unter 10mg/Tag reduziert werden kann, ohne dass die Thrombozyten wieder auf behandlungsbedürftige Werte absinken. Um diese Nebenwirkungen zu vermindern, wurde die Therapie mit Dexamethason 40mg/Tag für vier Tage alle 28 Tage eingeführt.<sup>14</sup> Diese Therapie scheint eine bessere längerfristige Remissionsrate zu haben (bis zu 50 % ). Die Wahl der weiteren Therapie ist individuell zu gestalten. Die Splenektomie hat weiterhin ein sehr gutes Langzeitansprechen und kann heutzutage mit laparoskopischen Methoden mit grosser Sicherheit durchgeführt werden.<sup>15</sup> Neben der perioperativen Frühmorbidität und -mortalität sind längerfristige Risiken der Postsplenektomie-Sepsis («overwhelming post-splenetcomy infection», OPSI) am gefürchtetsten. Diese kann zwar durch die obligate Pneumokokken-, Meningokokken- und Hämophilus-Impfungen stark reduziert werden, lässt sich aber nicht vollständig verhindern. Auch parasitäre Erkrankungen verlaufen nach Splenektomie gefährlicher.<sup>16</sup> Wie gross das Risiko für pulmonale Hypertonie ist, eine Komplikation die nach Splenektomie bei Patienten mit Erythrozyten-Membranopathien beobachtet werden konnte, ist im Rahmen der ITP bis anhin noch nicht systematisch untersucht.<sup>17, 18</sup> Aus den obigen Gründen wird trotz sehr guter Langzeiterfolge (zwei Drittel therapiefreie Patienten) die Splenektomie meist erst in dritter oder vierter Therapielinie durchgeführt. Alternativ dazu stehen Rituximab, welches in dieser Indikation keine Zulassung in der Schweiz hat, oder die Thrombopoetin- Rezeptor-Agonisten Eltrombopag und Romiplostim im Vordergrund. Rituximab zeigt ein gutes Sicherheitsprofil. Hepatitis B muss vor der Therapie ausgeschlossen werden. Eine neue, randomisierte Arbeit zeigte keine höhere Ansprechrate in der zweiten Therapielinie als Placebo.<sup>19</sup> Die Patienten, die ansprachen, konnten das Ansprechen aber länger halten. Die längerfristige Ansprechrate ist somit beschränkt, kann aber mit gleichzeitiger Gabe von Dexamethason und allenfalls Ciclosporin noch verbessert werden.<sup>20</sup> Dagegen zeigen die Thrombopoetin-Rezeptor- Agonisten eine sehr gute Ansprechrate, müssen aber mehrheitlich unlimitiert gegeben werden.<sup>21, 22</sup> Auch ist eine Wirkungslatenz von etwa einer Woche zu beachten, sodass die Therapie keine Notfalloption darstellt. Bei fehlendem direktem Vergleich der Therapien spielt die Verabreichungsart bei der Therapiewahl eine entscheidende Rolle. Romiplostim wird einmal pro Woche subkutan verabreicht, Interaktionen spielen dafür kaum eine Rolle. Eltrombopag kann als Tablette einfach verabreicht werden, wobei aber Essrestriktionen (polyvalente Kationen) und Interaktionen beachtet werden müssen. Bei diesen neuen Medikamenten wurde speziell der Einfluss auf konstitutive Symptome und die Lebensqualität untersucht, die ebenfalls gut beeinflusst werden konnten.<sup>23</sup> Fostamatinib, ein SYKInhibitor, der die Phagozytose der Makrophagen blockiert, könnte zu einer weiteren Therapieoption werden.<sup>24</sup></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Leading Opinions_Onko_1902_Weblinks_lo_onko_1902_s34_tab2.jpg" alt="" width="550" height="348" /></p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Cines DB, Blanchette VS: Immune thrombocytopenic purpura. N Engl J Med 2002; 346(13): 995-1008 <strong>2</strong> Moulis G et al.: Epidemiology of incident immune thrombocytopenia: a nationwide population-based study in France. Blood 2014; 124(22): 3308-15 <strong>3</strong> Rodeghiero F et al.: Standardization of terminology, definitions and outcome criteria in immune thrombocytopenic purpura of adults and children: report from an international working group. Blood 2009; 113(11): 2386-93 <strong>4</strong> Lambert MP: What to do when you suspect an inherited platelet disorder. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2011; 2011: 377-83 <strong>5</strong> Reese JA et al.: Identifying drugs that cause acute thrombocytopenia: an analysis using 3 distinct methods. Blood 2010; 116(12): 2127-33 <strong>6</strong> Refaai MA et al.: Delayedonset heparin-induced thrombocytopenia, venous thromboembolism, and cerebral venous thrombosis: a consequence of heparin "flushes". Thromb Haemost 2007; 98(5): 1139-40 <strong>7</strong> Rajantie J et al.: Vaccination associated thrombocytopenic purpura in children. Vaccine 2007; 25(10): 1838-40 <strong>8</strong> Neunert C et al.: The American Society of Hematology 2011 evidence-based practice guideline for immune thrombocytopenia. Blood 2011; 117(16): 4190- 207 <strong>9</strong> Cohen YC et al.: The bleeding risk and natural history of idiopathic thrombocytopenic purpura in patients with persistent low platelet counts. Arch Intern Med 2000; 160(11): 1630-8 <strong>10</strong> Portielje JE et al.: Morbidity and mortality in adults with idiopathic thrombocytopenic purpura. Blood 2001; 97(9): 2549-54 <strong>11</strong> George JN et al.: Improved quality of life for romiplostim-treated patients with chronic immune thrombocytopenic purpura: results from two randomized, placebo-controlled trials. Br J Haematol 2009; 144(3): 409-15 <strong>12</strong> Imbach P: Immune thrombocytopenic purpura and intravenous immunoglobulin. Cancer 1991; 68(6 Suppl): 1422-5 <strong>13</strong> Neunert C et al.: The American Society of Hematology 2011 evidence-based practice guideline for immune thrombocytopenia. Blood 2011; 117(16): 4190-207 <strong>14</strong> Cheng Y et al.: Initial treatment of immune thrombocytopenic purpura with high-dose dexamethasone. N Engl J Med 2003; 349(9): 831-6 <strong>15</strong> Kojouri K et al.: Splenectomy for adult patients with idiopathic thrombocytopenic purpura: a systematic review to assess long-term platelet count responses, prediction of response, and surgical complications. Blood 2004; 104(9): 2623-34 <strong>16</strong> Demar M et al.: Plasmodium falciparum malaria in splenectomized patients: two case reports in French Guiana and a literature review. Am J Trop Med Hyg 2004; 71(3): 290-3 <strong>17</strong> Das A et al.: Risk factors for thromboembolism and pulmonary artery hypertension following splenectomy in children with hereditary spherocytosis. Pediatr Blood Cancer 2014; 61(1): 29-33 <strong>18</strong> Schwartz J et al.: Long term follow-up after splenectomy performed for immune thrombocytopenic purpura (ITP). Am J Hematol 2003; 72(2): 94-8 <strong>19</strong> Ghanima W et al.: Rituximab as second- line treatment for adult immune thrombocytopenia (the RITP trial): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2015; 385(9978): 1653-61 <strong>20</strong> Choi PY et al.: A novel triple therapy for ITP using highdose dexamethasone, low-dose rituximab, and cyclosporine (TT4). Blood 2015; 126(4): 500-3 <strong>21</strong> Cheng G et al.: Eltrombopag for management of chronic immune thrombocytopenia (RAISE): a 6-month, randomised, phase 3 study. Lancet 2011; 377(9763): 393-402 <strong>22</strong> Bussel JB et al.: AMG 531, a thrombopoiesis-stimulating protein, for chronic ITP. N Engl J Med 2006; 355(16): 1672-81 <strong>23</strong> Kuter DJ et al.: Health-related quality of life in nonsplenectomized immune thrombocytopenia patients receiving romiplostim or medical standard of care. Am J Hematol 2012; 87(5): 558-61 <strong>24</strong> Bussel JB et al.: Fostamatinib for the treatment of adult persistent and chronic immune thrombocytopenia: Results of two phase 3, randomized, placebo-controlled trials. Am J Hematol 2018; 93(7): 921-30</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Highlights zu Lymphomen
Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1
Hautmanifestationen bei onkologischen Erkrankungen
Krebserkrankungen verschiedener Organsysteme können auch mit Symptomen an der Haut einhergehen, die manchmal bereits als frühe Warnzeichen auftreten. Dazu zählt ausgeprägter Pruritus. ...
Neues zur GVHD-Prophylaxe und Risikobewertung bei Myelofibrose
Die Prophylaxe der Graft-versus-Host-Krankheit (GVHD) bleibt eine zentrale Herausforderung nach allogener Stammzelltransplantation. Auf dem diesjährigen EBMT-Kongress wurden dazu neue ...


