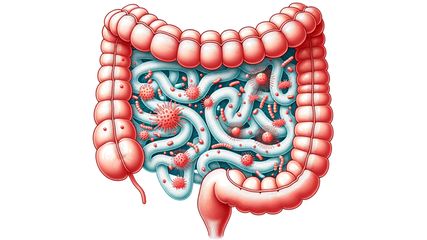Therapie des Reizdarms mit zentralen und peripheren Substanzen – ein Blick über den Tellerrand
Autorin:
OÄ Priv.-Doz. Dr. Christine Kapral
4. Interne Abteilung
Barmherzige Schwestern
Ordensklinikum Linz GmbH
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Das Reizdarmsyndrom (RDS) ist ein weit verbreitetes Krankheitsbild, bei dem eine Störung der Darm-Hirn-Achse im Zentrum steht. Zur Behandlung stehen die unterschiedlichsten Substanzen zur Verfügung: Neben diversen Rezeptoragonisten bzw. -antagonisten, die in den Serotoninhaushalt eingreifen, werden außerdem natürliche Wirkstoffe eingesetzt. Auch Antidepressiva können in der Behandlung von RDS-Patienten eine Rolle spielen.
Keypoints
-
Je nach Typ und Art der Beschwerden werden bei der RDS-Behandlung unterschiedliche Therapieansätze verfolgt.
-
Unter den herkömmlichen Medikamenten hat insbesondere Pfefferminzöl viele Eigenschaften, die RDS-Beschwerden lindern.
-
Durch die motorische, sekretorische und sensorische Funktion von Serotonin werden Substanzen, die den Serotoninhaushalt beeinflussen, ebenso zur RDS-Behandlung eingesetzt.
-
Obwohl sie mit der Indikation RDS nicht zugelassen sind, zeigen Antidepressiva eine positive Wirkung auf RDS-Patienten.
Die Prävalenz der Reizdarmsyndroms (RDS) liegt bei ca. 15% der Gesamtbevölkerung in den westlichen Ländern. Es ist nicht gehäuft mit anderen Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes assoziiert, allerdings mit Depressionen und Angststörungen (94%) und anderen chronischen Schmerzsyndromen. Man unterscheidet vier Subtypen des RDS: das diarrhödominante RDS, das obstipationsdominante RDS, das gemischte RDS mit Wechsel zwischen Obstipation und Diarrhö sowie den unspezifischen Typ, bei dem Schmerzen und Blähungen im Vordergrund stehen.
In weiterer Folge werden nicht alle medikamentösen Therapieoptionen abgehandelt, sondern eine Auswahl an neueren Ansätzen sowie Substanzen, die in den Serotoninhaushalt eingreifen, da Serotonin der wichtigste Botenstoff im Gastrointestinaltrakt ist.
Linaclotid (Constella®)
Bei Linaclotid handelt es sich um einen Agonisten der Guanylatzyklase-C-Rezeptoren, was über die Aktivierung des „cystic fibrosis transmembrane conductance regulator“ (CFTR) zu einer vermehrten intestinalen Sekretion von Chlorid, Bicarbonat und Flüssigkeit in das Darmlumen und damit zu einer beschleunigten Transitzeit führt. Nach einer zweiwöchigen Einnahme kommt es zudem zu einer Verbesserung der viszeralen Hypersensitivität. Linaclotid ist für Patienten mit schweren Formen des RDS vom Obstipationstyp zugelassen. Die Substanz wirkt lokal und führt daher praktisch zu keinen systemischen Effekten. Die einzige dosisabhängige Nebenwirkung ist die Diarrhö. In den USA wurde von der FDA unter dem Namen Plecanatideine weitere Substanz aus dieser Gruppe zugelassen.
Tenapanor (Ibsrela®)
Im September des Vorjahres wurde in den USA Tenapanor ebenfalls für das obstipationsdominante RDS zugelassen. Über eine Blockierung von „Natrium hydrogen-exchanger isoform 3“ (NHE3), das apikal auf Enterozyten in Dünn- und Dickdarm exprimiert wird, kommt es zu einer intraluminalen Zunahme von Natrium, einer gesteigerten Sekretion und der Beschleunigung des Transits. Weiters führt eine erhöhte intrazelluläre Protonenkonzentration zu einer verminderten Permeabilität und selektiven Zunahme der Resistenz der „tight junctions“ für Phosphattransport – die Phosphatresorption wird somit vermindert. Tenapanor kommt deshalb auch für die Therapie der Hyperphosphatämie bei Dialysepatienten zum Einsatz. In der Phase-III-Zulassungsstudie konnte eine signifikante Verringerung der abdominellen Schmerzen erzielt werden.
Eluxadolin (Truberzi®)
Bei Eluxadolin handelt es sich um einen gemischten µ- und κ-Opioid-Rezeptor-Agonisten und δ-Opioid-Rezeptor-Antagonisten mit antidiarrhoischen und schmerzlindernden Eigenschaften, eskommt daher beim diarrhödominanten RDS zum Einsatz. Aufgrund der geringen Bioverfügbarkeit wirkt die Substanz hauptsächlich lokal. Die häufigsten Nebenwirkungen sind Obstipation und Übelkeit. Bei Patienten nach Cholezystektomie (CCE) wurden mehrere Fälle von schwersten Pankreatitiden beschrieben, sodass ein Z.n. CCE eine Kontraindikation für Eluxadolin darstellt.
Pregabalin (Lyrica®, Pregabalin®)
Pregabalin, ein Ligand der Kalziumkanäle α2δ, ist ein Antiepileptikum, das auch zur Behandlungvon neuropathischen Schmerzen und Angststörungen zugelassen ist. In einer doppelblind-placebokontrollierten Studie an 85 RDS-Patienten bewirkte Pregabalin eine signifikante Verbesserung von abdominellen Schmerzen, Durchfall, Blähungen und im„overall bowel symptome score“.
Pfefferminzöl (Colpermin®)
Pfefferminzöl erlebt in der RDS-Therapie eine Renaissance. In einem systematischen Review und einer Network-Metaanalyse aus dem heurigen Jahr wurde Pfefferminzöl beim primären Endpunkt globale RBS-Symptome als Nummer eins eingestuft. Die „number needed to treat“ (NNT) liegt laut einer anderen Metaanalyse zu Pfefferminzöl bei drei. Das Karminativum, das seit Jahrhunderten als Heilmittel im Einsatz ist, hat eine Menge Eigenschaften, die RDS-Beschwerden lindern. Es wirkt antispastisch, antimikrobiell, antiinflammatorisch, immunmodulierend, antioxidativ und anästhesierend. Eine gleichzeitige Einnahme von Protonenpumpenhemmern soll vermieden werden, da die Pfefferminzölkapseln sonst vorzeitig im Magen aufgelöst werden und zu heftigen Refluxbeschwerden führen können.
Serotonin im Gastrointestinaltrakt
Serotonin oder 5-Hydroxytryptamin (5-HT) ist ein biogenes Amin, das als Neurotransmitter im zentralen und peripheren Nervensystem agiert. 95% des körpereigenen Serotonins befinden sich im Gastrointestinaltrakt, davon wiederum 90% in den enterochromaffinen Zellen und 10% in den Neuronen des enterischen Nervensystems (ENS). Serotonin aktiviert die an die Zellmembran gebundenen 5-HT-Rezeptoren, von denen es 7 verschiedene gibt. Im Gastrointestinaltrakt findet man 5-HT3- und 5-HT4-Rezeptoren. Serotonin hat einerseits eine motorische und sekretorische Funktion und löst die Peristaltik über die Aktivierung der Motoneuronen des ENS aus. Andererseits hat Serotonin durch die Weiterleitung von Schmerzsignalenüber die Spinalnerven an das ZNS und unter Beteiligung des N. vagus (Übelkeit, Erbrechen) eine sensorische Funktion. Es ist bekannt, dass RDS-Patienten häufig prä- und postprandial abweichende Serotonin-Plasmaspiegel im Vergleich zu Gesunden aufweisen.
Ondansetron (Zofran®, Ondansetron®)
Ondansetron ist ein 5-HT3-Rezeptor-Antagonist und in der Onkologie als Antiemetikum zugelassen. In Studien konnte beim RDS vom Durchfallstyp eine signifikante Verbesserung das Stuhlverhalten betreffend nachgewiesen werden, da Ondansetron antisekretorisch und peristaltikhemmend im Gastroinestinaltrakt wirkt.
Prucaloprid (Resolor®)
Dabei handelt es sich um einen selektiven 5-HT4-Rezeptor-Agonisten, der die intramuralen Nervenfasern stimuliert und den peristaltischen Reflex triggert. Es kommt zu einer Beschleunigung der Transitzeit. Aufgrund der hohen Selektivität treten praktisch keine kardialen Nebenwirkungen auf. Eine häufige Nebenwirkung ist eine anfängliche Cephalea, die sich zumeist nach wenigen Tagen legt. Patienten sollten darauf hingewiesen werden, um einen Therapieabbruch zu vermeiden. Prucaloprid kann beim schwer therapierbaren obstipationsdominanten RDS eingesetzt werden.
Antidepressiva
Ob der Hauptbenefit der Antidepressiva auf der Behandlung des RDS aufgrund Therapie-koexistenter Depressionen basiert, wird kontroversiell diskutiert. Gesichert ist eine direkte Wirkung auf den Gastrointestinaltrakt sowie eine Modifizierung der zentralen Schmerzantwort bei RDS. Werden diese Substanzen eingesetzt, muss man sich dessen bewusst sein, dass sie für die Indikation RDS nicht zugelassen und relativ nebenwirkungsreich sind. Autonom-vegetative, zentralnervöse und neuromuskuläre Symptome bis hin zum Serotoninsyndrom können auftreten. Ein Review zu diesem Thema aus dem Vorjahr gibt eine gute Übersicht:
-
Trizyklika (Amitriptylin [Saroten®], Clomipramin [Anafranil®], Opipramol[Insidon®]): Die Evidenz für die Wirkung auf die viszerale Hypersensitivität ist insgesamt limitiert. Trotzdem wurden Trizyklika in diesem Review und auch von der zuvor erwähnten Network-Metaanalyse als Nummer eins bezüglich der Wirkung auf die abdominellen Schmerzen eingestuft. Es gibt eine gesicherte Wirkung bei anderen schmerzhaften Funktionsstörungen wie Fibromyalgie oder chronischen Kopfschmerzen. Da Trizyklika die Transitzeit im gesamten Gatrointestinaltrakt verlängeren, kommen sie beim RDS vom Durchfallstyp zum Einsatz, die NNT liegt bei 5. Die Wirkung tritt bereits bei einer deutlich niedrigeren Dosierung ein, als sie für die Therapie der Depression notwendig ist.
-
Tetrazyklika(Mianserin [Tolvon®], Maprotilin [Ludiomil®] und NaSSA („noradrenergic & specific serotoninergic antidepressants“), die sogenannten„neueren Antidepressiva“ (Mirtazepin [Mirtabene®]) sind eine Weiterentwicklung der Trizyklika und chemisch mit ihnen verwandt. Sie haben eine stärker sedierende Wirkung und werden daher vorzugsweise abends beim durchfallsdominanten RDS eingesetzt. Für diese beiden Gruppen ist die Evidenz ebenfalls sehr niedrig.
-
SSRI („selective serotonin reuptake inhibitor“) (Citalopram [Seropram®, Citalopram®], Fluoxetin [Fluctine®, Fluoxetin®, Mutan®], Paroxetin [Seroxat®, Paroxat®, Paroxetin®]) können bei obstipationsdominantem RDS aufgrund einer Verkürzung der Transitzeit eingesetzt werden, die NNT liegt bei 5. Die Dosierung entspricht derbeim Einsatz bei Depression.
-
SSNRI („selective serotonin-noradrenalin-reuptake inhibitor“) (Doluxetin [Cymbalta®], Milnacipran [Ixel®, Milnacipran®], Venlafaxin [Efectin®, Venlafaxin®, Venlafab®]) weisen den größten schmerzmodifizierenden Effekt bei chronischen Schmerzsyndromen auf. Interessanterweise wurden sie bislang nicht an RDS-Patienten getestet.
Literatur:
Alammar N et al.: BMC Complement Altern Med 2019; 19(1): 21 • Black CJ et al.: Lancet Gastroenterol Hepatol 2020; 5(2): 117-31• Chey WD et al.: Am J Gastroenterol 2020; 115(2): 281-93 •Drossman DA et al.: Gastroenterology 2016; 150(6): 1257-61 • Ford AC et al.: Am J Gastroenterol 2019; 114(1): 21-39 • Ho C, Severn M: Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health 2017• Lembo AJ et al.: Neurogastroenterol Motil 2020; 32(4): e13774•Lui R, Staller K: Drug Des Devel Ther 2020; 14: 1391-400 • McCormack PL: Drugs 2014; 74(1): 53-60• Saito YA et al.: Aliment Pharmacol Ther 2019; 49(4): 389-97 •Weerts Z et al.: Gastroenterology 2020; 158(1): 123-36 • Zheng Y et al.: PLoS One 2017; 12(3): e0172846
Das könnte Sie auch interessieren:
Einfluss der Dünndarmfehlbesiedelung bei Patient:innen mit CED
Abdominelle Beschwerden sind ein häufiges Problem, mit dem man in Klinik und Praxis konfrontiert wird. Die Differenzialdiagnosen hierzu können vielfältig sein. Eine bakterielle ...
Therapie des Morbus Crohn: bewährte Konzepte und neue Strategien
Welche Behandlungsziele haben Ärzt:innen, die Patient:innen mit Morbus Crohn (MC) behandeln, und haben die Betroffenen die gleichen Ziele? Lassen sich die Therapieziele erreichen, wenn ...
Therapie des Morbus Crohn: Biologikabehandlung optimieren
Prof. Dr. med. Iris Dotan, Rabin Medical Center, Petah Tikva, und Universität Tel Aviv (Israel), zeigte im Rahmen des 9. Postgraduate Course des IBDnet Möglichkeiten auf, wie die ...