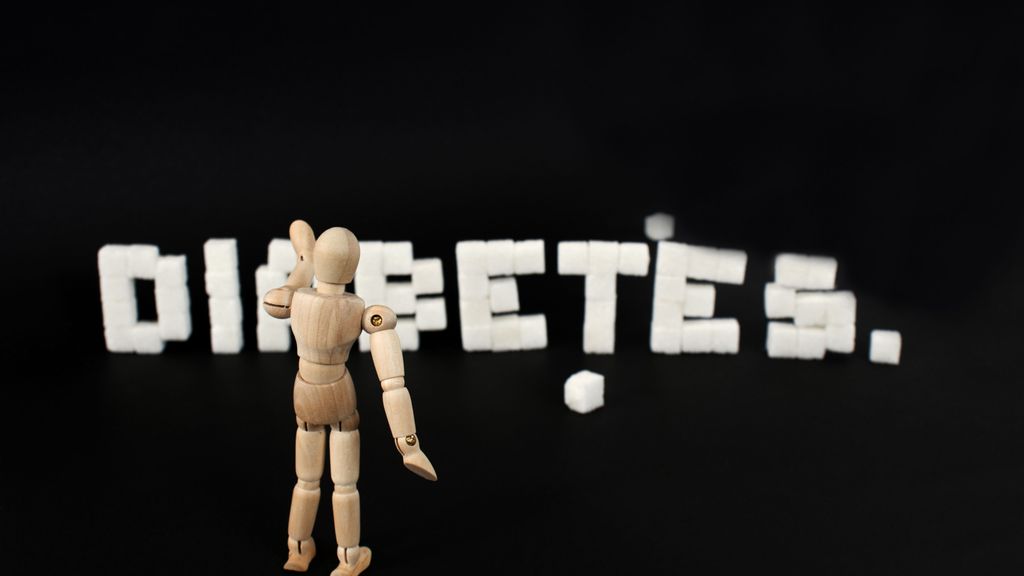
©
Getty Images/iStockphoto
Wie werden sie die Praxis verändern?
Jatros
Autor:
Dr. Christian Tatschl
30
Min. Lesezeit
09.11.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">In den letzten 12 Jahren wurden 12 kardiovaskuläre Outcome-Studien veröffentlicht, die Einblick in das kardiovaskuläre Profil von einzelnen Antidiabetika bei Patienten mit Typ-2-Diabetes und hohem kardiovaskulärem Risiko erlauben. Nun stellt sich die Frage, wie diese Fülle an Information Eingang in die tägliche Praxis finden kann.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Das Jahr 2008 stellte einen Wendepunkt in der Studienlandschaft bei Typ-2-Diabetes dar. Basierend auf durch den Insulin-Sensitizer Rosiglitazon ausgelöste Bedenken bezüglich der Sicherheit antihyperglykämischer Medikamente veröffentlichte die Food and Drug Association (FDA) eine Richtlinie für die Industrie, nach der für vor der Zulassung stehende Antidiabetika neben der antihyperglykämischen Wirksamkeit auch ihre kardiovaskuläre Unbedenklichkeit belegt werden muss. Nachfolgend hat auch die europäische Behörde (EMA) diese Vorgaben übernommen.<sup>1, 2</sup> Diese Richtlinien haben zur Initiierung von zumindest 16 Studien zum kardiovaskulären Outcome mit mehr als 150 000 Patienten mit Typ- 2-Diabetes geführt.<sup>1</sup> Die Ergebnisse von 10 dieser Studien liegen mittlerweile in Form von Vollpublikationen vor: 3 Studien mit DPP-4-Hemmern (SAVOR-TIMI 53<sup>3</sup>, EXAMINE<sup>4</sup>, TECOS<sup>5</sup>), 4 Studien mit GLP-1-Rezeptoragonisten (ELIXA<sup>6</sup>, LEADER<sup>7</sup> SUSTAIN- 6<sup>8</sup>, EXCEL<sup>9</sup>), 2 Studien mit SGLT- 2-Hemmern (EMPA-REG OUTCOME<sup>10</sup>, CANVAS<sup>11</sup>) und die DEVOTE-Studie<sup>12</sup> mit Insulin Degludec. Alle diese Studien (mit Ausnahme von DEVOTE, die gegen eine aktive Vergleichssubstanz durchgeführt wurde) waren als placebokontrollierte Untersuchungen mit dem Nachweis der Nichtunterlegenheit (= Sicherheit) als primärem Studienziel angelegt.<br /> Der Begriff placebokontrolliert verdient in diesem Zusammenhang insofern Erläuterung, als in den Outcome-Studien im Unterschied zu Wirksamkeitsstudien Placebo und Prüfsubstanz nicht als Add-on zu einer festgelegten Basismedikation verabreicht werden, sondern jeweils in einer adaptierbaren, auf leitliniendefinierte Zielwerte hin zu titrierenden Standardtherapie integriert sind. Placebokontrolliert bedeutet in diesen Studien also: Vergleich einer optimierten Standardtherapie inklusive Prüfsubstanz mit einer optimierten Standardtherapie inklusive Placebo. Die primären Endpunkte in den Studien waren als MACE („major adverse cardiovascular events“) bezeichnete kombinierte Endpunkte, die entweder aus drei (kardiovaskulärer Tod, nicht tödlicher Herzinfarkt, nicht tödlicher Schlaganfall) oder vier Komponenten (vorherige und zusätzlich Hospitalisierung wegen instabiler Angina pectoris) zusammengesetzt waren (3-Punkte-MACE bzw. 4-Punkte-MACE).<br /> Zu diesen erwähnten Untersuchungen kommen noch zwei Outcome-Studien, die bereits vor der Veröffentlichung der FDARichtlinie initiiert wurden: die PROactive- Studie mit Pioglitazon<sup>13</sup> und die ORIGINStudie<sup>14</sup> mit Insulin Glargin. Insgesamt stehen also die Daten von 12 randomisierten, kontrollierten Studien zum kardiovaskulären Outcome zur Beurteilung der kardiovaskulären Effekte von einzelnen antihyperglykämischen Substanzen zur Verfügung (nicht eingerechnet ist die RECORD- Studie mit dem mittlerweile vom Markt genommenen Rosiglitazon).</p> <h2>Der Anfang: die PROactive-Studie</h2> <p>Die PROactive-Studie<sup>13</sup> war die erste Studie zum kardiovaskulären Outcome, in der ein spezifisches Medikament – nämlich Pioglitazon – in einer randomisierten, placebokontrollierten Studie in einer Typ- 2-diabetischen Population mit hohem kardiovaskulärem Risiko vor dem Hintergrund einer hinsichtlich Blutzucker, Blutdruck und Lipidwerten optimierten Begleittherapie untersucht wurde. Damit hat PROactive das Design aller nachfolgenden Outcome-Studien mit antihyperglykämischen Substanzen geprägt. Der primäre Endpunkt in PROactive war im Gegensatz zu den nachfolgenden Untersuchungen ein sehr breiter Kompositendpunkt aus Gesamtmortalität, nicht tödlichem Myokardinfarkt, Schlaganfall, akutem Koronarsyndrom, endovaskulärer oder chirurgischer Intervention in Koronar- oder Beinarterien sowie Amputationen oberhalb des Knöchels. Dieser Endpunkt wurde durch Pioglitazon um 10 % (HR: 0,90; 95 % CI: 0,80–1,02) nicht signifikant (p=0,095) reduziert. In der Studie war aber bereits zusätzlich ein Hauptsekundärendpunkt mit den Komponenten Gesamtmortalität, nicht tödlicher Herzinfarkt und Schlaganfall präspezifiziert worden. Dieser ist den in den modernen Outcome-Studien am häufigsten zur Anwendung kommenden 3-Punkte-MACE sehr ähnlich, nur dass in den modernen Studien die kardiovaskuläre Mortalität und nicht die Gesamtmortalität inkludiert ist. Das relative Risiko für das Auftreten eines sekundären Ereignisses war unter Pioglitazon um 16 % signifikant geringer als unter Placebo (HR: 0,84, 95 % CI: 0,72–0,98; p=0,027). Nachfolgeanalysen aus PROactive stützen die in diesem sekundären Endpunkt beobachteten positiven kardiovaskulären Effekte. Bei Patienten, die bereits zuvor einen Myokardinfarkt erlitten hatten, wurde eine signifikante Reduktion des Risikos für das neuerliche Auftreten eines Infarktes um 28 % (HR: 0,72; 95 % CI: 0,52–0,99; p=0,045) und das Auftreten eines akuten Koronarsyndroms um 37 % (HR: 0,63; 95 % CI: 0,41–0,97; p=0,035) durch Pioglitazon gezeigt.<sup>15</sup> Bei Patienten mit vorangegangenem Schlaganfall wurde das Risiko für tödliche und nicht tödliche Schlaganfälle um 47 % (HR: 0,53; 95 % CI: 0,34–0,85; p=0,0085) gesenkt.<sup>16</sup> Ebenfalls in diese Richtung deuten die Daten der IRIS-Studie, in der Pioglitazon bei nicht diabetischen, aber insulinresistenten Patienten nach Schlaganfall oder transienter ischämischer Attacke das Risiko für tödliche und nicht tödliche Schlaganfälle oder Myokardinfarkte um 24 % (HR: 0,76; 95 % CI: 0,62–0,93; p=0,007) senkte.<sup>17</sup> Trotz Anerkennung dieser Daten wird Pioglitazon aufgrund des nicht signifikanten primären Endpunktes in PROactive zu den Substanzen ohne Evidenz für eine positive Beeinflussung des kardiovaskulären Risikos bei Typ-2-Diabetes gerechnet.<sup>2</sup></p> <h2>Studien mit DPP-4-Hemmern, GL P-1-Rezeptoragonisten und SGL T-2-Inhibitoren</h2> <p>In allen neun im Rahmen der FDA-Vorgabe durchgeführten Studien mit DPP- 4-Hemmern, GLP-1-Rezeptoragonisten und SGLT-2-Inhibitoren wurde das Ziel des Nachweises der Nichtunterlegenheit in den primären Endpunkten gegenüber Placebo erreicht und damit die kardiovaskuläre Sicherheit der getesteten Substanzen belegt (Tab. 1).<sup>3–11</sup> Für vier Substanzen (Liraglutid<sup>7</sup>, Semaglutid<sup>8</sup>, Empagliflozin<sup>10</sup> und Canagliflozin<sup>11</sup>) konnte darüber hinaus auch eine signifikante Überlegenheit im Sinne eines kardiovaskulären Zusatznutzens demonstriert werden. Bezüglich der sekundären Endpunkte oder Teilkomponenten der Primärendpunkte konnte eine signifikante Reduktion der Gesamtmortalität sowie der kardiovaskulären Mortalität für Empagliflozin und Liraglutid nachgewiesen werden.<sup>7, 10</sup> Auch mit 1x wöchentlich zu applizierendem Exenatid wurde eine Reduktion der Gesamtmortalität verzeichnet (HR: 0,86; 95 % CI: 0,77–0,97). Aufgrund der hierarchischen Testung im Studienprotokoll konnte dieses Ergebnis ohne Signifikanz im primären Endpunkt jedoch nicht als statistisch signifikant bewertet werden.<sup>9</sup> Unter Semaglutid wurde eine signifikante Reduktion an Schlaganfällen beobachtet (Tab. 2).<sup>8</sup></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Diabetes_1705_Weblinks_s26_tab1.jpg" alt="" width="2151" height="1271" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Diabetes_1705_Weblinks_s26_tab2.jpg" alt="" width="2151" height="1221" /></p> <h2>Studien mit Basalinsulin-Analoga</h2> <p>Die beiden mit Basalinsulin-Analoga durchgeführten Outcome-Studien ORIGIN<sup>14</sup> mit Insulin Glargin U100 und DEVOTE<sup>12</sup> wurden zwar ebenfalls mit Patienten mit kardiovaskulärem Risiko durchgeführt, unterscheiden sich aber von den zuvor beschriebenen Studien mit modernen, oralen Antidiabetika oder GLP-1-Rezeptoragonisten dadurch, dass sie neben Patienten mit Typ-2-Diabetes auch nicht diabetische Personen mit gestörter Nüchternglukose bzw. gestörter Glukosetoleranz (ORIGIN) inkludierten, oder dadurch, dass sie nicht placebokontrolliert, sondern mit einem Vergleichsinsulin als aktiver Vergleichssubstanz im Kontrollarm (DEVOTE) durchgeführt wurden. In beiden Studien wurden die Insuline nach dem Treat-to-Target-Prinzip anhand der Nüchternblutzuckerziele titriert. In ORIGIN wurden Personen mit hohem kardiovaskulärem Risiko und Glukosestoffwechselstörung (gestörte Nüchternglukose, gestörte Glukosetoleranz, Typ- 2-Diabetes) randomisiert und erhielten Insulin Glargin oder eine den damaligen Möglichkeiten entsprechende Standardtherapie. Der frühzeitige Einsatz von Insulin Glargin führte nach einem über sechsjährigen Nachverfolgungszeitraum zu einem neutralen Ergebnis bezüglich kardiovaskulärer Endpunkte und zu einer Reduktion von neu auftretendem Diabetes im Vergleich zur Standardtherapie. Ein wesentliches zusätzliches Ergebnis der Untersuchung war, dass unter der mehrjährigen Therapie mit dem Insulinanalogon kein erhöhtes Karzinomrisiko zu beobachten war.<sup>14</sup> Die DEVOTE-Studie wurde durchgeführt, um die kardiovaskuläre Unbedenklichkeit von Insulin Degludec im Vergleich zu Insulin Glargin U100 nachzuweisen. Patienten mit evidenter kardiovaskulärer Vorerkrankung, chronischer Nierenerkrankung oder beidem erhielten Insulin Glargin oder Insulin Degludec über einen Zeitraum von 24 Monaten. Bei identem erreichtem HbA<sub>1c</sub> (7,5 % ) war hinsichtlich des kardiovaskulären Endpunktes kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen zu verzeichnen (Tab. 3).<sup>18</sup></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Diabetes_1705_Weblinks_s26_tab3.jpg" alt="" width="2151" height="552" /></p> <h2>Hospitalisierung wegen Herzinsuffizienz</h2> <p>Unter Pioglitazon bestand in der PROactive- Studie ein signifikant erhöhtes Risiko für eine Hospitalisierung wegen Herzinsuffizienz (p=0,007).<sup>13</sup> Ein Signal für eine mögliche Erhöhung des Risikos für eine Herzinsuffizienz durch DPP-4-Hemmer wurde für Saxagliptin in SAVOR-TIMI 53 beobachtet. Dieses Risiko war im Saxagliptin- Arm um 27 % signifikant erhöht (HR: 1,27; 95 % CI: 1,07–1,51).<sup>3</sup> In der Nachanalyse zu EXAMINE mit Alogliptin<sup>19</sup> und in TECOS mit Sitagliptin5 wurde kein signifikanter Risikozuwachs bezüglich Herzinsuffizienz verzeichnet. Durch die Ergebnisse von drei großen Observationsstudien<sup>20–22</sup> gilt die Sicherheit der DPP-4-Hemmer bezüglich Herzinsuffizienz ohne Unterschied zwischen den Substanzen mittlerweile als belegt.<sup>2</sup> In keiner der mit GLP-1-Rezeptoragonisten durchgeführten Studien wurde ein signifikanter Einfluss auf die Herzinsuffizienz beobachtet.<sup>6–9</sup> Bei den Basalinsulinen Insulin Degludec und Insulin Glargin war ebenfalls keine Risikoerhöhung zu verzeichnen.<sup>12, 14</sup> Für Empagliflozin konnte dagegen eine signifikante Reduktion des Risikos für eine Hospitalisierung wegen Herzinsuffizienz um 35 % (HR: 0,65; 95 % CI: 0,50–0,85; p=0,002) nachgewiesen werden.<sup>10</sup> Das Risiko für diesen Endpunkt wurde unter Canagliflozin um 33 % reduziert (HR: 0,67; 95 % CI: 0,52–0,87). Aufgrund der sequenziellen Testung im Studienplan konnte dieses Ergebnis nicht als statistisch signifikant bewertet werden.<sup>11</sup></p> <h2>Renale Effekte</h2> <p>Von besonderer Bedeutung sind jene Daten aus den Outcome-Studien, die den Einfluss von antidiabetischen Substanzen auf das Auftreten bzw. das Fortschreiten der diabetischen Nierenerkrankung beschreiben, da einerseits das Vorhandensein einer Nierenerkrankung bei Typ-2-Diabetes eine Prognoseverschlechterung bedeutet,<sup>23, 24</sup> andererseits die diabetische Nierenerkrankung sowohl international als auch in Österreich die häufigste Ursache für die Notwendigkeit einer Nierenersatztherapie darstellt.<sup>25, 26</sup> In EMPA-REG-OUTCOME, LEADER und SUSTAIN-6 konnten positive Effekte von Empagliflozin, Liraglutid und Semaglutid auf renale Kompositendpunkte (Auftreten von Makroalbuminurie, Verdoppelung des Serum-Kreatinins, Notwendigkeit einer Nierenersatztherapie oder renaler Tod) gezeigt werden (Abb. 1).<sup>12, 27, 28</sup> Während Empagliflozin sämtliche Komponenten des renalen Endpunktes positiv beeinflussen konnte,<sup>27</sup> wurde das Ergebnis in der LEADER-Studie primär durch die Reduktion der neu auftretenden, persistierenden Makroalbuminurie getrieben.<sup>28</sup> In CANVAS führte Canagliflozin zu einer Reduktion des renalen Dreifachendpunktes (40 % ige Reduktion der eGFR, Nierenersatztherapie oder Tod aufgrund von Nierenversagen) um 40 % (HR: 0,60; 95 % CI: 0,47–0,77).<sup>11</sup></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Diabetes_1705_Weblinks_s26_abb1.jpg" alt="" width="1477" height="883" /></p> <h2>Fazit</h2> <p>Durch die Vorgabe von FDA und EMA, die kardiovaskuläre Sicherheit von neuen antihyperglykämischen Substanzen vor der Zulassung nachzuweisen, steht nun eine Fülle von Daten über die Wirksamkeit und Sicherheit dieser Medikamente zur Verfügung. Nach den Ergebnissen bezüglich der primären Studienendpunkte (3-Punkte- MACE bzw. 4-Punkte-MACE) lassen sich die neuen Substanzen in Medikamente mit erwiesener kardiovaskulärer Sicherheit (Saxagliptin, Alogliptin, Sitagliptin, Lixisenatid, Exenatid 1x wöchentlich, Insulin Glargin und Insulin Degludec) und solche, für welche ein zusätzlicher kardiovaskulärer Vorteil belegt ist (Liraglutid, Semaglutid, Empagliflozin, Canagliflozin), einteilen. Pioglitazon nimmt hier eine nicht klar definierte Stellung ein. Darüber hinaus können aus den Studien auch relevante Informationen bezüglich Gesamtmortalität, kardiovaskulärer Mortalität, Herzinsuffizienz und Nierenerkrankung abgeleitet werden. Unterschiede waren dabei nicht nur zwischen Substanzklassen, sondern z.T. auch zwischen den Vertretern innerhalb einer Substanzklasse zu beobachten. Anzumerken ist, dass in diese Studien vornehmlich Patienten mit besonders hohem kardiovaskulärem Risiko eingeschlossen wurden und daher eine Generalisierung der Ergebnisse für alle Patienten mit Typ-2-Diabetes nicht möglich ist. Die eigentlich spannende Frage ist nun, wie es gelingen wird, diese Fülle an Information in praxistaugliche Leitlinien einzugliedern, und ob und für welche Patienten eine Hierarchisierung der Empfehlungen nach der vorhandenen Evidenz auch innerhalb von Substanzklassen erfolgen wird.<sup>2</sup></p> <p>Lesen sie auch: <a href="8764">Wie werden kardiovaskuläre Outcome-Studien die Praxis verändern?</a></p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Holman RR et al.: Cardiovascular outcome trials of glucose- lowering drugs or strategies in type 2 diabetes. Lancet 2014; 383(9933): 2008-17 <strong>2</strong> Standl E et al.: Integration of recent evidence into management of patients with atherosclerotic cardiovascular disease and type 2 diabetes. Lancet Diabetes Endocrinol 2017; 5(5): 391-402 <strong>3</strong> Scirica BM et al.: Saxagliptin and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med 2013; 369: 1317-26 <strong>4</strong> White WB et al.: Alogliptin after acute coronary syndrome in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med 2013; 369: 1327-35 <strong>5</strong> Green JB et al.: Effect of sitagliptin on cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med 2015; 373: 232-42 <strong>6</strong> Pfeffer MA et al.: Lixisenatide in patients with type 2 diabetes and acute coronary syndrome. N Engl J Med 2015; 373: 2247-57 <strong>7</strong> Marso SP et al.: Liraglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med 2016; 375: 311-22 <strong>8</strong> Marso SP et al.: Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med 2016; 375: 1834-44 <strong>9</strong> Holman RR et al.: Effects of once-weekly exenatide on cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med 2017; 377(13): 1228-39 <strong>10</strong> Zinman B et al.: Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med 2015; 373: 2117-28 <strong>11</strong> Neal B et al.: Canagliflozin and cardiovascular and renal events in type 2 diabetes. N Engl J Med 2017; 377(7): 644-57 <strong>12</strong> Marso SP et al.: Efficacy and safety of degludec versus glargine in type 2 diabetes. N Engl J Med 2017; 377(8): 723-32 <strong>13</strong> Dormandy JA et al.: Secondary prevention of macrovascular events in patients with type 2 diabetes in the PROactive Study (PROspective pioglitAzone Clinical Trial In macroVascular Events): a randomised controlled trial. Lancet 2005; 366: 1279-89 <strong>14</strong> Gerstein HC et al.: Basal insulin and cardiovascular and other outcomes in dysglycemia. N Engl J Med 2012; 367(4): 319-28 <strong>15</strong> Erdmann E et al.: The effect of pioglitazone on recurrent myocardial infarction in 2,445 patients with type 2 diabetes and previous myocardial infarction: results from the PROactive (PROactive 05) Study. J Am Coll Cardiol 2007; 49(17): 1772- 80 <strong>16</strong> Wilcox R et al.: Effects of pioglitazone in patients with type 2 diabetes with or without previous stroke: results from PROactive (PROspective pioglitAzone Clinical Trial In macroVascular Events 04). Stroke 2007; 38(3): 865-73 <strong>17</strong> Kernan WN et al.: Pioglitazone after ischemic stroke or transient ischemic attack. N Engl J Med 2016; 374: 1321-31 <strong>18</strong> Marso SP et al.: Efficacy and safety of degludec versus glargine in type 2 diabetes. N Engl J Med 2017; 377(8): 723- 32 <strong>19</strong> Zannad F et al.: Heart failure and mortality outcomes in patients with type 2 diabetes taking alogliptin versus placebo in EXAMINE: a multicentre, randomised, double-blind trial. Lancet 2015; 385: 2067-76 <strong>20</strong> Ekström N et al.: Cardiovascular safety of glucose-lowering agents as add-on medication to metformin treatment in type 2 diabetes: report from the Swedish National Diabetes Register. Diabetes Obes Metab 2016; 18: 990-8 <strong>21</strong> Fadini GP et al.: Risk of hospitalization for heart failure in patients with type 2 diabetes newly treated with DPP-4 inhibitors or other oral glucoselowering medications: a retrospective registry study on 127,555 patients from the Nationwide OsMed Health-DB Database. Eur Heart J 2015; 36: 2454-62 <strong>22</strong> Filion KB et al.: A multicenter observational study of incretin-based drugs and heart failure. N Engl J Med 2016; 374: 1145-54 <strong>23</strong> Tonelli M et al.: Risk of coronary events in people with chronic kidney disease compared with those with diabetes: a population- level cohort study. Lancet 2012; 380: 807-14 <strong>24</strong> Fox CS et al.: Associations of kidney disease measures with mortality and end-stage renal disease in individuals with and without diabetes: a meta-analysis. Lancet 2012; 380: 1662-73 <strong>25</strong> Molitch ME et al.: Diabetic kidney disease: a clinical update from Kidney Disease: Improving Global Outcomes. Kidney Int 2015; 87: 20-30 <strong>26</strong> Kramar R: http:// www.nephro.at/oedr2015/oedr2015.htm. Zugriff am 16. Oktober 2017 <strong>27</strong> Wanner C et al.: Empagliflozin and progression of kidney disease in type 2 diabetes. N Engl J Med 2016; 375(4): 323-34 28 Mann JFE et al.: Liraglutide and renal outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med 2017; 377(9): 839-48</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Diabetes erhöht das Sturzrisiko deutlich
Eine dänische Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sowohl Patienten mit Typ-1- als auch Patienten mit Typ-2-Diabetes öfter stürzen und häufiger Frakturen erleiden als Menschen aus einer ...
Neue Studiendaten zu Typ-2-Diabetes und Lebensstil
Dass gesunde Ernährung und Bewegung das Diabetesrisiko sowie verschiedene Risiken von Patienten mit Diabetes senken, ist seit Langem bekannt. Und das Detailwissen zur Bedeutung von ...
Wie oft wird Diabetes nicht oder spät erkannt?
Im Allgemeinen wird von einer hohen Dunkelziffer an Personen mit undiagnostiziertem Typ-2-Diabetes ausgegangen. Ein Teil davon sind von Ärzten „übersehene“ Fälle. Eine von der University ...


