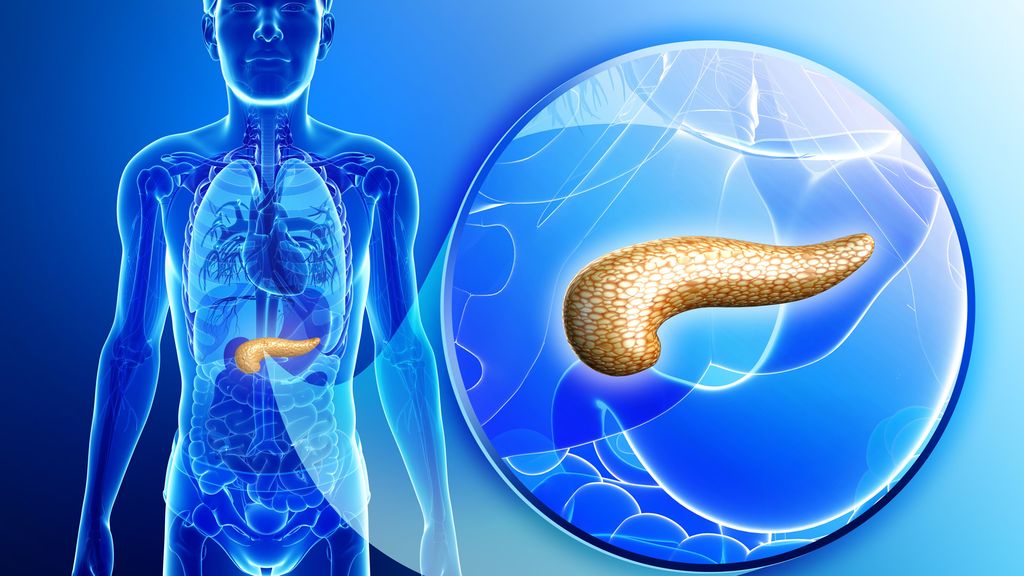
©
Getty Images/iStockphoto
Wichtig ist die konsequente Umsetzung der Empfehlungen
Jatros
Autor:
Prim. Univ.-Prof. Dr. Monika Lechleitner
Ärztliche Direktorin des Landeskrankenhauses<br> Hochzirl-Natters<br> Leiterin der Internen Abteilung Standort Hochzirl<br> E-Mail: monika.lechleitner@tirol-kliniken.at
30
Min. Lesezeit
19.09.2019
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Das diabetische Fußsyndrom zählt zu den schwerwiegendsten Spätkomplikationen des Diabetes mellitus. Geschätzt wird, dass die Prävalenz diabetischer Fußulzera rund 3 % in der Bevölkerung beträgt mit einer großen Schwankungsbreite in Bezug auf diabetesbedingte Amputationen.<sup>1</sup></p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Die periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK) und die diabetische Neuropathie stellen die Hauptrisikofaktoren für die Entwicklung eines diabetischen Fußsyndroms dar. Aufgrund der Neuropathie können sowohl die typischen Symptome der PAVK fehlen wie auch Verletzungen unerkannt bleiben („loss of protective sensation“, LOPS).<br />Im Jahr 2019 wurde ein Update der Leitlinien der International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF) zur Prävention, Klassifikation und Therapie des diabetischen Fußsyndroms publiziert.<sup>2</sup> Ein Update erfolgte 2019 auch zu den Leitlinien-Empfehlungen der Österreichischen Diabetes Gesellschaft, wobei die diabetische Neuropathie und das diabetische Fußsyndrom nunmehr einen Themenschwerpunkt darstellen.<sup>3</sup> Die IWGDF beschreibt als wesentliche Schlüsselelemente in der Prävention diabetischer Fußulzera die Identifikation von Hochrisikopatienten, eine regelmäßige Kontrolluntersuchung (<a href="https://at.universimed.com/fachthemen/1000001789">siehe Tab. 2, voriger Artikel</a>) der Füße und der Schuhe (Versorgung mit geeignetem Schuhwerk), die Schulung von Patienten, Familie und allen in Gesundheitsberufen arbeitenden Personen sowie die Therapie von präulzerösen Veränderungen (Hyperkeratosen, Fehlbelastungen). Weitere Inhalte der neuen IWGDFLeitlinien betreffen das Screening, die Diagnostik und Therapie der PAVK sowie Evidenz- basierte Empfehlungen zur unmittelbaren Therapie des diabetischen Fußulkus.<br />Für den klinischen Alltag wichtig ist die konsequente Umsetzung dieser Empfehlungen, einschließlich der wiederholten Schulungen von Patienten und Betreuungsumfeld. Auf die Notwendigkeit der Beachtung von funktionellen und kognitiven Einschränkungen vor allem bei älteren Patienten in der Umsetzung der Empfehlungen zur Prävention und Therapie des diabetischen Fußsyndroms wird besonders hingewiesen.</p> <p>Lesen sie auch: <a href="/1000001789">Drei von vier Ulzera wären vermeidbar</a></p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Zhang P et al.: Ann Med 2017; 49: 106-16 <strong>2</strong> International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF), www.iwgdfguidelines. org <strong>3</strong> Lechleitner M et al.: Wien Klin Wochenschr 2019; 131(Suppl 1): S141-150</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Diabetes erhöht das Sturzrisiko deutlich
Eine dänische Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sowohl Patienten mit Typ-1- als auch Patienten mit Typ-2-Diabetes öfter stürzen und häufiger Frakturen erleiden als Menschen aus einer ...
Neue Studiendaten zu Typ-2-Diabetes und Lebensstil
Dass gesunde Ernährung und Bewegung das Diabetesrisiko sowie verschiedene Risiken von Patienten mit Diabetes senken, ist seit Langem bekannt. Und das Detailwissen zur Bedeutung von ...
Wie oft wird Diabetes nicht oder spät erkannt?
Im Allgemeinen wird von einer hohen Dunkelziffer an Personen mit undiagnostiziertem Typ-2-Diabetes ausgegangen. Ein Teil davon sind von Ärzten „übersehene“ Fälle. Eine von der University ...


