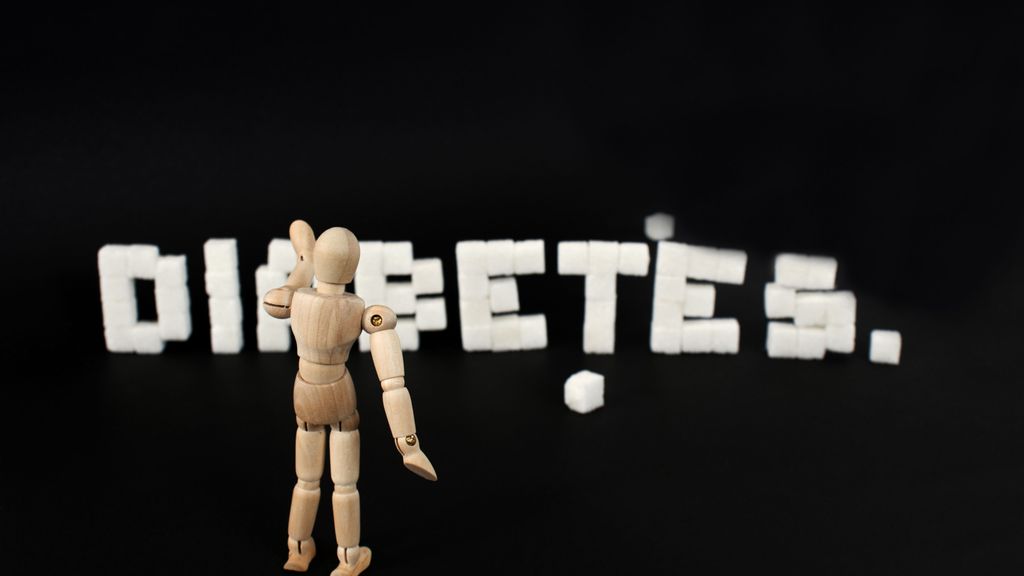
©
Getty Images/iStockphoto
Ein Patient mit Leistungsknick und niedrigem Testosteron nach Semicastratio
Jatros
Autor:
Univ.-Doz. Dr. Christoph Schnack
OA der 1. Medizinischen Abteilung<br>Krankenanstalt Rudolfstiftung, Wien <br>E-Mail: christoph.schnack@wienkav.at
30
Min. Lesezeit
08.03.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die niedrige Testosteronkonzentration kurz nach einer Orchiektomie könnte als Ursache der Beschwerden des Patienten der folgenden Kasuistik missinterpretiert werden. Die genauere endokrine Abklärung führt zur Diagnose eines bisher unbekannten Hypophysenadenoms und zur notwendigen Therapie.</p>
<hr />
<p class="article-content"><h2>Anamnese</h2> <p>Im Mai 2017 wurde ein damals 49-jähriger Patient zur endokrinologischen Abklärung unserer Abteilung zugewiesen. Bei ihm war im Herbst 2016 ein Hodenkarzinom als Zufallsbefund diagnostiziert und im November 2016 eine Semicastratio rechts durchgeführt worden. Es handelte sich um ein 2cm großes Seminom, wobei histologisch keine Hämangio- oder Lymphangioinvasion sowie kein Kapseldurchbruch festzustellen waren, der Resektionsrand war tumorfrei, die Tumormarker AFP und β-hCG waren negativ, dem Tumorstadium pT1, N0, M0, S0 entsprechend. Bei ausgezeichneter Prognose in diesem frühen Stadium ist Observation die Therapie der Wahl. <br />Circa zwei Monate nach der Operation kam es bei dem Patienten zu einem Leist­ungsknick mit zunehmender Müdigkeit, Antriebsarmut, körperlicher Schwäche, Polyarthralgien und Schlafstörungen. Bei einer urologischen fachärztlichen Kontrolle im März 2017 wurde klinisch ein regelrechter postoperativer Befund, ohne Hinweise auf Rezidiv, erhoben. Laborchemisch war eine stark erniedrigte Testosteronkonzentration von 0,06ng/ml (2,5–8,4ng/ml)* festzustellen – eine empfohlene MRT-Untersuchung des Beckens wurde vom Patienten abgelehnt. In der Folge stimmte dieser bei zunehmenden Beschwerden einer stationären Abklärung jedoch zu.</p> <h2>Endokrinologische Abklärung</h2> <p><br />Bei der Aufnahme zeigte sich der mit 94kg, 186cm und einem BMI von 27 übergewichtige Patient in einem deutlich reduzierten Allgemeinzustand. Der Blutdruck betrug 145/90mmHg. In der physikalischen Krankenuntersuchung fanden sich keine wesentlichen Auffälligkeiten. Im EKG zeigten sich ein Sinusrhythmus mit einer Frequenz von 52/min sowie ein bereits zuvor bekannter Rechtsschenkelblock. <br />Laborchemisch fanden sich abgesehen von einem erhöhten Cholesterinspiegel (265mg/dl mit erhöhter LDL-Fraktion 170mg/dl) sowie einem niedrigen Vitamin-D-Spiegel (37mmol/l) weitgehend unauffällige Routineparameter und negative Tumormarker (AFP und β-hCG). Bei praktisch nicht nachweisbarer Testosteronkonzentration (<0,025ng/ml) fanden sich erniedrigte Spiegel von LH, 1,18mU/ml (1,7–8,6), und niedrige FSH-Spiegel, 2,3mU/ml (1,5–12,4), die gegen eine testikuläre Ursache des Testosteronmangels (primärer Hypogonadismus) sprachen. Aufgrund eines negativen Feedback-Mechanismus hemmt ein hoher Testosteronspiegel die Produktion von Gonadotropinen (LH, FSH indirekt) auf hypophysärer Ebene, während umgekehrt ein niedriger Testosteronspiegel die Gonadotropinsekretion (LH) stimuliert. Es handelt sich somit um einen sekundären, hypogonadotropen Hypogonadismus, sodass eine Störung der hypothalamen/hypophysären Achse angenommen werden muss. <br />Nach der hormonellen Abklärung wurde daher eine MRT-Untersuchung der Hypophysen-Sella-Region veranlasst, wobei eine 2,8x1,5x1,9cm große Raumforderung der Hypophyse gefunden wurde, die am ehesten einem Hypophysenmakroadenom entspricht. Die Raumforderung zeigt ein deutliches Enhancement nach Kontrastmittelgabe und führt zu einer Verlagerung des Hypophysenstiels nach rechts. Der Sinus cavernosus links war ausgedehnt infiltriert, während die nur kleinen suprasellären Anteile nicht zu einer Kompression des Chiasma opticum führten. Dementsprechend zeigten sich keine Gesichtsfeldausfälle.<br />In der Abklärung der hypophysären Hormonachsen (Tab.1 ) fand sich ein fast kompletter Ausfall der kortikotropen Achse (stark erniedrigter Serum-Cortisol-Morgenwert, niedriges ACTH) sowie eine niedrige fT4-Konzentration. Der TSH-Spiegel, die Werte für das Wachstumshormon und IGF1 lagen im Normbereich; wobei das Wachstumshormon nur eingeschränkt stimulierbar war (von 0,17 auf 3,1ng/ml). Die Prolaktinkonzentration war deutlich erhöht. Insgesamt waren daher alle Hormon­achsen des Hypophysenvorderlappens in unterschiedlicher Ausprägung betroffen.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Diabetes_1801_Weblinks_s50.jpg" alt="" width="300" /></p> <h2>Therapie und weiterer Verlauf</h2> <p>Von neurochirurgischer Seite wurde keine akute Operationsindikation gestellt und vorerst weitere Observation empfohlen. Eine Hormonsubstitution mit Hydrocortison (Hydrocortone 15-5-0 mg Tabl.), Testosteron transdermal (Testogel 50mg/die) sowie später Thyroxin (Euthyrox 25µg) wurde begonnen; obwohl ein Prolaktinom (dabei Indikation zur medikamentösen Therapie) unwahrscheinlich erschien, erhielt der Patient aufgrund der erhöhten Prolaktinkonzentration und einer möglichen antiproliferativen Wirkung Cabergolin (Dostinex 0,5mg 2x/Woche). Die Beschwerden des Patienten besserten sich prompt und er war in der Folge beschwerdefrei. Die hormonellen Laborbefunde waren unter Therapie im Normbereich. <br />Nach 2–3 Monaten kam es zu vermehrtem Auftreten von Schmerzen im Bereich der Wange und von Cephalea, sodass eine Operationsindikation gestellt wurde, im September 2017 wurde transsphenoidal eine fast vollständige Tumorresektion durchgeführt. Der Patient erholte sich rasch von dem Eingriff, die Hormontherapie (außer Cabergolin) wurde bei subjektivem Wohlbefinden postoperativ fortgesetzt. Histologisch fanden sich Anteile eines Hypophysenadenoms, immunhistochemisch ohne signifikante Hormonproduktion.</p> <h2>Diskussion und Fazit</h2> <p>Ein kompletter Ausfall der Testosteronsekretion nach Semicastratio tritt in der Regel nicht auf, auch ein Rezidiv ist im vorliegenden Tumorstadium des Semi­noms sehr unwahrscheinlich, sodass sofort eine weiterführende hormonelle Abklärung der Beschwerden erforderlich ist. Die prompte Besserung nach Hormonsubstitution lässt annehmen, dass der Großteil der Symptomatik durch den Ausfall der kortikotropen Achse zu erklären ist. Die erhöhte Prolaktinkonzentration ist vermutlich durch Kompression des Hypophysenstiels (Wegfall der Inhibition) verursacht und wäre bei einem Makroprolaktinom noch stärker ausgeprägt. Ob der Ausfall der hypophysären Hormone postoperativ reversibel ist, bleibt abzu­-warten.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>* Normwerte in Klammern</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Diabetes erhöht das Sturzrisiko deutlich
Eine dänische Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sowohl Patienten mit Typ-1- als auch Patienten mit Typ-2-Diabetes öfter stürzen und häufiger Frakturen erleiden als Menschen aus einer ...
Neue Studiendaten zu Typ-2-Diabetes und Lebensstil
Dass gesunde Ernährung und Bewegung das Diabetesrisiko sowie verschiedene Risiken von Patienten mit Diabetes senken, ist seit Langem bekannt. Und das Detailwissen zur Bedeutung von ...
Wie oft wird Diabetes nicht oder spät erkannt?
Im Allgemeinen wird von einer hohen Dunkelziffer an Personen mit undiagnostiziertem Typ-2-Diabetes ausgegangen. Ein Teil davon sind von Ärzten „übersehene“ Fälle. Eine von der University ...


