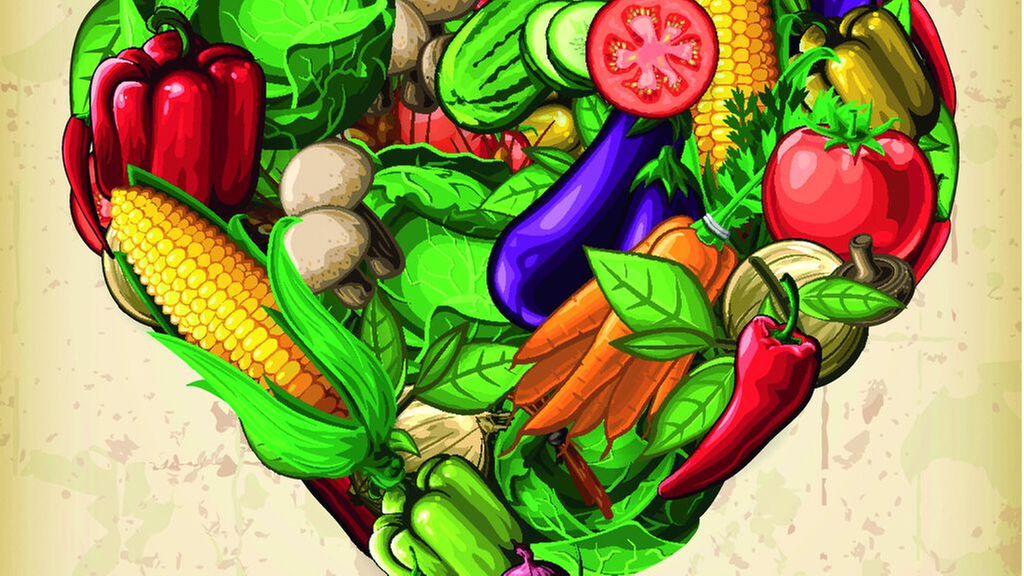
©
Getty Images
Drei von vier Ulzera wären vermeidbar
Jatros
30
Min. Lesezeit
19.09.2019
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Rund ein Viertel der Patienten entwickelt ulzeröse Läsionen im Fußbereich. Bei 85 % aller diabetesbezogenen Amputationen ist eine ulzeröse Läsion im Vorfeld erhebbar. In Klinik und Forschung wird der Prävention dieser schwerwiegenden Folge jedoch bei Weitem zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Aber gerade in der Prävention dieser Komplikationen liegt vielleicht das größte Potenzial, Morbidität und Mortalität bei Diabetes zu senken.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Alle 20 Sekunden verliert irgendwo auf der Welt eine Person ein Bein oder einen Fuß. Die Hälfte der Betroffenen wird innerhalb von 5 Jahren nach dieser Amputation versterben.“ Mit dieser erschreckenden Feststellung beginnen die Leitlinien 2019 der International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF) zu Prävention und Management des diabetischen Fußsyndroms (DFS).<sup>1</sup> Der Begriff des diabetischen Fußes umfasst dabei Infektionen, Ulzerationen oder Gewebsdestruktionen des Fußes im Zusammenhang mit einer Neuropathie und/oder einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (PAVK) bei Patienten mit Diabetes mellitus.<sup>2</sup> <br />Die Manifestation des DFS ist eine der schwerwiegendsten Komplikationen, die Menschen mit Diabetes im Verlauf ihrer Erkrankung erleiden können.<sup>3</sup> Die Pathogenese des DFS ist komplex. Von grundlegender pathophysiologischer Bedeutung sind die diabetische sensomotorische Neuropathie, die bei mehr als 90 % der diabetischen Fußulzera (DFU) als ursächlicher Faktor zu finden ist, und die PAVK, welche bei mindestens der Hälfte der Fälle kausal beteiligt ist, wobei häufig Überschneidungen vorliegen.<sup>3</sup> Der Verlust an protektiver sensibler Wahrnehmung führt dazu, dass auch schon kleine Verletzungen zum DFS führen können. Das durch die motorische Neuropathie bedingte muskuläre Ungleichgewicht zwischen Flexoren und Extensoren führt zu Deformitäten des Fußes. Darüber hinaus weisen Patienten mit diabetischer Neuropathie Haltungsinstabilitäten und Veränderungen des Gangbildes auf. Durch diese Veränderungen entstehen mechanische Belastungen, welche in bestimmten Arealen zu erhöhtem vertikalem Druck oder Scherstress führen. In der Folge kommt es zur Kallusbildung. In diesen Hornhautschwielen kann es schließlich bei wiederholtem Trauma zur Einblutung und Blasenbildung kommen und sich schließlich ein DFU ausbilden. Durch die autonome Neuropathie kommt es zur verringerten Schweißsekretion und damit verbunden zu einer trockenen und rissigen Haut (Abb. 1).<sup>3–5</sup></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Diabetes_1904_Weblinks_s8_abb1.jpg" alt="" width="1041" height="705" /></p> <h2>Schwerwiegende Folgen und hohe Sterblichkeit</h2> <p>Die Häufigkeit von DFU wird oft mit einer Lebenszeitinzidenz von 15–25 %, bei einer jährlichen Inzidenz von rund 2 % , angegeben.<sup>6</sup> Neueren Berechnungen zufolge dürften aber sogar 19–34 % der Menschen mit Diabetes eine ulzeröse Läsion entwickeln.<sup>5</sup> DFU beeinträchtigen Mobilität und Lebensqualität der Betroffenen und sind ein wichtiger Risikofaktor für Fußinfektionen und Amputationen.<sup>7</sup> Tatsächlich kommt es bei mehr als 50 % der DFU zu Infektionen. Rund 20 % mittelgradiger oder schwerer diabetischer Fußinfektionen führen zu einer Amputation unterschiedlichen Ausmaßes.<sup>5</sup> Eine bestehende PAVK ist ein unabhängiger Risikofaktor für ein erhöhtes Auftreten von nicht heilenden Ulzera, Infektionen und der Notwendigkeit einer Amputation.<br />Das DFS stellt die Hauptursache für nicht traumatische Amputationen dar: 40–60 % dieser Amputationen werden bei Diabetikern durchgeführt, und bei 85 % davon ist anamnestisch eine ulzeröse Läsion erhebbar. Jährlich werden pro 1000 Menschen mit Diabetes 6–8 Amputationen vorgenommen.<sup>3</sup> Die Mortalität nach Diabetes-bezogenen Amputationen liegt nach 5 Jahren bei über 70 % und, wenn es sich um einen diabetischen Patienten mit Nierenersatztherapie handelt, bei 74 % bereits nach 2 Jahren.<sup>5</sup><br />Patienten mit DFS stellen auch in kardiovaskulärer Hinsicht ein besonderes Risikokollektiv dar. Rezent wurden in diesem Zusammenhang auch Daten aus Österreich publiziert: Mader et al.<sup>8</sup> beobachteten an der diabetischen Fußambulanz der Medizinischen Universität Graz 91 Patienten mit kürzlich abgeheilten DFU über einen Zeitraum von 11 Jahren. 64 % der Patienten verstarben, fast zwei Drittel davon aus kardiovaskulärer Ursache. Der mittlere Zeitraum bis zum Tod betrug nur 5 Jahre. Das Vorhandensein einer PAVK, eine vorangegangene Amputation, eine Nephropathie und eine schlechte glykämische Einstellung waren prädiktiv für den Tod. Mit einer jährlichen Sterberate von 6 % lag die Mortalität bei diesen Patienten wesentlich höher als bei Patienten in den großen kardiovaskulären Outcome-Studien wie EMPAREG- OUTCOME, EXCEL, LEADER oder SUSTAIN-6.<sup>9–12</sup> Patienten mit PAVK scheinen ein deutlich weniger intensives Risikofaktorenmanagement zu erhalten als Patienten mit anderen kardiovaskulären Erkrankungen.<sup>13</sup> Es wäre daher von großem Interesse, in welchem Ausmaß dieses besondere Hochrisikokollektiv von einem intensiven, evidenzbasierten Management kardiovaskulärer Risikofaktoren in Bezug auf Herzinfarkt, Schlaganfall und kardiovaskulären Tod profitieren würde.</p> <h2>Hohe Kosten</h2> <p>Das DFS ist auch ein wesentlicher Kostenfaktor für das Gesundheitssystem. Daten aus den USA und aus England zeigen, dass DFU häufiger zu Konsultationen von Notfallambulanzen und Spitalseinweisungen führen als Herzinsuffizienz, Nierenerkrankungen, Depression und die meisten Krebsarten. Knapp unter 10 % der Spitalseinweisungen bei Patienten mit Diabetes erfolgen wegen Fußulzera oder Amputation. Rund ein Drittel der Behandlungskosten für Diabetes steht im Zusammenhang mit Problemen an der unteren Extremität.5 Geht man von einer Million Menschen mit Diabetes und einer jährlichen Inzidenz von 2,2 % aus, lägen die Behandlungskosten in internationalen Berechnungen für die Ulkusversorgung bei 220 Millionen Euro pro Jahr, wobei rund die Hälfte davon für Hospitalisierung und Amputation veranschlagt werden muss. Gelänge es, die in kontrollierten Präventionsstudien erreichten Ulkuspräventionsraten von 50 % in der Praxis umzusetzen, könnten die Kosten für dieses Kollektiv auf 110 Millionen Euro reduziert werden.<sup>7</sup></p> <h2>Problem hohe Rezidivneigung</h2> <p>Basierend auf Outcomedaten aus 14 Zentren zur tertiären Versorgungs in Europa liegt die Heilungsrate von DFU bei ungefähr 77 %. Unabhängige Prädiktoren für eine Nichtheilung waren höheres Alter, männliches Geschlecht, Herzinsuffizienz, die Unfähigkeit, ohne Hilfe zu gehen oder zu stehen, terminale Niereninsuffizienz, größeres Ausmaß der Ulzera, periphere Neuropathie und PAVK. Infektionen schlugen sich nur bei Vorhandensein einer PAVK als unabhängiger Prädiktor für die Nichtheilung nieder.<sup>14<br /></sup>Nach Abheilung zeigen DFU eine äußerst hohe Rezidivneigung. Diese liegt ein Jahr nach Abheilung bei 40 %, nach drei Jahren bei 60 % und nach fünf Jahren bei 65 % (Abb. 2).<sup>5</sup> Auch in der oben zitierten Grazer Untersuchung von Mader et al.<sup>8</sup> traten Rezidivulzera innerhalb des Untersuchungszeitraumes bei 65 % der Studienteilnehmer auf, wobei die mittlere Dauer bis zum Auftreten des Rezidivs bei 1,8 Jahren lag. Aufgrund dieser starken Neigung zum Wiederauftreten wird empfohlen, im Zusammenhang mit DFU nicht von „Heilung“, sondern von „Remission“ zu sprechen, um die Awareness für das Problem zu erhöhen.<sup>5, 7</sup> <br />Die Gründe für die hohe Rezidivneigung diabetischer Fußulzera sind vielschichtig. Zunächst ist festzuhalten, dass auch nach Abheilung des Ulkus viele der ursächlich beteiligten Faktoren nicht völlig eliminiert sind. Vor allem die periphere Neuropathie besteht weiterhin als permissiver Faktor, auch wenn Fußdeformitäten und PAVK chirurgisch saniert worden sind.<sup>5</sup> Weiters glauben viele Patienten (und auch Behandler), dass das Fußproblem nicht länger vorhanden sei, sodass von beiden Seiten die adäquate Aufmerksamkeit in Hinsicht auf Fußveränderungen gemindert ist bzw. präventive Maßnahmen nur in unzureichendem Ausmaß umgesetzt werden.</p> <p> </p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Diabetes_1904_Weblinks_s8_abb2.jpg" alt="" width="1558" height="847" /></p> <h2>Mehr Fokus auf Prävention</h2> <p>Aufgrund der schwerwiegenden Konsequenzen wie Infektion, Hospitalisierung und Amputation ist die Prävention von DFU eines der zentralen Themen im Management des DSF. Neben der Verbesserung der Lebensqualität der Patienten liegt hier auch ein enormes Einsparungspotenzial: Daten von US Medicaid zeigen, dass für jeden Dollar, der für Präventionsmaßnahmen eingespart wird, rund 48 Dollar Mehrkosten für Spitalsbehandlungen entstehen.<sup>5</sup> Kritisiert wird allerdings im Zuge der Evidenz-basierten Medizin, dass der Prävention – trotz ihrer Bedeutung – in der Forschung ein zu geringer Stellenwert eingeräumt wird: So hatten 2015 von den 100 rezentesten in PubMed gelisteten randomisierten kontrollierten Studien zum Thema „Diabetischer Fuß“ immerhin 62 Arbeiten die Ulkusheilung, aber nur 6 Untersuchungen die Ulkusprävention zum Forschungsinhalt.<sup>7</sup></p> <h2>Maßnahmen konsequent umsetzen</h2> <p>Die IWGDF hat basierend auf der vorhandenen Evidenz in ihren Leitlinien 2019 zur Prävention diabetischer Fußulzera 5 Schlüsselelemente zur Vermeidung von Fußulzera identifiziert, die auch von der ÖDG in dieser Form übernommen wurden (Tab. 1).<sup>3, 15</sup> <br />An erster Stelle stehen dabei die Identifikation des Risikofußes und dessen regelmäßige Kontrolle und Untersuchung. Die wichtigsten Risikofaktoren für die Entstehung von Fußulzera sind der Verlust an protektiver Sensibilität (engl. „loss of protective sensation“, LOPS), die PAVK und Fußdeformitäten. Zusätzlich spielen vorangegangene Fußulzera und stattgehabte Amputationen jeglichen Ausmaßes eine wesentliche prädiktive Rolle.<sup>15</sup> So weisen Personen mit vorangegangenen DFU im ersten Jahr Rezidivraten von 30–40 % auf, bei Personen ohne vorangegangenes Ulkus liegt die jährliche Inzidenz dagegen bei 7,5 %.<sup>7</sup> Als Risikopatient wird von der IWGDF jede Person mit Diabetes bezeichnet, bei der noch kein aktives Fußulkus vorliegt, bei der aber zumindest LOPS oder eine PAVK vorliegt. Anhand dieser Kriterien sowie des Vorliegens weiterer Risikofaktoren wurde eine Risikostratifizierung in vier Kategorien vorgenommen und entsprechende Kontrollintervalle empfohlen (Tab. 2).<sup>15</sup> <br />Die IWGDF nennt als sechstes Schlüsselelement in der Prävention von diabetischen Fußulzera die integrative Versorgung und versteht darunter jede Intervention, welche zumindest die regelmäßige Fußkontrolle durch einen adäquat ausgebildeten Professionisten, die Behandlung von Risikofaktoren, die strukturierte Schulung zum Selbst-Management und die Versorgung mit adäquatem therapeutischem Schuhwerk beinhaltet. Da die Effektivität der Interventionen sehr stark von der Adhärenz der Betroffenen abhängt, sollte diese in der Kommunikation mit Betroffenen ein zentrales Thema darstellen. Anhand von 23 klinischen Studien wurde gezeigt, dass die Effektgröße der Interventionen „therapeutisches Schuhwerk“, „Selbst-Management“ und „Fußchirurgie“ bezüglich DFU-Prävention bei über 60 % liegt.<sup>7</sup> Würden die empfohlenen State-ofthe- Art-Interventionen in einem integrativen Ansatz kombiniert und ausreichend umgesetzt, könnten bis zu 75 % aller diabetischen Fußulzera vermieden werden.<sup>7, 15</sup></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Diabetes_1904_Weblinks_s8_tab1.jpg" alt="" width="550" height="159" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Diabetes_1904_Weblinks_s8_tab2.jpg" alt="" width="550" height="360" /></p> <h2>Fazit</h2> <p>Rund ein Viertel aller Personen mit Diabetes entwickelt im Laufe ihrer Erkrankung ein DFU. Wenn diese sich einmal entwickelt haben, zeigen sie auch nach Abheilung eine äußerst hohe Rezidivneigung und führen häufig zu Infektion, Hospitalisierung und Amputation. Daher liegt gerade in der Prävention und Remissionserhaltung ein hohes Potenzial, einerseits menschliches Leid zu lindern und andererseits Kosten im Gesundheitssystem zu reduzieren. Damit dies gelingen kann, muss jedoch der Fokus wesentlich stärker auf die Prävention des DFS gelegt werden. Dafür bedarf es der adäquaten Ausbildung von medizinischen Berufen, Patienten und Angehörigen sowie der konsequenten Umsetzung der vorhandenen evidenzbasierten Maßnahmen, allen voran die regelmäßige Kontrolle der Füße durch alle Beteiligten (siehe Bericht zur Presseaussendung der ÖDG in dieser Ausgabe). Möglicherweise ließe sich so das Ziel, DFU um 75 % zu reduzieren, tatsächlich realisieren.<sup>5, 7, 15, 16</sup></p> <p>Lesen sie auch: <a href="/1000001790">Wichtig ist die konsequente Umsetzung der Empfehlungen</a></p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> IWGDF Guidelines 2019: https://iwgdfguidelines.org/introduction/ <strong>2</strong> IWGDF Guidelines 2019: https://iwgdfguidelines.org/definitions-criteria/ <strong>3</strong> Lechleitner M et al.: Diabetische Neuropathie und diabetischer Fuß (Update 2019). Wien Klin Wochenschr 2019; 131 [Suppl 1]: S141-S150 <strong>4</strong> Boulton AJM: The 2017 Banting Memorial Lecture. The diabetic lower limb - a forty year journey: from clinical observation to clinical science. Diabet Med 2019 Jan 19. doi: 10.1111/dme.13901. [Epub ahead of print] <strong>5</strong> Armstrong DG et al.: Diabetic foot ulcers and their recurrence. N Engl J Med 2017; 376(24): 2367-75 <strong>6</strong> Singh N et al.: Preventing foot ulcers in patients with diabetes. JAMA 2005; 293: 217-28 <strong>7</strong> Bus SA, van Netten JJ: A shift in priority in diabetic foot care and research: 75 % of foot ulcers are preventable. Diabetes Metab Res Rev 2016; 32 (Suppl 1): 195-200 <strong>8</strong> Mader JK et al.: Patients with healed diabetic foot ulcer represent a cohort at highest risk for future fatal events. Sci Rep 2019; 9(1): 10325 <strong>9</strong> Holman RR et al.: Effects of once-weekly exenatide on cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med 2017; 377(13): 1228-39 <strong>10</strong> Zinman B et al.: Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med 2015; 373: 2117-28 <strong>11</strong> Marso SP et al.: Liraglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med 2016; 375: 311-22 <strong>12</strong> Marso SP et al.: Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med 2016; 375: 1834-44 <strong>13</strong> Hiatt WR et al.: Ticagrelor versus clopidogrel in symptomatic peripheral artery disease. N Engl J Med 2017; 376(1): 32-40 <strong>14</strong> Prompers L et al.: Prediction of outcome in individuals with diabetic foot ulcers: focus on the differences between individuals with and without peripheral arterial disease. The EURODIALE Study. Diabetologia 2008; 51(5): 747-55 <strong>15</strong> IWGDF Guidelines 2019 https://iwgdfguidelines. org/wp-content/uploads/2019/05/02-IWGDF-prevention- guideline-2019.pdf <strong>16</strong> Presseaussendung der Österreichischen Diabetesgesellschaft (ÖDG) vom 15. Juli 2019. http://www.ots.at/pressemappe/3643/aom</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Diabetes erhöht das Sturzrisiko deutlich
Eine dänische Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sowohl Patienten mit Typ-1- als auch Patienten mit Typ-2-Diabetes öfter stürzen und häufiger Frakturen erleiden als Menschen aus einer ...
Neue Studiendaten zu Typ-2-Diabetes und Lebensstil
Dass gesunde Ernährung und Bewegung das Diabetesrisiko sowie verschiedene Risiken von Patienten mit Diabetes senken, ist seit Langem bekannt. Und das Detailwissen zur Bedeutung von ...
Wie oft wird Diabetes nicht oder spät erkannt?
Im Allgemeinen wird von einer hohen Dunkelziffer an Personen mit undiagnostiziertem Typ-2-Diabetes ausgegangen. Ein Teil davon sind von Ärzten „übersehene“ Fälle. Eine von der University ...


