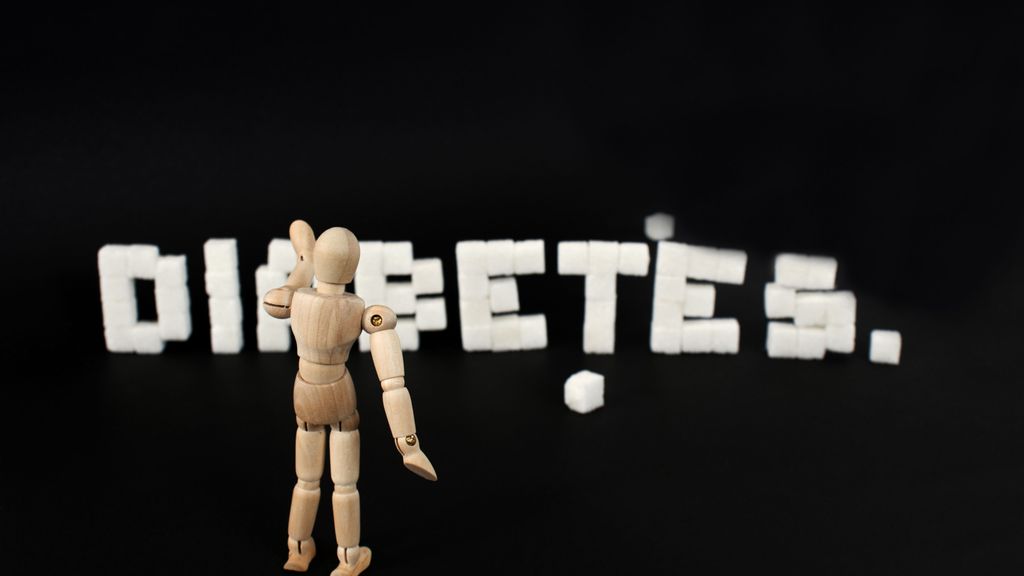
©
Getty Images/iStockphoto
Autoimmunerkrankungen und Typ-1-Diabetes
Jatros
30
Min. Lesezeit
06.07.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die jährliche Inzidenz des Diabetes mellitus Typ 1 liegt in Österreich bei 18,4 Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner. Interessanterweise kann seit Jahren ein langsamer, aber doch stetiger Anstieg der Inzidenz beobachtet werden. Daten aus den USA zeigen eine Zunahme der Inzidenz des Typ-1-Diabetes von etwa 1,8 % pro Jahr. Prinzipiell ist häufig eine Assoziation von anderen Autoimmunerkrankungen mit Diabetes mellitus Typ 1 gegeben. Ein gezieltes Screening und eine korrekte Diagnostik nehmen daher einen sehr hohen Stellenwert ein.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Bei Menschen, die an Diabetes mellitus Typ 1 erkrankt sind, sollte ein Fokus auf mögliche assoziierte Autoimmunerkrankungen gelegt werden.</li> <li>Empfehlungen in den Leitlinien der Österreichischen Diabetes Gesellschaft: Zöliakie-Screening bei Erstdiagnose; Kontrolle des TSH jedes 2. Jahr bei antikörpernegativen Patienten; regelmäßige ACTH-Verlaufskontrolle und ggf. weitere Abklärung bei Verdacht auf M. Addison; Parietalzellantikörperbestimmung bei Vitamin-B12-Mangel und/ oder unklarem Eisenmangel.</li> <li>Die Befundbesprechung im Rahmen der Gespräche bei Transition der jungen Erwachsenen von den Pädiatern zu den Erwachsenenmedizinern ist ein Fixpunkt in der ärztlichen Betreuung.</li> </ul> </div> <h2>Schilddrüse</h2> <p>Erkrankungen der Schilddrüse stellen mit Abstand die häufigste Autoimmunerkrankung, welche gemeinsam mit Diabetes mellitus Typ 1 auftritt, dar. Gemäß den verfügbaren Studien liegt bei Kindern und Jugendlichen, die bereits an Diabetes mellitus Typ 1 erkrankt sind, die Rate an positiven TPO-Antikörpern bei etwa 24 % , tatsächlich sind etwa 15–30 % der Betroffenen auch an einer Autoimmunthyreoiditis – fast ausschließlich vom Typ Hashimoto – erkrankt. Gerade bei Kindern und Jugendlichen stellt Morbus Basedow als weitere mögliche Form einer autoimmunen Schilddrüsenerkrankung eine Rarität dar. Daten aus Deutschland belegen eine klare Assoziation der Antikörper mit der Höhe der Serum-TSHWerte, darüber hinaus ist die Wahrscheinlichkeit für ein Vorliegen positiver SD-Antikörper auch mit dem Alter assoziiert.</p> <h2>Gastrointestinaltrakt</h2> <p>Neben der Schilddrüse ist sehr häufig auch der Gastrointestinaltrakt betroffen, eine Tatsache, deren tatsächliche Relevanz heute meist unterschätzt wird und die zusehends in den Fokus rücken sollte. Bestimmt man unabhängig von der Klinik die „tissue transglutaminase (tTG) antibodies“ zum Screening für Zöliakie, so kann man davon ausgehen, dass diese bei etwa 11 % der Patienten positiv sind. Die tatsächliche Prävalenz der Zöliakie hingegen liegt bei 4–9 % . Daten aus Österreich zeigen, dass bei 79 % der Kinder, die an Zöliakie erkranken, die Diagnose innerhalb der ersten fünf Jahre nach Auftreten des Diabetes mellitus gestellt wird. Im Rahmen dieser Studie wurden bei etwa 7–10 % des Gesamtkollektives positive tTG-Antikörper gefunden.<br /> Im Rahmen der diagnostischen Aufarbeitung der Zöliakie sollte vor der Bestimmung der tTG-Antikörper das gesamte Immunglobulin A (IG-A) bestimmt werden. Gerade bei Diabetes mellitus Typ 1 tritt ein IG-A-Mangel gehäuft auf, was in weiterer Folge falsch negative tTG-Antikörper bewirken kann.<br /> In den aktuell gültigen Guidelines der pädiatrischen Gesellschaften wird die Rolle einer sequenziellen Verwendung der tTG-Antikörper gemeinsam mit HLADQ8/ DQ2 besonders hervorgehoben. Demnach kann die Diagnose bei Vorliegen von typischen Symptomen (Krankheitsgefühl, Müdigkeit, Blähungen, abnorme Stühle, Bauchbeschwerden, Eisenmangelanämie) gemeinsam mit tTG-Antikörpern >10-fach über der Norm erhöht und positivem Nachweis von HLA-DQ8/DQ2 auch ohne Gastroskopie gestellt werden. Daten aus Innsbruck zeigen jedoch, dass gerade HLA-DQ8/DQ2 bei an Diabetes mellitus Typ 1 erkrankten Kindern mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit positiv nachgewiesen werden.<br /> Umgekehrt kann bei unauffälligen Gesamt-IG-A-Werten bei negativen tTGAntikörpern unter einer glutenhaltigen Diät eine Zöliakie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.<br /> Des Weiteren liegen bei etwa 5–10 % der Patienten positive Antiparietalzellantikörper vor. Das Auftreten der Parietalzellantikörper hängt jedoch stark mit dem Alter zusammen. Bei erwachsenen Menschen sind bei 15–25 % der Untersuchten positive Antikörper nachweisbar. Die Prävalenz der Autoimmungastritis beträgt 5–10 % . Typischerweise dauert es meist viele Jahre, bis es zum klinischen Vollbild einer Autoimmungastritis kommt. Häufig kann eine Autoimmungastritis auch für einen unklaren Eisenmangel verantwortlich sein, wenn sich im Rahmen der Abklärung, z.B. im Rahmen einer Koloskopie oder einer gynäkologischen Untersuchung, keine weitere Blutungsquelle finden lässt. Neben dem Screening auf Parietalzellantikörper sollte auch eine regelmäßige Kontrolle der Eisenstoffwechselparameter und des Vitamin B12 in Erwägung gezogen werden.</p> <h2>Weitere autoimmunologische Erkrankungen</h2> <p>Als möglicher Vertreter einer autoimmundermatologischen Erkrankung ist die Vitiligo mit Diabetes mellitus Typ 1 assoziiert, wobei die tatsächliche Prävalenz bei etwa 4–10 % liegt.<br /> Wesentlich seltener, aber umso wichtiger, da für den Patienten potenziell lebensgefährlich, ist der Morbus Addison. Dieser stellt aber glücklicherweise eine Rarität dar. Antikörper gegen die 21-Hydroxylase, welche in weiterer Folge mit dem Auftreten eines M. Addison vergesellschaftet sind, treten bei 1 % der Menschen mit Diabetes mellitus Typ 1 auf.<br /> Polyendokrine Autoimmunsyndrome treten mit unterschiedlicher Häufigkeit auf. Typische klinische Befunde des polyendokrinen Autoimmunsyndroms Typ 1, welches sich immer in der frühen Kindheit manifestiert, sind Candidainfektionen, Hypoparathyreoidismus und M. Addison. Dieses Syndrom ist durch Veränderungen im AIRE-Gen am Chromosom 21 bedingt. Deutlich häufiger ist das polygenetisch bedingte polyendokrine Autoimmunsyndrom Typ 2, welches durch M. Addison und eine chronische Autoimmunthyreoiditis charakterisiert ist. Bei etwa 20 % der Betroffenen kommt es zusätzlich zum Auftreten eines Diabetes mellitus Typ 1.<br /> Das neonatal auftretende IPEX-Syndrom (IPEX, Akronym für „immune dysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy, x-linked“) zeigt keine Assoziation mit dem HLA-Genotyp und ist durch eine ausgeprägte Autoimmunität, die man auf einen Verlust der regulatorischen T-Zellen zurückführt, charakterisiert.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>beim Verfasser</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Diabetes erhöht das Sturzrisiko deutlich
Eine dänische Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sowohl Patienten mit Typ-1- als auch Patienten mit Typ-2-Diabetes öfter stürzen und häufiger Frakturen erleiden als Menschen aus einer ...
Neue Studiendaten zu Typ-2-Diabetes und Lebensstil
Dass gesunde Ernährung und Bewegung das Diabetesrisiko sowie verschiedene Risiken von Patienten mit Diabetes senken, ist seit Langem bekannt. Und das Detailwissen zur Bedeutung von ...
Wie oft wird Diabetes nicht oder spät erkannt?
Im Allgemeinen wird von einer hohen Dunkelziffer an Personen mit undiagnostiziertem Typ-2-Diabetes ausgegangen. Ein Teil davon sind von Ärzten „übersehene“ Fälle. Eine von der University ...


