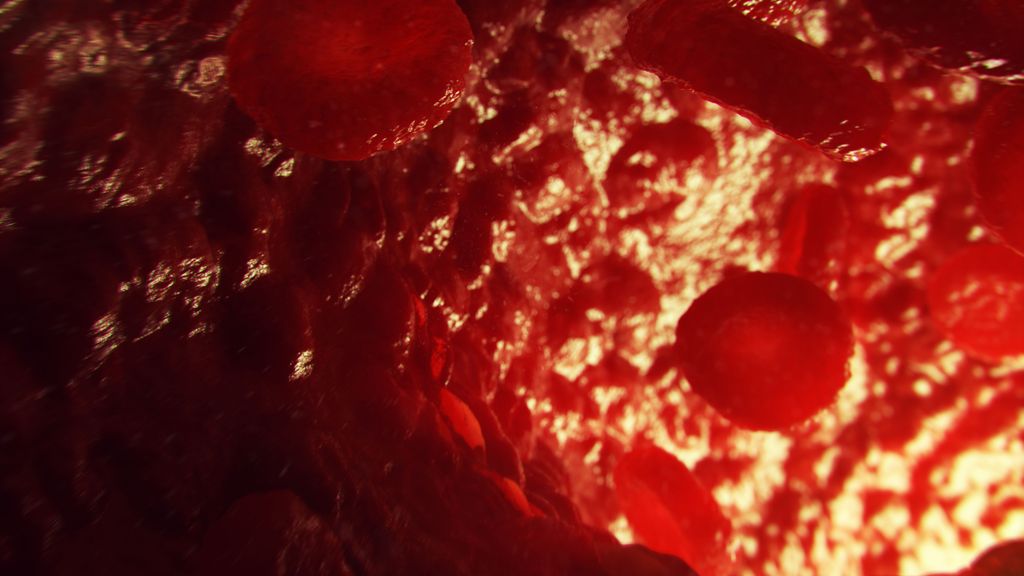
©
Getty Images/iStockphoto
Der atemlose Patient in der Praxis
Jatros
30
Min. Lesezeit
31.05.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Herzinsuffizienz (HI) oder vielleicht doch COPD? Diese differenzialdiagnostische Frage stellt sich im klinischen Alltag nicht selten. Wie in der klinischen Praxis die Grenzen zu ziehen sind und welche innovativen Therapien für die beiden Krankheitsbilder zur Verfügung stehen, war Thema einer kardiologisch-pulmologischen Fortbildung.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Der multimorbide Patient mit chronischer Dyspnoe stellt eine diagnostische Herausforderung dar, zumal Atemnot das Ergebnis sowohl eines pulmonalen als auch eines kardialen Geschehens sein kann. Die Lage wird weiter dadurch kompliziert, dass Herz- und Lungenerkrankungen nicht selten gemeinsam auftreten und zum Teil auch auf die gleichen Risikofaktoren (insbesondere das Rauchen) zurückgeführt werden können. Im Rahmen einer von Novartis unterstützten Fortbildung wurde das Symptom Dyspnoe aus kardiologischer und pulmologischer Sicht beleuchtet und das Gelernte anschließend praxisnah geübt. Ein Schauspieler gab den multimorbiden und keineswegs einfachen Patienten mit Dyspnoe, der dem Publikum die Anamnese nach Kräften erschwerte und die Veranstaltung so spannend und lebensnah machte.<img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Kardio_1702_Weblinks_seite20.jpg" alt="" width="1417" height="749" /></p> <p>Auf den medizinischen Hintergrund und die hohe Bedeutung der Dyspnoe wies Priv.-Doz. Dr. Christopher Adlbrecht von der 4. Medizinischen Abteilung am Krankenhaus Hietzing, Wien, hin. Der Dyspnoe wird auch in der Definition der HI der aktuellen HI-Guidelines der ESC der Status als Kardinalsymptom eingeräumt. Im Gegensatz dazu können Zeichen wie zum Beispiel periphere Ödeme vorhanden sein, sind aber für die Diagnose nicht zwingend erforderlich. Typisch für eine HI ist nicht nur generelle Atemlosigkeit, sondern auch eine paroxysmale, nächtliche Dyspnoe, die sich beim Aufsetzen bessert. Die Diagnose erfolgt mittels klinischer Untersuchung, Labor, EKG und Echokardiografie. Die Ziele einer Therapie der HI sind die Verbesserung der Lebensqualität und der Leistungsfähigkeit sowie die Reduktion der Hospitalisierungsrate und der Mortalität. In diesem Zusammenhang wies Adlbrecht auch auf zahlreiche Komorbiditäten hin, mit denen HI-Patienten in der Regel vorstellig werden. Darunter finden sich KHK, Diabetes, erektile Dysfunktion, Depression, COPD sowie Eisenmangelanämie. Entscheidend ist nicht zuletzt die Unterscheidung zwischen HI mit reduzierter, „mittelgradiger“ („midrange“) und erhaltener Linksventrikelfunktion. Zugelassene Therapien sind nur für die Herzinsuffizienz mit reduzierter Linksventrikelfunktion verfügbar.<br /> Im Rahmen der im Jahr 2014 publizierten Phase-III-Studie PARADIGM-HF<sup>1</sup> wurde Sacubitril/Valsartan (Entresto<sup>®</sup>) mit mehr als 8000 Studienpatienten in einer typischen Herzinsuffizienzpopulation der NYHAKlassen II bis IV verglichen. Die Patienten erhielten Entresto oder Enalapril zusätzlich zu einer optimalen Standardtherapie. Entresto ist der erste und derzeit einzige zugelassene Vertreter der neuen Klasse der ARNI (Angiotensin-Rezeptor-Neprilysin- Inhibitor). Die PARADIGM-HF-Studie wurde nach einer medianen Beobachtungszeit von 27 Monaten auf Empfehlung des Data Monitoring Committee abgebrochen, da der primäre Endpunkt (Kompositum aus kardiovaskulärem Tod und Hospitalisierungen aufgrund von Herzinsuffizienz) erreicht wurde. Hinsichtlich dieses Endpunkts wurde eine Risikoreduktion um 20 % erreicht, was einer „number needed to treat“ von lediglich 21 entspricht. Entresto reduzierte die kardiovaskuläre Mortalität um 20 % (p<0,00004) und die Gesamtmortalität um 16 % (p<0,0005). Dabei war die Verträglichkeit gut. Weniger Patienten aus der Entresto-Gruppe als aus der Enalapril- Gruppe brachen die Therapie wegen Nebenwirkungen ab.<br /> Entresto hat auf der Basis der Ergebnisse auch in den ESC-Guidelines als wichtiger Baustein der Therapie Eingang gefunden.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> McMurray JJ et al: Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med 2014; 371(11): 993- 1004</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport
Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...
ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen
Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...
Inclisiran bei Patienten mit Statinintoleranz wirksam und sicher
Eine Analyse statinintoleranter Patienten aus dem Phase III Studienprogramm ORION zeigt, dass Inclisiran die LDL-Cholesterinspiegel kardiovaskulärer Hochrisikopatienten, die kein Statin ...


