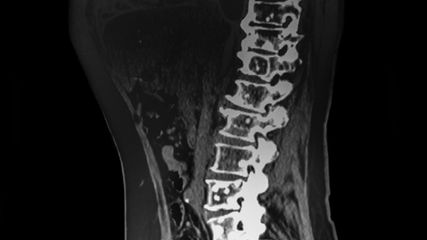©
Getty Images/iStockphoto
Urosepsis: immer öfter auch ausserhalb des Krankenhauses
<p class="article-intro">Infektionen betreffen die Urologie auf zweierlei Weise: zum einen, wenn Patienten mit infektiösen Erkrankungen des Urogenitaltraktes vorstellig werden, zum anderen aber als Komplikationen urologischer Eingriffe. Im schlimmsten Fall kommt es zur Urosepsis, für deren Management es nun neue Empfehlungen gibt.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Die Definition der Sepsis wurde im Jahr 2016 überarbeitet und geändert.<sup>1</sup> «Wir werden in Zukunft nicht mehr auf die Inflammation fokussieren, sondern auf Organversagen. Und wir fassen die Defini­tion des septischen Schocks weiter, indem wir zusätzlich zum Kreislaufversagen auch zelluläre und metabolische Veränderungen hineinnehmen, sofern sie tiefgreifend genug sind, um die 30-Tages-Mortalität zu erhöhen», sagt Dr. med. Zafer Tandoğdu, Northern Institute for Cancer Research, Newcastle upon Tyne. Zur Evaluation möglicherweise septischer Patienten werden Scores verwendet. Dabei weist Tandoğdu auf den qSOFA-Score hin, der einfach in der Handhabung und gut geeignet für ein Screening sei. Allerdings fehle in der Urologie bislang die externe Validierung.</p> <h2>Neue Definition, weniger Fälle</h2> <p>Die neue Definition werde die Epidemio­logie der Sepsis verändern. Tandoğdu verweist auf die laufende SERPENS-Studie, die zeige, dass nur rund 42 % der Patienten, die nach der alten Definition unter Sepsis litten, auch nach aktualisierter Definition diese Diagnose erhalten. Die bislang unveröffentlichten Daten von SERPENS bringen, so Tandoğdu, auch eine überraschende Einsicht: Urosepsis ist kein reines Krankenhausproblem mehr und fast die Hälfte der Fälle wird ausserhalb des Krankenhauses diagnostiziert. Dies liege nicht zuletzt daran, dass heute Spitalsentlassungen früher erfolgen und mehr Eingriffe ambulant durchgeführt werden. Fast 80 % der Urosepsisfälle stehen im Zusammenhang mit urologischen Eingriffen.<sup>2</sup> Bei den &auuml;brigen Betroffenen handle es sich in der Regel um gebrechliche, sehr alte Patienten.<br />Seit 2017 gibt es auch aktualisierte Empfehlungen zum Management der Sepsis.<sup>3</sup> Die insgesamt 67 Punkte der Empfehlungen richten sich vor allem an Intensivmediziner und seien für Urologen kaum überschaubar, so Tandoğdu. Einige Kern­elemente müssten jedoch auch auf der Urologie verstanden und umgesetzt werden. Dies betrifft vor allem stabilisierende, lebensrettende Massnahmen und den Einsatz von Antibiotika. Hinzu kommen relativ simple praktische Überlegungen. So ist bei Verdacht auf Sepsis der Katheter zu entfernen und zu ersetzen – und zwar vor der mikrobiologischen Diagnostik.<br />Hinsichtlich der lebensrettenden Massnahmen (im englischen Original unter «resuscitation» zusammengefasst) wurde die Strategie der fest vorgegebenen Ziele (z.B. systolischer Blutdruck über 65mmHg, Urinproduktion von mindestens einem halben Milliliter pro kg Körpergewicht und Stunde etc.) verlassen und ein dynamischer Zugang gewählt. Dabei sei eine zentrale Frage, ob und wie der Patient auf Flüssigkeit reagiert. Tandoğdu: «Wir haben gelernt, dass zu viel Flüssigkeit die Mortalität erhöht.»</p> <h2>Antibiotische Therapie: schnell und empirisch</h2> <p>Die empirische antibiotische Therapie sollte in der ersten Stunde beginnen. Hier besteht, so Tandoğdu, gerade in der Urologie Verbesserungsbedarf: «Nur ungefähr jeder zweite Patient bekommt seine Anti­biotika in der ersten Stunde. Im Mittel dauert es über drei Stunden, bis die Antibiotikatherapie beginnt. Hier gibt es keinen Forschungsbedarf. Wir müssen einfach unsere Performance verbessern. Empfohlen wird der Einsatz von Breitbandantibiotika. Erfahrungsgemäss erhalten jedoch viele Patienten mit einfacher Urosepsis mehrere Antibiotika.»<br />Antibiotikakombinationen sollen initial nur bei septischem Schock verwendet werden. Ist dies der Fall, empfiehlt Tandoğdu die Beratung mit den Infektiologen. Diese ist auch vorteilhaft, wenn es um die Deeskalation der Therapie geht. Diese sollte bereits nach 72 Stunden erfolgen. Tandoğdu: «Das ist aber eine vage Empfehlung. Es gibt keine klaren Empfehlungen und unterschiedliche Expertenmeinungen.» Für die Antibiotikatherapie wird generell eine Dauer von sieben bis zehn Tagen empfohlen, es kann aber auch eine längere Behandlung erforderlich sein.<br />Insgesamt ist die Prognose der Urosepsis nicht erfreulich. Dies bezieht sich keineswegs nur auf jene Patienten, die akut an der Infektion versterben. Tandoğdu betont, dass Patienten, die sich komplett erholen, in der Folge ein erhöhtes Mortalitätsrisiko aufweisen und auch ein grösseres Risiko haben, ein weiteres Mal an einer Urosepsis zu erkranken.</p> <h2>Zunehmende Probleme mit Resistenzen</h2> <p>Die zunehmende Inzidenz von Infektionen mit antibiotikaresistenten Keimen sollte auch in der Urologie die Bedeutung von «antibiotic stewardship» in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rücken, betont Dr. med. Tommaso Cai vom Regionalkrankenhaus Santa Chiara in Trento, Italien. Primäres Ziel von «antibiotic stewardship» sei es, so Cai, die klinischen Ergebnisse der antibiotischen Therapie zu verbessern und gleichzeitig die unerwünschten Ergebnisse zu minimieren. Zu diesen unerwünschten Resultaten zählt die Selektion resistenter Erregerstämme. Das sekundäre Ziel des «antibiotic stewardship» besteht in einer Reduktion von Gesundheitskosten ohne Nachteile bei der Versorgungsqualität. Letztlich gehe es, so Cai, darum, den unnötigen, exzessiven Einsatz von Antibiotika zu vermeiden und die Therapie sowie damit auch die klinischen Ergebnisse für den individuellen Patienten zu verbessern. Bedarf besteht. Rund 50 % aller Antibiotikaverschreibungen sind, so Cai, verzichtbar. Resistente Bakterien verursachen bereits heute beispielsweise in den USA mehr als 20 000 Todesfälle sowie bis zu 35 Milliarden Dollar an zusätzlichen Behandlungskosten pro Jahr.<sup>4</sup> Cai: «Wir befinden uns bereits in einer dramatischen Situation. Steigenden Zahlen an Infektionen mit resistenten Erregern steht ein Mangel an neuen Medikamenten gegenüber. Wir müssen diese Situation überwinden.»<br />Dass dies gelingen kann, zeigen mittlerweile auch Studien. So konnte in einer italienischen Arbeit der Nachweis erbracht werden, dass die Befolgung der Empfehlungen der EAU für die antibiotische Prophylaxe bei urologischen Eingriffen den Antibiotikakonsum reduziert und Resis­tenzentwicklungen verhindert.<sup>5</sup> Ein Umdenken sei in der Urologie aber auch im extramuralen Bereich erforderlich. Cai: «Vor einigen Jahren konnten wir demonstrieren, dass die antibiotische Therapie der asymptomatischen Bakteriurie mit einem erhöhten Rezidivrisiko und einem höheren Risiko von Resistenzentwicklungen assoziiert ist. Wir sollten das also nicht machen.»<sup>6, 7</sup></p> <h2>Resistenzvermeidung als gemeinsame Anstrengung</h2> <p>Damit solche Einsichten auch umgesetzt werden, müssen über die Ärzteschaft hinaus auch alle anderen beteiligten Berufsgruppen, vom Pflegepersonal über die klinischen Pharmakologen bis zu den Mikrobiologen, in ein Konzept von «antibiotic stewardship» einbezogen sein. Wichtig sei beispielsweise der regelmässige Austausch mit den lokalen Infektiologen und Mikrobiologen, um das eigene Vorgehen zu optimieren und die internationalen Empfehlungen an die regionalen Gegebenheiten anpassen zu können. Auf dieser Basis sollten auch Fortbildungen für das gesamte Personal durchgeführt werden, mit dem Ziel, den Einsatz von Antibiotika zu optimieren. Die Evaluation der Behandlungsergebnisse sichert die Qualität. Im Falle einer konkreten Verschreibung empfiehlt Cai, folgende neun Punkte im Auge zu behalten:</p> <ul> <li>das Keimspektrum, das abgedeckt werden soll</li> <li>lokale Häufigkeiten von Resistenzen</li> <li>die Historie der konkreten Infektion</li> <li>verfügbare Proben von Serum, Körperoberflächen oder -flüssigkeiten</li> <li>Allergien</li> <li>Toxizität</li> <li>Formulierung (bei oralen Antibiotika auf die Bioverfügbarkeit achten)</li> <li>Adhärenz</li> <li>Kosten</li> </ul> <p>Ein besonderes Problem stelle die Besiedelung gesunder Personen mit potenziell pathogenen Keimen dar. Hier gelte das Prinzip: «Behandle Infektionen, nicht die Besiedelung!» In diesem Sinne müsse man auch bedenken, dass zum Beispiel Fieber auch andere Ursachen haben kann und nichts mit einer bestimmten positiven Kultur zu tun haben muss. Desgleichen muss der Einsatz von Antibiotika bei sterilen Entzündungen wie zum Beispiel beim chronischen Beckenschmerzsyndrom vermieden werden. Die Dauer der antibiotischen Therapie müsse sinnvoll begrenzt werden, was einer Reevaluation der Therapie nach 48 bis 72 Stunden entspricht.</p> <h2><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Leading Opinions_Uro_1701_Weblinks_s6.jpg" alt="" width="1488" height="486" /></h2> <h2>Der Biochip als Petrischale der Zukunft</h2> <p>Von besonderer Wichtigkeit ist in der klinischen Praxis die rasche Identifikation antibiotikaresistenter Erreger. Auf Basis herkömmlicher Kulturen kann diese allerdings mehrere Tage dauern – zu lange, um die Ergebnisse vor Therapiebeginn abzuwarten. Im Rahmen des EAU-Kongresses 2017 präsentierte eine israelische Gruppe nun eine neue Technologie, mit der Resis­tenztestungen innerhalb weniger Stunden möglich werden könnten – und zwar ohne den teuren Weg des genetischen Profilings zu gehen. Dies soll mittels eines Biochips gelingen, der als eine Art «Nanopetrischale» betrachtet werden kann. Die Oberfläche des Chips weist Tausende Vertiefungen im Nanogrössenbereich auf, die mit einem Material beschichtet sind, an dem Bakterien gute Haftung finden. Durch optische Zählung kann das Wachstum der Bakterien quantifiziert werden. Und das bereits in den ersten Stunden nach dem Aufbringen. Mit diesen Nanokulturen kann also in sehr kurzer Zeit eine prinzipiell konven­tionelle Resistenztestung durchgeführt werden. Das Verfahren ist nach Ansicht der Erfinder noch nicht einsatzbereit, hat sich aber in Tests mit verbreiteten Pathogenen wie E. coli bewährt.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Seymour CW et al: Assessment of clinical criteria for sepsis: the third international consensus definitions for sepsis and septic shock (Sepsis-3). JAMA 2016; 315: 762-74 <strong>2</strong> Cek M et al: Healthcare-associated urinary tract infections in hospitalized urological patients – a global perspective: results from the GPIU studies 2003-2010. World J Urol 2014; 32: 1587-94 <strong>3</strong> Howell MD, Davis AM: Management of sepsis and septic shock. JAMA 2017; 317: 847-8 <strong>4</strong> Executive Office of the President, President’s Council of Advisors on Science and Technology: Report to the president on combating antibiotic resistance. September 2014: <a href="https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/ % 20microsites/ostp/PCAST/pcast_carb_report_sept2014.pdf">https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/ microsites/ostp/PCAST/pcast_carb_report_sept2014.pdf</a> <strong>5</strong> Cai T et al: Adherence to European Association of Urology Guidelines on prophylactic antibiotics: an important step in antimicrobial stewardship. Eur Urol 2016; 69: 276-83 <strong>6</strong> Cai T et al: Asymptomatic bacteriuria treatment is associated with a higher prevalence of antibiotic resistant strains in women with urinary tract infections. Clin Infect Dis 2015; 61: 1655-61 <strong>7</strong> Cai T et al: The role of asymptomatic bacteriuria in young women with recurrent urinary tract infections: to treat or not to treat? Clin Infect Dis 2012; 55: 771-7</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
ADT + ARPI beim metachronen, oligometastasierten Prostatakarzinom
Das metachrone, oligometastasierte Prostatakarzinom stellt eine klinisch besonders relevante Patientengruppe dar, die von einer frühen systemischen Therapiekombination aus ADT plus ...
Ausbildung: Die nächste Generation kommt
Im Rahmen der Session „Die nächste Generation“ wurde gemeinsam mit anderen spannenden Themen auch das Erlernen der Roboterchirurgie im Rahmen der Ausbildung dargestellt. Mehrere ...
Aktuelles und Zukunftsaussichten zur 177Lutetium-PSMA-Radioligandentherapie
177Lutetium-PSMA (177Lu-PSMA) ist eine zielgerichtete Therapieoption zur Behandlung des metastasierten kastrationsresistenten Prostatakarzinoms (mCRPC). Die Therapie wirkt gezielt über ...