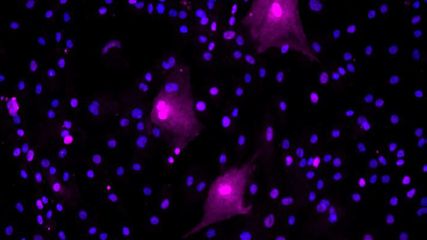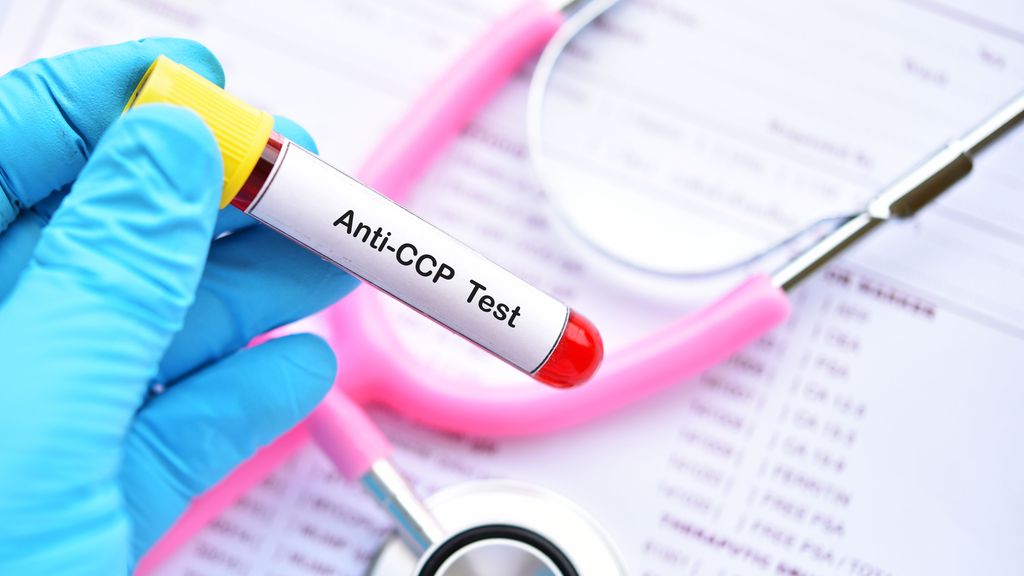
Genauere Prognose mit Antikörpermustern?
Bericht:
Dr. med. Felicitas Witte
Eine europäische Forschergruppe hat Antikörpermuster gefunden, mit denen sich vor allem schwere Verläufe einer rheumatoiden Arthritis genauer vorhersagen lassen sollen. Wie valide die Marker sind, muss aber erst in Langzeitstudien geprüft werden.
Um die Behandlung von Patienten mit rheumatoider Arthritis (RA) adäquat zu planen, ist es hilfreich, die Prognose einzuschätzen. Gemäss den aktuellen Empfehlungen der EULAR von 2019 zum Management der RA mit synthetischen und biologischen krankheitsmodifizierenden Medikamenten (DMARDs) wird empfohlen, bei Vorliegen von prognostisch ungünstigen Faktoren frühzeitig ein biologisches DMARD oder einen Januskinasehemmer zu verabreichen.1
Autoantikörper – darunter gegen den Rheumafaktor und gegen citrullinierte Proteine (ACPA) – können Hinweise auf die Prognose geben. Die Dysfunktion des Immunsystems kann zudem zur Produktion von Antikörpern gegen Proteine führen, die posttranslational modifiziert wurden, etwa indem sie acetyliert oder an Carbamylgruppen angehängt wurden. Solche Autoantikörper gegen modifizierte Proteine (AMPA) lassen sich bei manchen Patienten nachweisen, aber bisher war unklar, wie man die Marker in der Diagnostik und zur Vorhersage der Prognose nutzen kann.
Eine Forschergruppe unter Federführung des Rheumatologen Dr. med. Jagtar Singh Nijjar von der Universität Cambridge und des Bioinformatikers Fraser Morton von der Universität Glasgow hat deshalb eine grosse Kohorte von Patienten mit früher RA auf verschiedene Antikörpermuster und einen Zusammenhang mit der Prognose untersucht.2 Analysiert wurden Patientendaten von 2011 bis 2015 aus dem Scottish Early Rheumatoid Register, SERA. Von 362 Patienten erhielten die Wissenschaftler komplette AMPA-Profile. Aufgrund des Autoantikörpermusters teilten sie die Patienten in 4 Gruppen ein: Bei 73 (20%) von ihnen liessen sich nur ACPA nachweisen, bei 45 (12%) ACPA und Antikörper gegen acetylierte Peptide/Proteine (AAPA) und bei 151 (42%) ACPA, AAPA und Antikörper gegen carbamylierte Peptide/Proteine (Anti-CarP-Antikörper). 74 Patienten (20%) waren AMPA-negativ und 19 (5%) hatten Autoantikörper gegen seltenere Antikörper.
Primärer Endpunkt der Studie war die radiologisch feststellbare Progression nach einem Jahr. Dies bestimmten die Forscher anhand von beidseitigen Röntgenbildern von Händen und Füssen zu Beginn der Studie und nach 12 Monaten. Als Score verwendeten sie die Sharp-van-der-Heijde(SvH)-Methode. Sekundäre Endpunkte waren die geschätzte Veränderung in der Erosion und die Verkleinerung des Gelenkspaltes. Zu 233 Patienten lagen komplette beidseitige Aufnahmen der Hände und Füsse in ausreichender Qualität vor. Analysiert wurden schliesslich die Daten von 221 Patienten.
Nach einem Jahr zeigten dreifach positive Patienten – also diejenigen mit ACPA, AAPA und Anti-CarP-Antikörpern – deutlich mehr Progression in den Röntgenbildern als Patienten, die nur ACPA hatten. Der SvH-Score nahm bei den dreifach positiven Patienten im Schnitt um 1,8 Punkte zu (95% CI: 0,9–2,6), bei den einfach positiven nur um 0,5 Punkte (95% CI: 0,1–1,0).
Es zeigte sich kein Unterschied in der radiologischen Progression zwischen Patienten, die einfach positiv waren, und jenen, die AMPA-negativ waren. Das weise darauf hin, so die Autoren, dass es sich auf die radiologische Progression nur dann auswirke, wenn ein Patient nicht nur ACPA-positiv sei, sondern zusätzlich auch Antikörper gegen andere modifizierte Proteine aufweise. Bei den dreifach positiven Patienten fanden sich nach einem Jahr im Schnitt mehr Erosionen als bei den einfach positiven, aber auch hier zeigte sich kein Unterschied zwischen einfach positiven Patienten und AMPA-negativen. Ein Unterschied in den Gelenkspaltveränderung liess sich weder zwischen dreifach positiven und einfach positiven Patienten nachweisen noch zwischen einfach positiven und AMPA-negativen.
Das Fazit der Autoren: Es sind weitere prospektive Studien notwendig, um herauszufinden, ob sich mit dem Autoantikörperstatus Patienten stratifizieren lassen. Dies könnte sich möglicherweise auf Therapieentscheidungen auswirken.
Weitere Informationen finden Sie im Interview «Komplizierter, als wir dachten» mit Prof. Dr. med. Burkhard Möller.
Literatur:
1 Smolen JS et al.: Ann Rheum Dis 2020; 79: 685-99 2 Nijjar JS et al.: Lancet Rheumatol 2021; 3: e284-93
Das könnte Sie auch interessieren:
Neue Therapieansätze für Arthrose
Dass Zellen altern, könnte eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Arthrose spielen. Welche Mechanismen dahinterstecken und welche Ansätze sich für neue Therapien ergeben, ...
Fertilität und Schwangerschaft bei entzündlicher Arthritis
Auf der 13. International Conference on Reproduction, Pregnancy and Rheumatic Diseases (RheumaPreg 2025) in Wien präsentierte Prof. Dr. Radboud Dolhain (Rotterdam, NL) aktuelle ...
Therapieauswahl nach pulmonalem Inflammations- und Fibrosemuster
Da Fibrose und Entzündung in unterschiedlichem Ausmaß zu Lungenbeteiligungen bei rheumatologischen Erkrankungen beitragen, werden im klinischen Alltag Methoden gebraucht, um beide ...