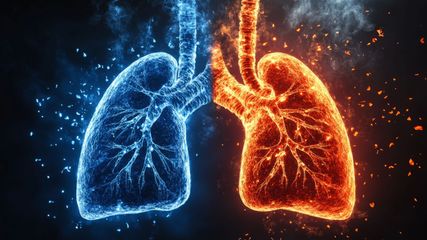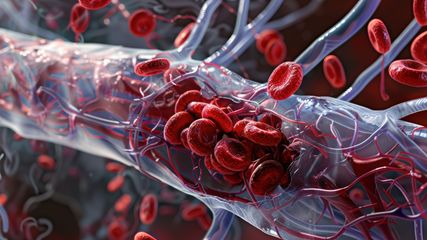©
Getty Images/iStockphoto
Da ist der Wurm drin …
Jatros
Autor:
Ass. Dr. Melanie Vogl
E-Mail: melanie.vogl@krems.lknoe.at
Autor:
Prim. Assoc. Prof. Dr. Elisabeth Stubenberger
Autor:
Prim. Assoc. Prof. Dr. Peter Errhalt
Universitätsklinikum Krems<br> Abteilung für Allgemein- und Thoraxchirurgie
30
Min. Lesezeit
14.03.2019
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Wir berichten über eine 43-jährige Patientin, die Anfang 2018 aufgrund von seit zwei Wochen bestehendem, trockenem Reizhusten vorstellig wurde.</p>
<hr />
<p class="article-content"><h2>Anamnese und Diagnostik</h2> <p>Abgesehen von diesen Beschwerden war die Patientin in ausgezeichnetem Allgemeinzustand und konnte sowohl beruflichen als auch sportlichen Aktivitäten wie gewohnt nachgehen. Nennenswerte internistische Vorerkrankungen waren nicht zu erheben, jedoch berichtete die Patientin von einer bekannten, ehemals 4 cm messenden thorakalen Raumforderung links apikal. Dabei handelte es sich um einen Zufallsbefund einer Computertomografie (CT) im Jahr 2002. Eine damals vorgenommene Bronchoskopie zur Histologiegewinnung blieb erfolglos und bei völliger Beschwerdefreiheit lehnte die Patientin jede weitere Abklärung ab.<br /> Im Februar 2018 zeigte eine neuerliche CT eine nun riesige, überwiegend zystisch imponierende Raumforderung links thorakal mit einer Größe von 8,6 x 14 x 19 cm. In einer ergänzenden Sonografie wurde die Raumforderung als semisolide beschrieben, in einer anschließenden Magnetresonanztomografie (MRT) als ausgedehnte, multipel septierte, flüssigkeitsgefüllte Struktur mit bandförmiger Binnenstruktur im Inneren, einem „waterlily sign“ entsprechend (Abb. 1). Alle drei bildgebenden Verfahren waren daher hochgradig verdächtig für eine pulmonale Echinokokkose.<sup>1−4</sup><br /> Der häufigste Erreger ist mit rund 95 % Echinococcus granulosus, auch bekannt als Hundebandwurm.<sup>5</sup> Nach der Leber mit rund 80 % ist die Lunge beim Erwachsenen mit 10 bis 30 % das am zweithäufigsten befallene Organ. Klinisch sind betroffene Patienten oftmals lange asymptomatisch aufgrund des langsamen Wachstums von nur 1 bis 5 cm pro Jahr.<sup>2, 3</sup><br /> Ein serologischer Antikörper-Nachweis war bei unserer Patientin negativ. Jedoch schließt dies, bei einer Sensitivität von 50 bis 65 % bei rein pulmonalem Befall, eine floride Echinococcus-Infektion keinesfalls aus.<sup>2, 6</sup> Ein Erregernachweis zur Sicherung der Diagnose mittels transbronchialer oder transthorakaler Biopsie wird aufgrund der Disseminationsgefahr als obsolet angesehen. Auch ohne Keimnachweis wurde daher aufgrund des pathognomonischen „waterlily sign“ in der Bildgebung und bei positiver Anamnese mit einem Jäger als Ehemann die Diagnose einer pulmonalen Echinokokkose gestellt.<sup>4</sup></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Pneumo_1901_Weblinks_jatros_pneumo_1901_s31_abb1_vogl_2.jpg" alt="" width="250" height="226" /></p> <h2>Chirurgische Therapie</h2> <p>Auf Basis dieser Arbeitshypothese wurde, vor einer operativen Entfernung der Echinococcus-Zyste, eine präoperative antiparasitäre Therapie mit Albendazol eingeleitet. Bei guter Verträglichkeit nahm die Patientin wie verordnet 400 mg zweimal täglich für zwei Zyklen à 28 Tage ein, gefolgt von jeweils 14 Tagen Pause.<br /> Im Anschluss an die medikamentöse Therapie erfolgte die geplante chirurgische Sanierung. Mittels anterolateraler Thorakotomie wurde der linke Hemithorax eröffnet und es zeigte sich sogleich eine zystische, fluktuierende Läsion. Wider Erwarten ließ sich jedoch aus der vermeintlichen Zyste keine Flüssigkeit aspirieren. Ein intraoperativer Gefrierschnitt aus einem solide imponierenden Anteil ergab einen myxoiden Tumor.<br /> Somit stand, auch bei unerwarteter Änderung der Diagnose, weiterhin die Indikation zur vollständigen Resektion. Die Tumormasse wurde komplett entfernt, eine Lymphadenektomie durchgeführt und der Thorax verschlossen. Im endgültigen histologischen Befund wurde das Resektat als „Spindelzelllipom mit ausgedehnten myxoiden Veränderungen“ beschrieben, ein myxoides Liposarkom konnte mittels Mutationsanalyse ausgeschlossen werden. Die Prognose bei Spindelzelllipomen ist gut, Therapie der Wahl ist die vollständige Resektion, Lokalrezidive sowie Metastasierung sind selten und engmaschige Verlaufskontrollen werden empfohlen.<br /> Letztlich entpuppte sich also bei unserer Patientin die vermeintliche seltene pulmonale Infektionskrankheit als seltener thorakaler Tumor. In bisherigen Verlaufskontrollen waren sowohl klinischer Zustand als auch CT-Befund der Patientin sehr erfreulich, sodass wir uns weiterhin auf regelmäßige ambulante Kontrolltermine beschränken können.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Zoller T, Suttorp N: Echinokokkose. In: Dietel M, Suttorp N, Zeitz M (editors): Harrisons Innere Medizin. 18. Auflage. Berlin: ABW Verlag, 2012 <strong>2</strong> Morar R, Feldman C: Pulmonary echinococcosis. Eur Respir J 2003; 21: 1069-77 <strong>3</strong> Eichhorn ME et al.: Pulmonale Echinokokkose: chirurgische Aspekte. Zentralbl Chir 2015; 140: S29-35 <strong>4</strong> Hosch W et al.: Bildgebende Verfahren in Diagnostik und Therapie der zystischen Echinokokkose. RöFo 2004; 176: 679-87 <strong>5</strong> Craig PS et al.: Prevention and control of cystic echinococcosis. Lancet Infect Dis 2007; 7: 385-94 <strong>6</strong> Brunetti E et al.: Expert consensus for the diagnosis and treatment of cystic and alveolar echinococcosis in humans. Acta Trop 2010; 114: 1-16</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Therapieansprechen beurteilen, aber wie?
Wie werden Asthmasymptome beurteilt? Welcher Fragebogen ist dazu geeignet und spielt es eine Rolle, ob er von den Behandelnden oder den Betroffenen ausgefüllt wird? Wie wird das ...
Lungenembolie: Engramme für den Behandlungspfad
Die Lungenembolie ist ein häufiges und potenziell lebensbedrohliches Krankheitsbild. Die Diagnose bleibt herausfordernd – immer noch zählt die Lungenembolie zu den Diagnosen, die am ...