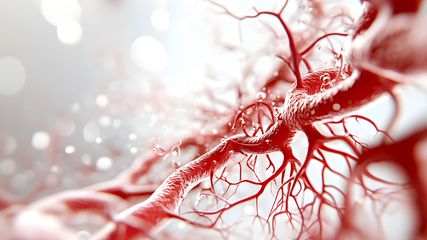©
Getty Images/iStockphoto
Wirbelsäule und Sport
Jatros
Autor:
Dr. Raphael Scheuer
Wirbelsäulenzentrum Wien-Speising, Orthopädisches Spital Speising, Wien<br> E-Mail: raphael@scheuer.wien
30
Min. Lesezeit
26.03.2020
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die Betreuung von Sportlern mit Wirbelsäulenbeschwerden setzt die Kenntnis sportartspezifischer Belastungsmuster einerseits und potenziell wirbelsäulenschädlicher Bewegungsabläufe andererseits voraus. Sportassoziierte Beschwerdebilder stellen unter den Wirbelsäulenbeschwerden eine verschwindende Minderheit dar, dennoch sind sie bei einigen „Risikosportarten“ gehäuft zu beobachten. Sind Wirbelsäulenveränderungen wie Skoliose, Morbus Scheuermann oder Spondylolyse bekannt, können Risikosportarten eine Progredienz des Befundes bedingen.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Rein axiale Belastungen führen kaum zu nachweisbaren Läsionen, in Kombination mit Flexion, Extension oder auch Rotation sind aber durchaus Schädigungen möglich.</li> <li>Die jugendliche Wirbelsäule reagiert besonders empfindlich auf singuläre und im Speziellen auch repetitive Belastungen.</li> <li>Vermehrte Vorsicht ist bei Belastungen gegen Tagesende geboten.</li> <li>Die positiven Effekte regelmäßiger körperlicher Betätigung auf den Gesamtorganismus überwiegen die potenziellen Schäden aber bei Weitem.</li> </ul> </div> <p>Lumbale Beschwerden sind sowohl in Industriestaaten wie auch in Entwicklungsländern Hauptgrund für Einschränkungen im alltäglichen Leben, an Jahren der Lebenszeit gerechnet. Die Lebenszeitprävalenz von Beschwerden im Hals- oder Lendenwirbelsäulenbereich beträgt in Industriestaaten zwischen 60 % und 85 % . Ein weltweiter Review aus dem Jahr 2012 über 165 Studien aus 54 Ländern beschreibt die Punktprävalenz von Kreuzschmerzen mit 18,3 % , Schmerzen im letzten Monat gaben dabei 30,8 % der Befragten an.<br /> Ging man früher in bis zu 85 % der Fälle von unspezifischen Wirbelsäulenbeschwerden aus, also rein funktionellen Beschwerden im Sinne von muskulärer Überanstrengung oder Gelenksblockaden, ist es in den letzten 20 Jahren mittels verbesserter diagnostischer Verfahren gelungen, diesen Prozentsatz deutlich zu senken.<br /> Als schmerzursächliche Strukturen werden Wirbelgelenksschmerzen bei jüngeren Patienten zu 15 % , bei älteren bis zu 40 % angegeben. Diskogene Ursachen dürften mit 39 % hauptursächlich für den Kreuzschmerz sein. Das Kreuzdarmbeingelenk (ISG) wird in 18–30 % der Fälle für Beschwerden verantwortlich gemacht. Während diese Zahlen das ISG nach Ansicht des Autors weit überrepräsentieren, stellt der diskogene Schmerz die vermutlich weitaus häufigste Beschwerdeursache thorakolumbal bei Sportlern dar.<br /> Ob tatsächlich auch strukturelle Schäden durch sportliche Betätigung verursacht wurden, ist im Einzelfall meist schwer zu beurteilen. Die Autoren diverser Studien halten fest, dass sich Läsionen im Bereich der Wirbelsäule im Leistungssportbereich generell häufiger finden als in der Gesamtbevölkerung. Sie werden vor allem auf Verletzungen oder Überlastungen der empfindlichen jugendlichen Wirbelsäule zurückgeführt. Unterscheiden muss man dabei sicherlich die höchst individuellen Belastungsmuster verschiedener Sportarten. So fanden sich in Zwillingsuntersuchungen bei Ausdauersportlern keine nennenswerten Unterschiede hinsichtlich Auftreten von Bandscheibendegenerationszeichen, bei Kraftsportarten hingegen schon – besonders im thorakolumbalen Übergangsbereich. Und radiologischen Studien zufolge leitet die Bandscheibendegeneration nahezu regelhaft die Degeneration des gesamten Bewegungssegmentes ein.<br /> Rotationssportarten im Sinne von Wurfund Schlagsportarten weisen ebenso hohe Raten an wirbelsäulenassoziierten Beschwerden auf.</p> <h2>Wirbelsäule und Sportschäden</h2> <p><strong>Makrotraumata</strong><br /> Akute knöcherne Traumata der Wirbelsäule im Sport sind dank zahlreicher präventiver Maßnahmen deutlich rückläufig. Die häufigsten ernsteren Verletzungen sind traumatische Spondylolysen, also Bogenfrakturen der Pars interarticularis, oftmals verbunden mit einer im Verlauf auftretenden Spondylolisthese. Am häufigsten finden sich solche Verletzungen im Bereich der Lendenwirbelsäule unter Turnern und Gewichthebern. Doch auch der brasilianische Fußballstar Neymar zog sich dem Vernehmen nach bei der WM 2014 im Zuge eines Anpralltraumas am Rücken eine traumatische Spondylolyse zu.<br /> Auch Einbrüche der Wirbelkörpergrund- bzw. -deckplatten werden nach veritablen Stauchungstraumata immer wieder gesehen.</p> <p><strong>Mikrotraumata</strong><br /> Die auf den ersten Blick weniger dramatischen Überlastungserscheinungen an der Wirbelsäule scheinen allerdings auch unter jungen Athleten tendenziell zuzunehmen. Etwa ein Zehntel aller Distorsionen im Sport betrifft z. B. die Halswirbelsäule – vor allem in Kontaktsportarten, aber auch beim Turmspringen oder bei der Gymnastik. Sobald einmal Beschwerden aufgrund der häufig repetitiven Überlastungen im Leistungssport auftreten, zeigt etwa ein Drittel der Sportler rezidivierende Beschwerden.<br /> Es ist natürlich festzuhalten, dass bei Weitem nicht nur sportliche junge Menschen unter Wirbelsäulenproblemen leiden. Eine Untersuchung an über 400 000 Kindern und Jugendlichen aus 28 Ländern befand eine 37 % -ige Wahrscheinlichkeit für monatliche oder noch häufiger auftretende Schmerzepisoden im Bereich der Lendenwirbelsäule in dieser Population.<br /> Generell ist zu sagen, dass die Rumpfmuskelkontrolle nicht nur essenziell für die sportliche Leistungsfähigkeit ist, sondern dass eine unzureichende Koordinierung der Rumpfmuskulatur mit einem erhöhten Risiko für Beschwerden im Lendenwirbelsäulenbereich einhergeht.</p> <h2>Häufige Läsionen</h2> <p><strong>Muskelläsionen</strong><br /> Muskuläre Verletzungen der Rumpfmuskulatur sind im Akutfall klinisch mitunter nur schwer von strukturellen Schädigungen der Wirbelsäule abzugrenzen. Als Risikosportarten in diesem Zusammenhang werden in der Literatur Leichtathletik, Rudern, Skifahren oder Turnen erwähnt. Nicht übersehen werden sollte dabei eine etwaige Fraktur der Proc. transversi bzw. der 12. Rippe.</p> <p><strong>Bandscheibenläsionen</strong><br /> Vom klassischen Bandscheibenvorfall, der typischerweise mit einer Nervenwurzelkompression und in Arm oder Bein ausstrahlenden Schmerzen einhergeht, ist der sogenannte diskogene (bandscheibenbedingte) lokale Schmerz abzugrenzen. Untersuchungen zeigten bei den meisten Sportarten keine Assoziation mit einem erhöhten Risiko von Bandscheibenherniationen, im Gegenteil wurde ein eher protektiver Effekt vermutet. Das wirft unweigerlich die Frage auf, ob denn bestimmte Belastungsmuster überhaupt für die Degeneration von Bandscheiben ursächlich sein könnten. Hohe axiale Kompressionskräfte auf die Lendenwirbelsäule zeigten beispielsweise in vitro primär Impressionen von Grund- oder Deckplatten der Wirbelkörper und gelegentlich Schmorl’sche Knotenbildungen – assoziierte Bandscheibenläsionen fanden sich hingegen nicht. Dies bestätigt auch der klinische Alltag.<br /> Bei hohen axialen Belastungen in Kombination mit Flexions- oder Rotationsbewegungen finden sich allerdings durchaus erhöhte Anulus-fibrosus-Rupturraten. Dies kann nun einerseits zum klassischen Bandscheibenvorfall führen, andererseits kann es die Degeneration der Bandscheibe einleiten – auch ohne symptomatischen Diskusprolaps. Theorien besagen, dass durch die Läsion des Anulus fibrosus die Osteochondrose induziert wird. Dabei handelt es sich um eine Veränderung der Wirbelkörperendplatten, welche in der Bildgebung erstlinig durch ein Knochenmarködem (auch als lokalisierte Osteoporose bezeichnet) und oft im weiteren Verlauf durch eine fettige Degeneration und schließlich Sklerosierung gekennzeichnet ist. Die Ursache für diese Veränderungen ist nicht hinlänglich geklärt, die Hypothese des hämatogen induzierten Low-Grade-Infekts wird vom Autor als die plausibelste erachtet und danach auch die Therapie ausgerichtet. Während im Nativröntgen diese Veränderung erst im fortgeschrittenen Zustand (der auch mit vermehrter Sklerosierung einhergeht) zu sehen ist, lässt sie sich in der Magnetresonanztomografie schon viel früher erkennen. Die Einteilung nach Modic beschreibt die Grade I–III, wobei Modic I in erster Linie einem Knochenmarködem entspricht und Modic III bereits weitgehende Sklerosierung abbildet. Der gängigen Literatur zufolge ist Stadium Modic I sehr häufig mit lumbalen Schmerzen verbunden, da die Wirbelkörperendplatten von Gefäßen und begleitenden Nerven durchsetzt sind. Die Existenz des diskogenen Schmerzes wird allerdings vielfach diskutiert, da die gesunde Bandscheibe selbst keine sensible Innervation aufweist. Vor allem Modic-I- und -II-Veränderungen sind auch durchwegs spontan reversibel. Man muss aber jedenfalls davon ausgehen, dass eine fortgeschrittene Osteochondrose einer Degeneration des gesamten Bewegungssegments gleichkommt, da die Nährstoffversorgung der Bandscheibe in erster Linie über die Grund- und Deckplatten der angrenzenden Wirbelkörper erfolgt und eine zunehmende Sklerosierung diesen Nährstoffaustausch behindert, wenn nicht gar verhindert.</p> <p><strong>Spondylolysen</strong><br /> Spondylolysen können neben genetischer Prädisposition und den schon erwähnten Makrotraumata auch durch rezidivierende Mikrotraumata entstehen, wobei es sich dann um Ermüdungsfrakturen der Interartikularportion handelt. Das legt den Verdacht nahe, dass Sportarten mit rezidivierenden, evtl. auch asymmetrischen Hyperlordosierungsbewegungen, wie Turnen, Ballett, aber auch Tennis, die Entwicklung einer evtl. auch einseitigen Spondylolyse begünstigen.</p> <p><strong>Skoliose und Morbus Scheuermann</strong><br /> Diese sich hauptsächlich im Rahmen des pubertären Wachstumsschubes manifestierenden Veränderungen scheinen in diversen Sportarten gehäuft vorzukommen: Skoliosen finden sich etwa bei Turnern, Wurfsportlern und Ruderern auffallend oft, weshalb naheliegenderweise die teils asymmetrische Rumpfbeanspruchung dieser Sportarten als Ursache diskutiert wird. Götze untersuchte daher die Korrelation von Auftreten und Ausprägung von Skoliosen mit der Intensität der betriebenen Sportarten, fand dabei aber keinen Zusammenhang. Laut einer Arbeit von Hopf sind bei Skoliosen mit einem Cobb- Winkel von 10–20° alle Sportarten uneingeschränkt durchführbar. Bei einem Cobb- Winkel von 21–40° sind grundsätzlich ebenso alle Sportarten denkbar, axiale Traumata/Stauchungen sollten aber vermieden werden. Bei Skoliosen mit einem Cobb-Winkel ab 41° gelten dieselben Empfehlungen, wobei kardiopulmonale Defizite mit zunehmender Verkrümmung natürlich eher zum Tragen kommen.<br /> Die Angaben über das Auftreten von Morbus Scheuermann in der Normalbevölkerung sind schwankend. Unter diversen Sportlern wie Turnern oder Basketballern scheinen diese Veränderungen aber gehäuft aufzutreten. Eine Verschlechterung der radiologischen Veränderungen findet sich Studien zufolge bei vielen Sportlern auch noch mehrere Jahre nach dem schmerzhaft manifesten Morbus Scheuermann und degenerative Veränderungen an der Wirbelsäule treten somit um etliche Jahre früher auf. Junghanns postulierte in diesem Zusammenhang, dass das Stadium der Erkrankung ausschlaggebend ist, ob eine betroffene Wirbelsäule „sportfähig“ ist oder nicht: In der floriden Phase sollten Druck- oder Stauchbelastungen vermieden werden.</p> <p><strong>Spondylodese</strong><br /> Im Zusammenhang mit Morbus Bechterew und Skoliosen ist auch die Sportfähigkeit nach erfolgter Spondylodese zu erwähnen. Gängigen Empfehlungen zufolge sollten nach erfolgter radiologischer Kontrolle nach 6–12 Monaten keine nennenswerten Einschränkungen betreffend Sport bestehen, sicherlich individuell abhängig von Restkrümmung und Ausmaß der Spondylodese. Sportarten mit hohen axialen Belastungen oder erhöhter Sturzgefahr bzw. möglicher intensiver Fremdeinwirkung (Kontaktsportarten) sollten jedoch gemieden werden.</p> <h2>Wirbelsäule und Rotationssportarten</h2> <p>Schon seit vielen Jahren wird Golf als Risikosportart für die Wirbelsäule erachtet. Etwa die Hälfte aller Golfspieler klagt über rezidivierende Beschwerden im Sinne von Lumbago, 90 % davon spielen den modernen Golfabschlag („modern swing“), bei dem man über den gesamten Bewegungsablauf die Fersen am Boden hält, um möglichst viel Kontrolle über den Schlag zu haben. Nackenschmerzen betreffen vor allem weniger versierte Golfspieler.<br /> Dabei darf aber nicht übersehen werden, dass ein Großteil der Golfspieler erst in höherem Alter mit dem Golfsport beginnt und sich auch die wöchentliche Spielzeit mit zunehmendem Alter zumeist erhöht.<br /> Der Blick auf diverse Statistiken zeigt uns, dass Rückenschmerzen in vielen Wurfund Schlagsportarten ein verbreitetes Problem darstellen. Die Wurf- und Schlagbewegungen gehen dabei so gut wie immer mit einer Rotation und Lateralflexion im Rumpfbereich einher (Crunch), was notwendig ist, um das Wurfgerät bzw. den jeweiligen Schläger optimal zu beschleunigen. Es scheint somit nicht weit hergeholt, dass dieses Bewegungsmuster für die Entstehung von Bandscheibenläsionen und in weiterer Folge Rückenschmerzen mitverantwortlich sein könnte. Aktivierte Osteochondrosen dürften lumbal auch hier die Hauptschmerzursache darstellen.</p> <h2>Untersuchungen an Golfspielern</h2> <p>Der Golfsport stellt ein besonders günstiges Untersuchungsfeld dar, insofern als im Gegensatz zu den meisten Wurf- und Schlagsportarten der Bewegungsablauf im Stehen und nicht während des Laufens über einen Platz erfolgt. Der Bewegungsablauf kann daher in nahezu beliebiger Art und Weise apparativ verfolgt, aufgezeichnet und vermessen werden.<br /> Im Zuge des Literaturstudiums stellte sich heraus, dass bereits diverse Studien den Zusammenhang des Golfabschlages mit Rückenschmerzen analysiert haben. In erster Linie wurden dabei das Ausmaß der Verdrehung zwischen Schulter- und Beckengürtel (X-Faktor, Abb. 1) bzw. das Ausmaß der Lateralflexion während der Schlagbewegung untersucht. Auch die Geschwindigkeit der Rumpfrotation ließ man mit einfließen („crunch factor“, Abb. 2). Die mangelhafte Abschlagtechnik vieler Amateure führt zu übermäßiger Lateralflexion und Rotation im Bereich der Lendenwirbelsäule. Es fand sich allerdings in keiner der vorliegenden Studien ein signifikanter Zusammenhang zwischen einem oder mehreren der gemessenen Parameter und dem Auftreten von Kreuzschmerzen.<br /> Wie andere Kreuzschmerzpatienten auch weisen betroffene Golfspieler aber auffallende Muskelaktivierungsmuster der rumpfstabilisierenden Muskulatur sowie eine verminderte Ausdauerleistungsfähigkeit derselben auf. Oftmals ist dabei auch eine verminderte Innenrotationsfähigkeit der Hüften mit vergesellschaftet, was naturgemäß eine vermehrte Rotation im Bereich der Lendenwirbelsäule erforderlich macht.<br /> Eine eigens durchgeführte Untersuchung des Autors an Golfspielern unterschiedlichen Leistungsniveaus zeigte die größten Unterschiede am Golfschwung zwischen Golfspielern mit und jenen ohne wirbelsäulenassoziierte Beschwerden bei den Beschleunigungskräften am Umschlagpunkt von Aushol- zu Schwungbewegung.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2020_Jatros_Ortho_2002_Weblinks_jat_ortho_s29_abb1+2_scheuer.jpg" alt="" width="850" height="358" /></p> <h2>Muskelkräftigung</h2> <p>Gezielte Kräftigung der Rumpf- und Bauchmuskulatur ermöglicht die Stabilisation der Wirbelsäule. Vor allem eine effiziente Bauchpresse stabilisiert die Wirbelsäule und richtet sie über das Zwerchfell auch aktiv auf, was die Bandscheiben entlastet. Gewichtheber setzen daher zur Verstärkung der Wirkung der Pressatmung auch einen Bauchgurt ein.</p> <h2>Instabilitäten auch tageszeitabhängig?</h2> <p>Bandscheiben verlieren im zirkadianen Verlauf an Höhe, was in der kaudalen Lendenwirbelsäule etwa 10 % ausmacht und insgesamt zu einer Körpergrößenabnahme gegen Abend führt. Dies bedingt vermutlich auch eine vermehrte Instabilität der Bewegungssegmente, da die Längsbänder insuffizient werden. Es stellt sich somit die Frage, ob Belastungen für die Wirbelsäule abends noch ungünstigere Auswirkungen haben könnten.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>beim Verfasser</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Neueste Entwicklungen der spinalen EndoskopieNachhaltige keramische Knochenimplantate bald aus dem 3D-Drucker
Die endoskopische Wirbelsäulenchirurgie hat sich von einer rein perkutanen Technik zu einer hochpräzisen, technisch ausgereiften Methode entwickelt, die ein weites Spektrum degenerativer ...
Seltene Kleingefässvaskulitiden im Fokus
Bei Vaskulitiden der kleinen Gefässe liegt eine nekrotisierende Entzündung der Gefässwand von kleinen intraparenchymatösen Arterien, Arteriolen, Kapillaren und Venolen vor. Was gilt es ...
Elektive Hüft-TEP bei Adipositas Grad III
Übergewichtige Patient:innen leiden früher als normalgewichtige Personen an einer Hüft- oder Kniearthrose. Allerdings sieht die aktuelle S3-Leitlinie zur Behandlung der Coxarthrose in ...