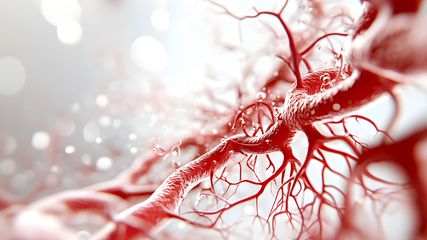©
Getty Images/iStockphoto
Sportliche Aktivität nach Verletzungen der Wirbelsäule
Jatros
Autor:
Ass.-Prof. Dr. Gholam Pajenda
Universitätsklinik für Unfallchirurgie<br> Medizinische Universität Wien<br> E-Mail: gholam.pajenda@meduniwien.ac.at
30
Min. Lesezeit
13.07.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die Bestätigung der Sporttauglichkeit nach Wirbelsäulenverletzung ist eine kritische Entscheidung, die auf der Basis medizinischer Guidelines und der Überprüfung des individuellen Risikoprofils erfolgt. Freiheit von Schmerz und neurologischen Symptomen, volles freies Bewegungsausmaß und adäquater Kraftaufbau sind wichtige Voraussetzungen für die Rückkehr zum Leistungssport.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Genaue Anamneseerhebung und klinisch-neurologische Untersuchung</li> <li>Adäquate bildgebende Diagnostik und Einschätzung der Instabilität</li> <li>Wiederherstellung des Wirbelsäulenprofils und der Belastungsfähigkeit</li> <li>Frühe Mobilisation und Vorbereitung auf den Sport während der Rehabilitationsphase</li> <li>Individuelle Risikoanalyse und Aufklärung hinsichtlich der Vorbeugung von Folgeverletzungen</li> </ul> </div> <p>Schwere Wirbelsäulenverletzungen sind Folgen von Hochrasanztraumen im Rahmen von Verkehrsunfällen, Stürzen aus großer Höhe und zunehmend auch Sportunfällen. Die Anforderungen und Erwartungen an die Behandlung sind sehr hoch, denn schwere Verletzungen der Wirbelsäule sind oft mit Einschränkungen – unter anderem der sportlichen Aktivität – verbunden. Die genaue Analyse des Verletzungsmechanismus und das Einschätzen der Stabilität bilden die Entscheidungsgrundlage für die Behandlung. Während stabile Frakturen meistens konservativ behandelt werden, machen schwere und instabile Verletzungen eine operative Versorgung erforderlich. <br /> Die Ziele der Behandlung sind die Wiederherstellung der Belastungsfähigkeit bei möglichst geringer Beeinträchtigung der Funktion und die Rückkehr zur vollen Sportfähigkeit. Die Ausgangssituation bei Sportlern ist aufgrund des gut ausgebildeten Körpergefühls und Koordinationsvermögens sowie der Disziplin, Frustrationstoleranz und hohen Akzeptanz der rehabilitativen Maßnahmen sehr gut. Es ist aber zu berücksichtigen, dass die verwendeten Implantate bei Sportlern im Vergleich zur Normalbevölkerung relativ früh höheren Belastungen ausgesetzt sind.<br /> Die spezielle Anatomie, bestehend aus dem Wirbelkörper, dem Discus interver­tebralis und der Zygapophysialgelenke, den Bändern und der Muskulatur, gewährleistet primär eine statische Funktion der Wirbelsäule. Mit den Krümmungen erfüllt die Wirbelsäule biomechanisch betrachtet eine gewisse Stoßdämpferfunktion. Durch langsame Verstärkung der Krümmungen bei axialer Belastung kommt es zu einer Reduktion der Spitzenkräfte. Ist es durch die Verletzung und/oder eine operative bzw. konservative Behandlung zur Reduktion und Funktionseinschränkung der Bewegungssegmente gekommen, muss die Sportaktivität entsprechend angepasst werden. Dieser Situation Rechnung tragend, wird generell empfohlen, die Fusionsstrecke so kurz wie möglich zu halten. Die modernen Instrumentarien und Operationstechniken erlauben es, viele Verletzungen über anatomiegerechtere Zugänge weichteilschonend zu stabilisieren.</p> <h2>Physiotherapie und Rehabilitation</h2> <p>Die Vorbereitung für den Sport beginnt bereits mit dem Einleiten einer konservativen Behandlung, bei operativer Behandlung beginnt die Vorbereitung nach der chirurgischen Versorgung.</p> <h2>Frühe postoperative Phase</h2> <p>In der frühen postoperativen Phase erfolgt die Anleitung zum wirbelsäulenstabilisierenden Verhalten und zur Stabilisierung des Rumpfes. Die Mobilisierung aus dem Bett und die Anleitung zur Bewältigung des täglichen Lebens stehen im Vordergrund. Diese Phase ist für den Sicherheitsgewinn der Patienten von entscheidender Bedeutung.</p> <h2>Phase der Reaktivierung</h2> <p>Das Augenmerk liegt auf dem Übergang zu normalen Bewegungsmustern, dem Training der Basisfähigkeiten wie Gehen und Stiegensteigen und der Selbstständigkeit bei den Erledigungen des täglichen Lebens.</p> <h2>Phase der Stabilisierung und medizinischen Trainingstherapie</h2> <p>Dabei werden axiale Belastung und Koordinationstraining auf instabiler Unterlage trainiert sowie Unterwassertherapie und Rückenschulung durchgeführt.</p> <h2>Rückkehr zum Sport</h2> <p>Die komplexe Anatomie und Biomechanik der Wirbelsäule und das breite Spektrum der Verletzungen erschweren die Erstellung eines generellen Standardprotokolls für die Rückkehr zum Leistungssport. Die Sportarten können in Bezug auf die Wirbelsäulenbelastung generell in vier Kategorien unterteilt werden:</p> <ul> <li>fördernde Sportarten (Laufen, Gehen, Skilanglaufen)</li> <li>indifferente Sportarten (Tanzen, Turnen, alpiner Skilauf);</li> <li>nicht fördernde Sportarten (Klettern, Golf, Tennis, Gymnastik);</li> <li>belastende Sportarten (Kampf-, Kontakt- und Kollisionssportarten).</li> </ul> <p><br /> Für bestimmte Verletzungen liegen Erfahrungswerte vor, die in der Literatur als Guideline empfohlen werden (Tab. 1). Dabei werden die Verletzungen in Anbetracht der Wahrscheinlichkeit einer Verschlechterung oder neuerlichen Verletzung bei Rückkehr zum Sport in drei Kategorien unterteilt:</p> <ul> <li>keine Kontraindikation und kein erhöhtes Risiko einer schweren Verletzung;</li> <li>absolute Kontraindikation und klar erhöhtes Risiko einer schweren Verletzung;</li> <li>relative Kontraindikation ohne klare Evidenz für schwere Verletzung</li> </ul> <p>Einige Verletzungen werden im Folgenden kurz besprochen.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Ortho_1704_Weblinks_s28_1.jpg" alt="" width="2151" height="2576" /></p> <h2>Armparese („stingers und burners“)</h2> <p>Transiente sensomotorische Defizite unterschiedlicher Schwere, von Parese bis Plegie, treten bei Kontaktsportarten wie Eishockey, Rugby, American Football und Kampfsportarten relativ häufig auf. Philip Huang et al berichten, dass ca. 70 % der Athleten im American Football innerhalb einer 4-Jahres-Karriere eine solche Episode erleben. Folgende Verletzungsmechanismen werden angenommen:</p> <ul> <li>Überdehnung des Plexus brachialis bei Seitneigung des Halses im Zusammenhang mit Sturz und Fall;</li> <li>Kompression der Nervenwurzel im Neuroforamen bei Hyperextension des Halses;</li> <li>direkter Schlag und Kompression des Plexus brachialis an der besonders exponierten Stelle am Erb’schen Punkt.</li> </ul> <p>Zum Ausschluss weiterer Ursachen, wie Fraktur, Luxation, Diskushernie, kongenitale Anomalien oder Stenosen, bedarf es einer genauen klinischen Untersuchung und bildgebender Diagnostik. Die Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr zum Sport nach diesen Verletzungen wird als relativ hoch berichtet. Wiederholtes Auftreten der Symptome wird als relative Kontraindikation angesehen.</p> <h2>Distorsion der Halswirbelsäule („cervical strains and sprains“)</h2> <p>Distorsionen der Halswirbelsäule bilden eine der häufigsten Beschwerdesymptomatiken. Bei klinischer Symptomfreiheit und nach Ausschluss einer Fraktur, Luxation oder schweren diskoligamentären Verletzung mittels bildgebender Diagnostik besteht keine Kontraindikation für eine Rückkehr zum Sport.</p> <h2>Stenose und Neurapraxie („cervical spine stenosis and cervical cord neurapraxia“)</h2> <p>Die zervikale Neurapraxie präsentiert sich als transiente Quadriparesis/Quadriplegie. Neben brennenden Parästhesien zeigen sich verschiedene Grade der Schwäche einzelner oder aller vier Extremitäten. Es sind anatomische Verhältnisse, die eine funktionelle Stenose begünstigen. Nativradiologisch kann die Torg-Ratio (das Längenverhältnis des Spinalkanals zum Wirbelkörper auf der seitlichen Röntgenaufnahme) Hinweise darauf liefern. Eine nachgewiesene funktionelle zervikale Spinalkanalstenose im MRT wird als Kontraindikation für Kontaktsport angesehen. Die Entscheidung für eine Rückkehr zum Sport nach einer HWS-Verletzung und Schädigung des Rückenmarks ist eine der kritischsten in der Sportmedizin.<br /> Tempel et al berichten in einer klinischen Studie über die hohe Wertigkeit der T2-Signalintensität im MRT zur Evaluation der Rückenmarksläsion bei professionellen Athleten. In 3 von 5 Fällen hat die Abnahme der T2-Signalintensität eine hohe Korrelation mit der Rückbildung der klinisch-neurologischen Symptomatik gezeigt.</p> <h2>Bandscheibenvorfall („cervical disk herniation“)</h2> <p>Die Inzidenz der asymptomatischen zervikalen Bandscheibenläsion ist bei Kontaktsportlern höher als in der Normalbevölkerung, stellt jedoch keine Kontraindikation für den Sport dar. Eine symptomatische Bandscheibenläsion wird bei Kontaktsport als hohes Risiko bewertet. Die Ergebnisse der chirurgischen Versorgung einer Bandscheibenläsion sind generell gut. Viele Studien haben gute Resultate nach einer 1-Etagen-Bandscheibenoperation gezeigt und die Sportler konnten wieder erfolgreich spielen. Eine 2-Etagen-Bandscheibenoperation nach geheilter Fusion wird als relative Kontraindikation angesehen. Eine Mehretagen-Bandscheibenoperation wird generell als höheres Risiko bewertet, die Rückkehr zum Sport jedoch relativ kontrovers diskutiert.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Ortho_1704_Weblinks_s28_2.jpg" alt="" width="1416" height="1509" /></p> <h2>Wirbelkörperfraktur und mehrsegmentale Fusionsoperation</h2> <p>Wirbelkörperfrakturen und Luxationsfrakturen sind aufgrund des komplexen Verletzungsmechanismus differenziert zu betrachten. Der Frakturtyp laut AO-Frakturklassifikation gibt ausreichend Information über die Stabilität der Läsion. Die Art der Operation und die Anzahl der fusionierten Segmente haben wesentlichen Einfluss auf die Stabilität und die Einschränkung des Bewegungsausmaßes der Wirbelsäule. Die Inzidenz schwerer Rückenmarkläsionen mit neurologischen Defiziten ist bei der Halswirbelfraktur relativ hoch. Die Rehabilitation und Reintegration der Patienten haben höchste Priorität. Die Wiederaufnahme der sportlichen Aktivität nimmt dabei einen besonderen Stellenwert ein.</p> <h2>Verletzungen der Brust- und Lendenwirbelsäule</h2> <p>Die Verletzungen im Bereich des zervikothorakalen Übergangs sind meistens instabil und erfordern eine langstreckige Instrumentierung. Die Brustwirbelsäule ist durch die Integration im knöchernen Thorax stabil und wenig beweglich. Das Ausmaß des Primärschadens und die Instabilität der Verletzung können mittels Frakturklassifikation ermittelt werden. Während stabile Frakturen konservativ behandelt werden, erfordern instabile Frakturen der BWS eine operative Versorgung. Die Ziele der Behandlung sind die Wiederherstellung des Alignments, die volle Belastbarkeit der Wirbelsäule und eine möglichst geringe Funktionsbeeinträchtigung. Der Einsatz moderner Operationstechniken und Implantate hilft, diesen Anforderungen Rechnung zu tragen und auch nach schwerer Wirbelsäulenverletzung in den meisten Fällen eine Rückkehr zur sportlichen Aktivität zu erreichen.</p> <h2>Zusammenfassung</h2> <p>Zur Sporttauglichkeit nach Wirbelsäulenverletzung besteht ein genereller Konsens darüber, dass vor dem Wiedereinstieg in den Leistungssport auf Wettkampfniveau wichtige Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Damit Folgeverletzungen vorgebeugt wird und der Sportler erfolgreich sein kann, haben Schmerzfreiheit, Freiheit von neurologischen Symptomen, vollständig freie Beweglichkeit und adäquater Kraftaufbau höchste Priorität.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>beim Verfasser</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Neueste Entwicklungen der spinalen EndoskopieNachhaltige keramische Knochenimplantate bald aus dem 3D-Drucker
Die endoskopische Wirbelsäulenchirurgie hat sich von einer rein perkutanen Technik zu einer hochpräzisen, technisch ausgereiften Methode entwickelt, die ein weites Spektrum degenerativer ...
Seltene Kleingefässvaskulitiden im Fokus
Bei Vaskulitiden der kleinen Gefässe liegt eine nekrotisierende Entzündung der Gefässwand von kleinen intraparenchymatösen Arterien, Arteriolen, Kapillaren und Venolen vor. Was gilt es ...
Elektive Hüft-TEP bei Adipositas Grad III
Übergewichtige Patient:innen leiden früher als normalgewichtige Personen an einer Hüft- oder Kniearthrose. Allerdings sieht die aktuelle S3-Leitlinie zur Behandlung der Coxarthrose in ...