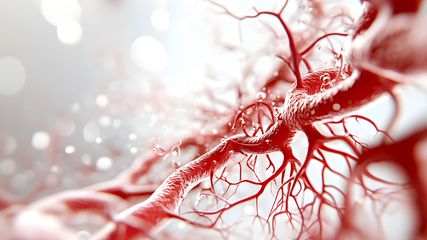<p class="article-intro">Bereits heute verzeichnen wir eine Zunahme des Durchschnittsalters bei Patienten mit Acetabulumfrakturen. Ein hoher Anteil dieser Patienten ist als geriatrisch einzustufen. Therapieentscheidungen bei alterstraumatologischen Patienten bedürfen einer besonders ausführlichen klinischen Evaluation und sollten eine schnelle Mobilisierung ermöglichen, um postoperative Komplikationen wie Pneumonie, Harnwegsinfekte und Dekubitus zu vermeiden. Die aktuelle Literatur bietet keine eindeutigen Behandlungs­empfeh­lungen für geriatrische Patienten mit Acetabulumfrakturen. Dieser Übersichts­artikel soll eine Entscheidungshilfe für die Indikationsstellung zur operativen Versorgung bieten. </p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Therapieziele bei älteren Patienten sind in erster Linie die schnelle Wiederherstellung der Gelenkfunktion durch eine stabile einzeitige operative Versorgung („single shot surgery“) und eine frühzeitige vollbelastende Mobilisierung. Eine frühzeitige Mobilisierung senkt das Risiko für postoperative Komplikationen sowie die Mortalität.</li> <li>Bei vorbestehender symptomatischer Coxarthrose, Trümmerfrakturen oder insbesondere bei Vorliegen eines sogenannten „gull sign“ sollte die primäre Totalendoprothese der Osteosynthese vorgezogen werden.</li> </ul> </div> <p>Die operative Behandlung geriatrischer Acetabulumfrakturen stellt Operateure vor besondere Herausforderungen. Obwohl die Inzidenz dieser Frakturen in den letzten Jahrzehnten stetig zugenommen hat, sind geriatrische Acetabulumfrakturen weiterhin eher selten und somit ist die Erfahrung des einzelnen Operateurs meist gering. Das operative Vorgehen ist von Erfahrung und Präferenz der einzelnen Operateure abhängig. Es mangelt vor allem auch an randomisierten kontrollierten Studien.</p> <h2>Epidemiologie und Ätiologie</h2> <p>In den letzten beiden Jahrzehnten zeigte sich eine steigende Inzidenz geriatrischer Acetabulumfrakturen. Ursache hierfür sind sowohl die steigende Lebenserwartung als auch das höhere Aktivitätslevel älterer Menschen. Der Altersgipfel lag 2005/06 bereits zwischen 60 und 70 Jahren und verschiedene Autoren fanden einen Anstieg geriatrischer Acetabulumfrakturen um 67 % zwischen 1998 und 2010. Dieser Trend wird sich in den nächsten Jahren voraussichtlich fortsetzen. Im Gegensatz zum jungen Patienten, welcher eine Acetabulumfraktur meist als Folge eines Hochrasanztraumas erleidet, ziehen sich im Alter die mehrheitlich weiblichen Patienten diese Fraktur typischerweise durch einen Sturz aus dem Stand zu. Meist handelt es sich dabei um isolierte Verletzungen des Acetabulums, welche oftmals mit einer ausgeprägten Osteoporose einhergehen. Infolge der Antetorsion des Schenkelhalses erfolgt die Kraftübertragung zumeist über den Trochanter major in Richtung des vorderen Pfeilers und der quadrilateralen Fläche.</p> <h2>Diagnostik</h2> <p><strong class="Zwischentitel-2">Klinische Untersuchung</strong></p> <p>Therapieentscheidungen hängen bei geriatrischen Patienten größtenteils von patientenbezogenen Faktoren ab. Über die Routineuntersuchungen hinaus müssen folgende Faktoren bei Acetabulumfrakturen unbedingt erfasst werden:</p> <ul> <li>sozialer Versorgungsstatus vor der Verletzung</li> <li>funktionelle Ansprüche</li> <li>Selbstversorgung bei Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL)</li> <li>medizinische Komorbiditäten</li> <li>kognitiver Status</li> <li>Knochenqualität</li> <li>Grad der Coxarthrose des betroffenen Gelenks</li> <li>zusätzliche Frakturen in Hinblick auf deren Einfluss auf die postoperative Mobilisierung</li> </ul> <p><strong class="Zwischentitel-2">Bildgebung</strong></p> <p>Die radiologischen Standardaufnahmen sind die Beckenübersicht, die Obturator- und die Ala-Aufnahme. Im Röntgen sollte besonders auf die Impaktierung des subchondralen Knochens im Bereich des superomedialen Acetabulumdoms geachtet werden. Das sog. „gull sign“ (Möwen-Zeichen) ist mit einer schlechten Prognose bei konservativer Therapie oder Osteosynthese assoziiert (Abb. 1).<br />Die Computertomografie gilt als Goldstandard. Die multiplanare Rekonstruktion ist für die Beurteilung des Frakturverlaufs und das Verständnis des Traumamechanismus von Bedeutung. Es lassen sich das Ausmaß der Trümmerzonen und die Impaktierung der Randareale und Belastungszonen des Acetabulums sowie des Femurkopfes beurteilen. Auch eine geringgradige Sub­luxation durch Medialisierung des Femurkopfes lässt sich gut erkennen. Eine zusätzliche 3D-Rekonstruktion ermöglicht ein besseres Verständnis von der Fraktur und der Lage der Frakturfragmente zueinander und kann bei der Planung des operativen Zugangs hilfreich sein. Durch die Subtraktion des Femurkopfes kann eine komplexe Konfiguration der Acetabulumfraktur aus allen Perspektiven eingesehen werden.</p> <p> <img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Ortho_1801_Weblinks_s25.jpg" alt="" /></p> <h2>Klassifikation</h2> <p>Die Klassifikation nach Letournel und Judet ist etabliert und stellt eine anatomische und radiologische Einteilung der Acetabulumfrakturen dar. Es wird zwischen Grundtypen und Kombinationsverletzungen unterschieden. Die 5 Grundtypen beschreiben Frakturen des hinteren bzw. des vorderen Pfeilers, der Hinter- und Vorderwand sowie einfache Querfrakturen. Die 5 Kombinationsverletzungen umfassen T-förmige Frakturen, Frakturen des hinteren Pfeilers und des hinteren Pfannenrandes, Querfrakturen mit Verletzung des hinteren Pfannenrandes, vordere Pfeilerfrakturen mit hinterem Hemiquerbruch sowie Zweipfeilerfrakturen.</p> <p><strong class="Zwischentitel-2">Die geriatrische Acetabulumfraktur</strong></p> <p>Die Inzidenz vorderer Pfeiler- und Wandfrakturen sowie die Kombination aus vorderer Pfeilerfraktur und hinterer Hemi­querfraktur sind bei älteren Patienten deutlich höher als bei jüngeren Patienten. Ursächlich dafür ist der unterschiedliche Unfallmechanismus mit vornehmlich gestreckter Hüfte zum Zeitpunkt des Traumas bei geriatrischen Patienten. Außerdem finden sich bei diesen Patienten häufiger Trümmerzonen, eine superomediale Domimpaktierung („gull sign“) sowie eine Impaktierung der Hinterwand und des Femurkopfes, welche allesamt mit einem schlechten Outcome nach konservativer Therapie oder osteosynthetischer Versorgung assoziiert sind.<br />Eine typische geriatrische Acetabulumfraktur ist die Fraktur des vorderen Pfeilers mit hinterer Hemiquerfraktur. Hier ist der vordere Pfeiler oft mehrfragmentär frakturiert, während die hintere Querfraktur einfach und häufig nicht disloziert ist. Die quadrilaterale Fläche steht in knöcherner Kontinuität mit dem hinteren Pfeiler. Aufgrund der medialen Protrusion des Femurkopfes rotiert der posteriore Pfeiler typischerweise nach innen („Open door“-Verletzung, Abb. 2).</p> <h2>Entscheidungsfindung</h2> <p><strong class="Zwischentitel-2">Prinzipien der Alterstraumatologie</strong></p> <p>Therapieziel ist in erster Linie die schnelle Wiederherstellung der Hüftgelenksfunktion durch eine belastungsstabile einzeitige operative Versorgung („single shot surgery“) mit frühzeitiger Mobilisierung. Dies steht bei geriatrischen Patienten gegenüber dem Erhalt des Hüftgelenks im Vordergrund. Zudem sollten lange Liegezeiten und Revisionsoperationen vermieden werden. <br />Relevant für die Versorgung sind neben dem Frakturtyp vor allem oben genannte patientenspezifische Faktoren. Ein orthogeriatrisches Komanagement ist obligat. <br />Ziel muss eine belastungsstabile Versorgung sein. Eine aktuelle Studie mit Patienten mit Hüftfrakturen zeigt, dass geriatrische Patienten eine postoperative Teilbelastung nicht durchführen können. Um eine frühzeitige Mobilisierung zu gewährleisten, muss die operative Versorgung somit eine postoperative Vollbelas­tung ermöglichen. <br />Die Zeit zwischen Trauma und operativem Eingriff sollte möglichst kurz sein. Die operative Behandlung geriatrischer Acetabulumfrakturen bedarf jedoch Erfahrung. Eine Verzögerung der operativen Behandlung kann daher gerechtfertigt sein, wenn kein erfahrener Chirurg zur Verfügung steht. Ein 3-in-1-Block kann hier eine gute Methode sein, um die Schmerzsituation bis zur operativen Versorgung zu verbessern.</p> <p><strong class="Zwischentitel-2">Konservative vs. operative Therapie</strong></p> <p>Bei der Versorgung geriatrischer Acetabulumfrakturen steht die Gelenkstabilität im Vordergrund. Eine Instabilität korreliert oft mit Schmerzen und Gangunfähigkeit. In unklaren Situationen, wie z.B. bei unverschobenen Frakturen, sollte zunächst eine Mobilisierung unter angemessener Analgesie erfolgen. Eine frustrane Mobilisierung mit starken Schmerzen indiziert in weiterer Folge eher eine operative Stabilisierung. Diese kann im Einzelfall auch durch eine navigierte minimal invasive Verschraubung erfolgen.<br />Für die Frakturstabilität sind insbesondere die Acetabulumpfeiler relevant. Während dislozierte Gelenkanteile bei jungen Patienten reponiert und operativ stabilisiert werden müssen, trifft dies für geriatrische Patienten möglicherweise nicht zu. Ein Versatz von einigen Millimetern kann toleriert werden, wenn der Femurkopf während der Belastung in der Hüftpfanne zentriert bleibt. Um eine zunehmende Dislokation unter konservativer Therapie frühzeitig zu erkennen, sind regelmäßige radiologische Nachuntersuchungen zwingend erforderlich. Eine Dislokation von nur wenigen Millimetern im Bereich der Pfeiler ist jedoch relevant und verursacht eine höhere Instabilität. Diese Frakturen erfordern typischerweise eine operative Behandlung. <br />Nicht dislozierte Pfeilerfrakturen sowie nicht dislozierte Querfrakturen können konservativ behandelt werden. Bei Frakturen mit Subluxation oder Luxation des Hüftgelenks ist in der Regel auch bei Patienten mit schlechtem Allgemeinzustand eine operative Behandlung indiziert. Die konservative Therapie instabiler Frakturen durch längere Bettruhe oder Extensionsbehandlung führt aufgrund der Immobilisierung zu schlechten funktionellen Ergebnissen und Komplikationen und sollte bei der Behandlung von geriatrischen Acetabulumfrakturen vermieden werden.</p> <p><strong class="Zwischentitel-2">Operative Versorgung</strong></p> <p>Die operative Versorgung sollte möglichst ohne zeitliche Verzögerung durch einen erfahrenen Operateur als „single shot surgery“ durchgeführt werden und muss eine belastungsstabile Situation schaffen.</p> <p>Osteosynthese<br />Hinsichtlich der Repositions- und Fixationstechniken unterscheidet sich die Osteosynthese bei geriatrischen Acetabulumfrakturen nicht wesentlich von der Versorgung jüngerer Patienten. Kombinierte und großflächige Zugänge sollten bei geriatrischen Patienten vermieden werden. <br />Durch die höhere Inzidenz von Frakturen des vorderen Pfeilers und der medialen Protrusion des Femurkopfes werden bei geriatrischen Patienten häufig vordere Zugänge gewählt. Der modifizierte Stoppa-Zugang als „intrapelvic approach“ ermöglicht eine direkte Reposition und Fixation der quadrilateralen Fläche, was für die Wiederherstellung der medialen Abstützfunktion der Pfanne entscheidend ist. Um hohe Pfeilerfrakturen und Frakturen des Beckenkamms zu stabilisieren, kann der Stoppa-Zugang mit einem Fenster des ilioinguinalen Zugangs (Olerud-Fenster) lateral ergänzt werden. Zur Stabilisierung eignen sich sowohl herkömmliche Beckenrekonstruktionsplatten als auch winkelstabile und anatomisch vorgeformte Platten, wobei Letztere eine höhere Primärstabilität aufweisen (Abb. 3).</p> <p>Endoprothese<br />Die primäre TEP-Implantation sollte in folgenden Fällen in Betracht gezogen werden:</p> <ul> <li>fragile Patienten mit eingeschränkter Mobilität</li> <li>Trümmerfrakturen</li> <li>Impressionen im Bereich der superomedialen Hüftgelenkspfanne („gull sign“)</li> <li>schwere Osteoporose</li> <li>vorbestehende Coxarthrose</li> <li>Frakturen, die eine umfangreiche Operation oder kombinierte Ansätze erfordern würden</li> <li>Acetabulumfrakturen nach Hemiprothese</li> <li>periprothetische Acetabulumfrakturen</li> </ul> <p>Die größte Herausforderung der primären Hüftendoprothetik ist die Fixierung der Pfanne im Bereich des frakturierten Acetabulums. Häufig kommen daher Revisionspfannen und Pfannendachschalen zum Einsatz. Jüngste Entwicklungen sind Verstärkungsringe mit Verriegelungsschrauben zur winkelstabilen Befestigung des Rings im supraacetabulären Knochen (Abb. 4). Der Vorteil hiervon ist, dass für eine stabile Verankerung dieser Implantate keine zusätzliche Osteosynthese benötigt wird. Die ersten Auswertungen einer aktuellen Fallstudie mit 30 Patienten zeigten vielversprechende Ergebnisse ohne implantatassoziierte Komplikationen.<br />Die knöcherne Kontinuität zwischen dem supraacetabulären Knochen und dem Iliosakralgelenk ist notwendig, um diese Verstärkungsringe ohne zusätzliche Osteosynthese der Acetabulumpfeiler implantieren zu können. Zweipfeilerfrakturen stellen somit in diesen Situationen eine Kontraindikation für die Hüftendoprothetik ohne zusätzliche Osteosynthese dar. <br />Diese Pfannenkomponenten werden den Einsatz der Endoprothese als Primärtherapie wohl erhöhen. Aktuelle Studien zur primären Hüftendoprothetik bei alterstraumatologischen Acetabulumfrakturen wurden bisher nur mit geringen Patientenzahlen durchgeführt. Es fehlen randomisiert prospektive Studien, das Evidenzlevel ist dementsprechend niedrig.</p> <p>Osteosynthese vs. Endoprothese<br />Um die Entscheidungsfindung zu erleichtern, wurde von Capone im April 2017 ein systematischer Review zur Versorgung alterstraumatologischer Acetabulumfrakturen publiziert. Hier wurden die Ergebnisse aus 15 Studien (13 retrospektiv, 2 prospektiv) ausgewertet. Es handelt sich bei allen eingeschlossenen Studien um Fallserien ohne Kontrollgruppe. Das mittlere Alter der Patienten betrug 71,6 Jahre. In 7 Studien erfolgte die Versorgung mittels Osteosynthese, in 5 Studien erhielten die Patienten eine Kombination aus Osteosynthese und Totalendoprothese und in 3 Studien wurde die alleinige Implantation der Endoprothese untersucht. <br />Im Harris-Hip-Score zeigte sich kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen. Für eine erfolgreiche Osteosynthese zeigte sich der Grad der Reposition entscheidend. Bei anatomischer Repo­sition erfolgte in 11,6 % der Fälle die sekundäre Implantation einer Total­endoprothese bei symptomatischer Cox­arthrose. Bei schlechterem Repositionsergebnis stieg die Reoperationsrate auf 22,3 % . Bei primärer TEP-Implantation zeigte sich eine im Vergleich geringe Revisionsrate von insgesamt 4,9 % . Luxationen und Lockerungen waren hier die führenden Revisionsursachen. Die perioperative Komplikationsraten waren mit 32 % bzw. 30 % vergleichbar. Insgesamt zeigten sich in der Gruppe der primären Endoprothesenimplantation kürzere Operationszeiten und eine geringere Mortalität. Allerdings muss man natürlich die Einschränkungen eines systematisierten Reviews in der Betrachtung der Ergebnisse beachten.</p> <h2>Fazit</h2> <p>Geriatrische Patienten mit dislozierter Acetabulumfraktur sollten ohne Zeitverlust mittels eines einzigen operativen Eingriffes versorgt werden. Postoperativ muss dabei eine Vollbelastung erlaubt werden, um eine rasche Mobilisation zu ermöglichen, da Patienten in dieser Altersgruppe eine Teilbelastung häufig nicht durchführen können. Ziele sind eine kurze Liegedauer und eine geringe postoperative Mortalität und Morbidität. <br />Es finden sich in der Literatur Hinweise, dass die primäre Implantation einer Totalendoprothese, ggf. in Kombination mit einer supraacetabulären Verankerung der Pfanne mit Schrauben und/oder einer zusätzlichen Verplattung eines Acetabulumpfeilers, bei der Versorgung geriatrischer Acetabulumfrakturen die Therapie erster Wahl darstellt. Bei vorbestehender symptomatischer Coxarthrose, Trümmerzonen oder bei Vorliegen einer superomedialen Domimpaktierung („gull sign“) sollte die Totalendoprothese der Osteosynthese auf jeden Fall vorgezogen werden. <br />Die aktuellen Erkenntnisse basieren vorwiegend auf der Erfahrung einzelner Operateure und auf Fallstudien mit geringer Patientenzahl. Prospektive oder auch randomisierte Studien sind durchzuführen, um einen klaren Behand­lungspfad mit höherer Evidenz zu erarbeiten.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>bei den Autoren</p>
</div>
</p>