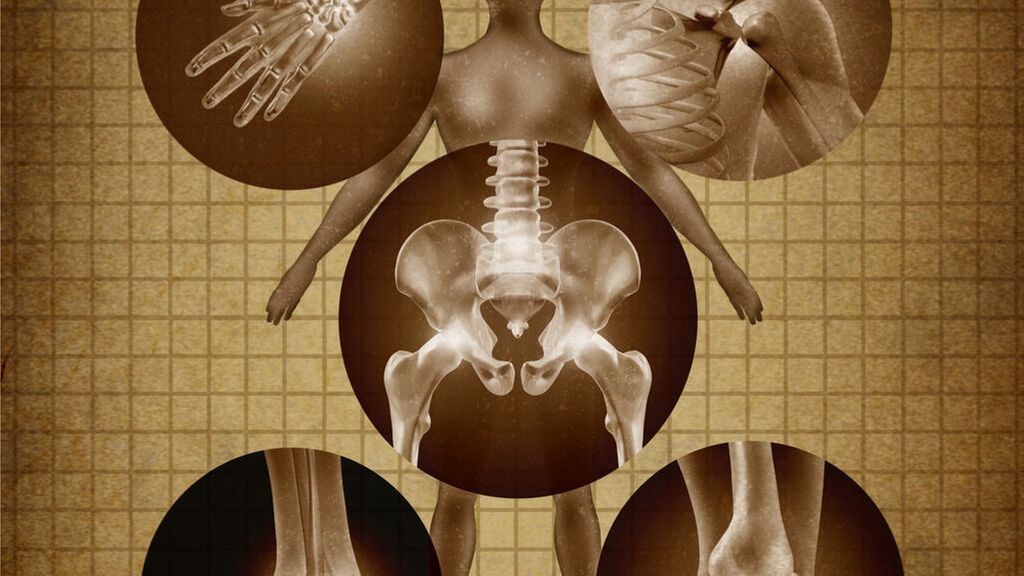
Minimal invasive Therapie von intraartikulären Fersenbeinfrakturen
Jatros
Autor:
Dr. Georg Mattiassich
Unfallkrankenhaus Linz<br>E-Mail:georg.mattiassich@auva.at
Autor:
Dr. Christian Rodemund
Unfallkrankenhaus Linz<br> E-Mail: christian.rodemund@auva.at
30
Min. Lesezeit
12.07.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Aufgrund der komplexen Anforderungen wird die Behandlung dieser Frakturen nach wie vor kontrovers diskutiert. Es zeigt sich aber ein deutlicher Trend zu minimal invasiven Verfahren, allerdings aktuell mit einer Unzahl verschiedener Methoden und Ansätze. Wir wollen Ihnen unser Konzept eines standardisierten Behandlungsalgorithmus vorstellen.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>MIS kann bei guter Technik vergleichbare anatomische Rekonstruktionsergebnisse bringen wie offene Verfahren.</li> <li>Es ist das ideale Verfahren bei komplexen Frakturen und kann praktisch ohne Alters­limit sowie bei Rauchern, Komorbidität und schlechten Weichteilverhältnissen eingesetzt werden.</li> <li>Bei Fersenbeinfrakturen ist eine Frühversorgung anzustreben, um weitere Schäden zu vermeiden.</li> </ul> </div> <p>Bei der Therapie intraartikulärer Fersenbeinfrakturen lassen sich grundsätzlich drei Behandlungskonzepte unterscheiden:</p> <h2 class="Zwischentitel-1">Konservative Therapie</h2> <p>Die konservative Therapie erfolgt meist ohne Reposition mit oder ohne Gipsruhigstellung, üblicherweise ohne Belastung für 6–12 Wochen. In der aktuellen Literatur wird die operative Therapie im Allgemeinen besser bewertet.</p> <h2 class="Zwischentitel-1">„Golden Standard“</h2> <p>Die operative Technik mit lateralem Zugang („extended lateral approach“) und Osteosynthese mit winkelstabiler Platte wird derzeit als „Golden Standard“ angesehen. Laut einer Abfragestudie an 250 deutschen Abteilungen wird dieses Verfahren zu 77 % angewandt. Vorteile sind die gute Sicht auf die Fraktursituation und die direkte Manipulationsmöglichkeit der Fragmente. Die Operation ist gut standardisiert und es gibt eine ausführliche wissenschaftliche Literatur. Nachteilig ist die verfahrensbedingte hohe Rate an Wundkomplikationen von 5–25 % . Um diese zu verringern, wird die Operation nach Abschwellung, meist erst nach 7–21 Tagen durchgeführt. Häufig sehen wir dabei eine typische Blasenbildung, die bei frühzeitiger Entlastung und Stabilisierung nicht auftritt. Sie ist Folge des anhaltenden inneren Gewebsdruckes (Hämatom, Frakturfehlstellung) und nicht des primären Traumas. Eine anatomische Reposition ist auch bei offenen Verfahren nicht immer zu erreichen, insbesondere bei Trümmerfrakturen. Die Stabilität der Platte ist gegenüber zentralen Kraftträgern laut neueren Studien geringer. Wird eine sekundäre Arthrodese im Subtalargelenk erforderlich, ist bei klassischer Plattenosteosynthese meist eine komplette Material­entfernung erforderlich, die wiederum mit erhöhter Weichteilproblematik verbunden ist und kleine Standardzugänge (Ollier, dorso-lateral, …) verhindert.</p> <h2 class="Zwischentitel-1">Minimal invasive Verfahren</h2> <p>Es gibt viele unterschiedliche minimal invasive Verfahren zur Versorgung der Fersenbeinfraktur. Sie unterscheiden sich in Indikationsstellung, Lagerung, Bildgebung, Zugangsweg, Repositionstechnik, Implantatwahl sowie den postoperativen Ruhigstellungs- und Entlastungszeiten. Für uns war es ein wichtiges Ziel, alle diese Fragen in einem einheitlichen Behandlungsalgorithmus zu standardisieren.</p> <h2 class="Zwischentitel-1">Konzept und Technik im UKH Linz</h2> <p>Für unser Konzept ist ein möglichst früher Operationszeitpunkt (in den ersten 3 Tagen) wesentlich. Aufgrund der spongiösen Struktur kommt es bei Fersenbeinfrakturen sehr schnell zu Verklebungen innerhalb der Fragmente. Dadurch wird die freie Mobilisierung im gedeckten Verfahren technisch schwieriger und sie ist stärker traumatisierend. Die frühzeitige Entlastung der Weichteile durch Häma­tomentleerung, Herstellung der Anatomie und Stabilität im Frakturbereich führt zur Besserung der Schmerzsituation und verhindert Spannungsblasen. Sie ist ein wesentlicher Faktor zur Verminderung sekundärer muskulärer Schäden (posttraumatische Krallenzehen etc. bis hin zum manifesten Kompartmentsyndrom).</p> <p>Das Verfahren ist weichteilschonend ohne wesentliche Deperiostierung der Fragmente und führt damit zu weniger postoperativen Adhäsionen. Das Risiko für Wundheilungsstörungen und Infektionen ist erwartungsgemäß wesentlich geringer. Die Repositionsergebnisse sind bei entsprechender Technik vergleichbar. In fast allen Fällen ist eine frühe Übungsstabilität erreichbar. Bei entsprechender Routine und Vorbereitung sind kürzere OP-Zeiten möglich. Die Kosten des Osteosynthesematerials sind im Vergleich zur Plattenosteosynthese deutlich geringer. Eine Materialentfernung ist problemlos und oft auch in Lokalanästhesie über ­Stichinzisionen möglich.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Ortho_1804_Weblinks_s36_1.jpg" alt="" width="2149" height="503" /></p> <p>Ein Nachteil ist natürlich, dass keine optische Visualisierung der Fraktur und speziell des Subtalargelenkes besteht – außer bei zusätzlicher subtalarer Arthroskopie oder „Mini-open“-Zugang (z. B. Sinus tarsi). Die Beurteilung der Fragmentlage und des Repositionsergebnisses erfordert Erfahrung und ist intraoperativ oft schwierig. Es kommt dadurch auch zu deutlich erhöhten Bestrahlungszeiten. Für unsere Technik mit Extensionsgerät gibt es am Markt leider noch keine Weiter- oder Neuentwicklung des von uns verwendeten Distraktionsgerätes von Prof. Dr. Fröhlich. Ein von uns neu entwickeltes Tool wird zurzeit patentiert. Ein spezielles Problem ist auch die sogenannte „Lernkurve“. Intraartikuläre Fersenbeinfrakturen sind insgesamt selten und Techniken mit gedeckter Reposition von Mehrfragmentfrakturen werden aktuell im Wesentlichen nur in diesem Bereich durchgeführt. Die präoperative Vorbereitungszeit zur Frakturbeurteilung und Planung des Repositionsverfahrens und der Osteosynthesemethode ist aufwendiger und bei geringer Erfahrung ist es oft unklar, welches Ergebnis erzielbar ist.</p> <p>Insgesamt stellt die Technik sicher höhere Anforderung an den Chirurgen. International gibt es noch keine Standards und folglich mangelhafte wissenschaftliche Auswertungen sowie keine Evidenz.</p> <h2 class="Zwischentitel-1">Indikation und Kontraindikation</h2> <p>Als Indikation erachten wir praktisch alle intraartikulären Fersenbeinfrakturen. Wir finden es sinnvoll, auch unverschobene oder minimal dislozierte Frakturen mit einem fast risikofreien Verfahren unter Regionalanästhesie übungsstabil zu stabilisieren und frühfunktionell ohne äußere Fixierung zu behandeln. Eine spezielle Indikation sehen wir aber vor allem bei Trümmerfrakturen. Neben der schon erwähnten Druckentlastung sind die Korrektur der Achsenabweichung, Verbreiterung und Verkürzung sowie häufig die Korrektur eines Impingements im oberen Sprunggelenk (calcaneofibuläres Abutment) und eines Talustilts operativ erforderlich. Kontraindikation gibt es im Vergleich zu offenen Verfahren nur sehr wenige. Wir sehen kein Alterslimit, Raucher und Patienten mit internistischen Vorerkrankungen können gut und risikoarm behandelt werden. Die operative Versorgung ist auch bei stärkerer Weichteilschwellung durchführbar.</p> <h2 class="Zwischentitel-1">Frakturgruppen und Methoden</h2> <p>Wir unterscheiden speziell im Hinblick auf die Repositionstechnik aktuell vier verschiedene Gruppen von intraartikulären Fersenbeinfrakturen. Als Entscheidungshilfe dient hier vor allem die Einteilung nach Essex-Lopresti. Sie ist einfach zu beurteilen und hat eine gute Korrelation zum Outcome.</p> <p><strong><strong>„Tongue-type fracture“</strong></strong></p> <p>Hier finden wir ein zusammenhängendes Tuber-Gelenksfragment, meist nur geringe Verkürzung und Varisierung. Eine Reposition in der Technik nach Westhues lässt sich meist gut und problemlos durchführen.</p> <p><strong><strong>„Depression-type fracture“</strong></strong></p> <p>Hierbei zeigt sich ein Bruch zwischen dem Tuber-Fragment und den zentralen Gelenksfragmenten. Fast immer ist dies mit stärkerer Verkürzung und Varisierung verbunden, häufig mit Ausbruch der lateralen Wand, oft mit Impingement in das obere Sprunggelenk. Hier besteht eine klassische Indikation für die Extensionstechnik.</p> <p><strong><strong>Trümmerfrakturen </strong></strong></p> <p>Als Folge eines typischen Verletzungsmechanismus, meist im Sinne eines Depression-Typs mit regelhaften multiplen Frakturteilen vor allem im Subtalarbereich, stellen Trümmerfrakturen für uns definitiv eine Indikation für die minimal invasive Technik mit dem Extensionsgerät dar. Man kann in der Regel eine Korrektur von Länge, Achse, Verbreiterung und Höhe erreichen sowie eine Stabilisierung der Hauptfragmente gewährleisten. Die Vorteile durch die Entlastung und Stabilisierung überwiegen deutlich das Operationsrisiko.</p> <p><strong><strong>Atypische Frakturen </strong></strong></p> <p>Frakturformen, die nicht dem üblichen regelhaften Verletzungsmuster entsprechen, entstehen häufig nach Direkttrauma, vor allem nach Überrollverletzungen. Meist gelingt hier die Therapie mit Standardrepositionsverfahren und Verschraubung, eventuell aber auch situationsbedingt mit alternativen Osteosyntheseformen (Fixateur externe, Platte, …).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Ortho_1804_Weblinks_s36_2.jpg" alt="" width="2149" height="503" /></p> <h2 class="Zwischentitel-1">Instrumentarium – Osteosynthese</h2> <p>Wir verwenden das Extensionsgerät der Marke I.T.S. nach P. Fröhlich mit 2x3mm-Kirschnerdrähten, kanülierte 7,3mm-Schrauben und kanülierte 4,0mm-Schrauben zur Fixierung der Gelenksfragmente (Sustentaculumschrauben) und kleinerer Fragmente, z.B. am Processus anterius calcanei, und eventuell Bohrdrähte verschiedener Stärke für kleinere Fragmente oder bei „Joy-Stick“-Anwendungen. Für die Reposition verwenden wir Rasparatorien, Ahle, Elevator, Stößel etc.</p> <h2 class="Zwischentitel-1">Anästhesie</h2> <p>Die Operation ist sowohl in Regionalanästhesie als auch in Allgemeinnarkoseverfahren möglich. Blutsperre wird keine verwendet. Eventuell empfiehlt sich postoperativ ein Schmerzkatheter.</p> <h2 class="Zwischentitel-1">Lagerung</h2> <p>Eine stabile Lagerung mit optimalem Zugang zum Fuß und standardisierter Bildwandlerposition ist Voraussetzung für den Erfolg der Operation. Der Patient liegt in Seitenlage, das verletzte Bein ist auf einem Beinhalter (z.B. Gyn-Stütze) gelagert. Die freie Lagerung ist für die Montage des Extensionsapparates unbedingt erforderlich, zusätzlich ist damit auch die Visualisierung im Bildwandler wesentlich verbessert. Der C-Arm muss völlig frei 360° um den Fuß gedreht werden können. Es wird dringend empfohlen, die Lagerungstechnik mit dem eigenen Equipment und dem OP- und Röntgenpersonal festzulegen, zu üben und zu dokumentieren, bevor der erste Patient operiert wird.</p> <h2 class="Zwischentitel-1">Bildgebung</h2> <p>Der zweite wesentliche Punkt ist die Bildgebung, vor allem weil es sich um ein gedecktes Verfahren handelt. Es ist wichtig, dass der Operateur selbst die Einstelltechnik genau kennt und dem Röntgenassistenten exakte Anweisung geben kann. Wir benötigen drei Einstellungen: eine seitliche, die Broden- und eine axiale Ansicht. Der Bildwandler wird genau in der Achse der Fußsohle positioniert, der Fuß liegt streng horizontal. Die drei Einstellungen werden präoperativ festgelegt und eventuell markiert. Es sind intraoperativ nur mehr drei Anweisungen für die immer gleichen Ansichten erforderlich. Bevor dies nicht eindeutig zufriedenstellend funktioniert, sollte man die Operation nicht beginnen.</p> <p> </p> <p><strong><strong>Seitliche Ansicht</strong></strong></p> <p>Wichtig ist, dass man sich ausschließlich auf die tibiale Talusgelenksfläche konzentriert. Das eventuell verformte Fersenbein ist dabei völlig außer Acht zu lassen, da es für die korrekte Einstellung keine Information liefert.</p> <p><strong><strong>Axiale Ansicht</strong></strong></p> <p>Wir schwenken den C-Arm in die horizontale Position. Unter manueller Dorsalflexion des Fußes können wir nun die Achse des Fersenbeins beurteilen. Diese Ansicht ist für die spätere Positionierung des Pins unbedingt erforderlich.</p> <p><strong><strong>Broden View</strong></strong></p> <p>Zur Beurteilung des Subtalargelenkes und der posterioren Gelenksfacetten ist eine Broden-Einstellung erforderlich. Wenn man einen isozentrischen Bildwandler verwenden kann, braucht man aus der bisherigen Einstellung den C-Arm nur in eine 45°-Neigung zu bringen. Bei Standardbildwandlern ist leider eine Höhenanpassung erforderlich. Achtung: Durch die Rundung des Talus kann es bei „rotiertem“ Frakturfragment bei bestimmten Einstellungen zum Eindruck einer anatomischen Reposition kommen. Es ist deshalb zur endgültigen Repositionskontrolle oft notwendig, in Neigungen zwischen 35° und 55° zu kontrollieren.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Ortho_1804_Weblinks_s36_3.jpg" alt="" width="2150" height="636" /></p> <h2 class="Zwischentitel-1">Reposition der Länge und Achse</h2> <p>Beim Depression-Type und bei Trümmerfrakturen bestehen immer eine ausgeprägte Varisierung und Verkürzung. Diese kann gedeckt ohne Hilfsmittel nicht korrigiert und gehalten werden. Mit dem Extensionsapparat kann die Achsen- und Längenkorrektur durchgeführt werden, es wird Platz für die Reposition der zentralen Gelenksfragmente geschaffen und die Fragmente werden für die anschließende Verschraubung stabil gehalten. Die korrekte Positionierung der Pins ist absolut erforderlich. Der erste wird im Talushals genau frontal und horizontal eingebracht. Der zweite soll sich im dorsalen, plantaren Tuber-Bereich des Fersenbeins befinden. Nach Festlegen des Eintrittpunktes in der lateralen Ansicht ist es unbedingt erforderlich, den C-Bogen in die axiale Ansicht zu bringen, um die Achse des varisch verkippten Tuber-Fragmentes zu bestimmen. Der Pin muss genau 90° dazu eingebracht werden. Damit zeigt sich anschließend eine deutliche Konvergenz der Pins medialseitig. Gelingt dies nicht, ist mit einem achsenstarren 2-Punkt-Distraktor eine anatomische Reposition nicht möglich. Nach manueller Korrektur des Varus können nun der mediale Bügel und danach der laterale montiert werden. Die Extension erfolgt abwechselnd medial und lateral, unter Kontrolle in der lateralen und vor allem axialen Bildwandleransicht bis zum völligen Ausgleich der Verkürzung. Dies erfordert häufig einen erheblichen Zug, wie man oft an der Biegung der Bohrdrähte erkennen kann. Obwohl wir nur einen 2-Punkt-Distraktor verwenden, kommt es durch die ligamentären Strukturen, vor allem die der Plantarfaszie, zu einem Aufrichten des Längsgewölbes, zur Korrektur des Böhlerwinkels.</p> <h2 class="Zwischentitel-1">Reposition der zentralen Gelenksfragmente</h2> <p>Bei Depression-Typ-Frakturen kommt es in den meisten Fällen zu einem Ausbruch der lateralen Wand und einem oder mehreren zentralen Gelenksfragmenten. Es bietet sich deshalb ein Repositionszugang im lateralen Frakturspalt an. Alternativ kann man auch von plantar nach einer Bohrung mit einem Stößel reponieren. Dies ist aber von der Orientierung meist schwieriger. Die laterale Inzision ist möglichst klein zu halten und dann stumpf zum Calcaneus zu präparieren, um nicht die Peroneussehnen bzw. das Gefäß/Nervenbündel zu verletzen. Wichtig sind eine genügende Varuskorrektur und Extension. Ansonst können die zentralen Gelenksfragmente aus Platzmangel nicht anatomisch reponiert werden.</p> <h2 class="Zwischentitel-1">Sustentaculumschraube</h2> <p>Aufgrund des üblichen Frakturmechanismus, der knöchernen Stabilität, der Lage und der starken ligamentären Verbindung bleibt das Sustentaculum tali in fast allen Fällen in anatomischer Position, wenngleich auch öfter Querfrakturen zu sehen sind. Es bietet sich deshalb als Fixationspunkt für die dislozierten posterolateralen und zentralen Gelenksfragmente sowie eine evtl. ausgebrochene laterale Wand an. Für diese Osteosynthese ist die sogenannte Sustentaculumschraube in der Literatur schon mehrfach beschrieben worden. Sie ist allerdings aufgrund der anatomischen Gegebenheiten und der schwierigen Darstellung im Bildwandler oft nicht einfach zu platzieren. Wir empfehlen, immer eine eigene Stichinzision zu verwenden, da der laterale Zugang für die Reposition nicht geeignet ist und eine Schnittverlängerung mehr Risiko zeigt als eine neue Inzision. Die Schraube wird bei entsprechender Fraktursituation von lateral dorsal nach medial ventral platziert. Der Eintrittspunkt ist unter und dorsal der Außenknöchelspitze, Ziel ist das Sustentaculum knapp unterhalb der Innenknöchelspitze. Bei guter Lage kann der Bohrdraht problemlos medial perforieren, um ihn dann für die Bohrung des Schraubkanals mit einer Klemme zu fixieren. Die Beurteilung der Schraubenlänge im Bildwandler ist schwierig, sie misst meist um die 40mm. Bei Bedarf kann natürlich eine zweite Schraube positioniert werden. Bei schmalen osteochondralen Fragmenten muss man eventuell auf Bohrdrähte ausweichen. Bei Querfrakturen des Sustentaculums ist natürlich darauf zu achten, nicht in den Frakturspalt zu platzieren. Die Lagekontrolle ist in allen drei Bildwandleransichten unbedingt erforderlich. Wir verwenden eine kanülierte 4,0mm-Zugschraube, bei idealer Lage lässt sich eine gute Kompression des Frakturspaltes in der Broden-Aufnahme darstellen.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Ortho_1804_Weblinks_s36_4.jpg" alt="" width="1417" height="2476" /></p> <h2 class="Zwischentitel-1">Statische Fixierung mit 7,3mm-Schrauben</h2> <p>Achse, Länge und auch die Höhe stabilisieren wir mit zwei 7,3mm messenden Bohrdrahtschrauben mit durchgehendem Gewinde. In der Literatur sieht man sehr unterschiedliche Schraubenlagen, meist aber eher plantar liegend oder auch schräg von dorsal-plantar Richtung Subtalargelenk. Aufgrund unserer Erfahrungen in den letzten 10 Jahren positionieren wir die Schrauben parallel von dorsal-kranial nach distal-plantar. Durch den Eintrittspunkt oberhalb bzw. am oberen Rand des Achillessehnenansatzes sehen wir deutlich weniger lokale Weichteilprobleme, der Schraubenkopf wird versenkt. Die Schrauben können sich dorsal gut über der darunterliegenden verstärkten Kortikalis abstützen und sollen „dachbalkenartig“ die zentralen Gelenksfragmente von unten unterstützen. Dies ist vor allem auch in jenen Fällen wichtig, bei denen durch die traumatische Kompression der zentralen Spongiosa und der darauffolgenden Aufrichtung ein Knochendefekt entstanden ist. Spongiosa oder Knochenersatzstoffe verwenden wir nicht, sie werden auch in der Literatur vornehmlich nicht mehr empfohlen. Wesentlich ist die Verwendung von Schrauben mit durchgehendem Gewinde, da wir ja keine Kompression, sondern ein Halten der Fersenbeinlänge und -achse im Sinne einer Stellschraube erzielen wollen.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Ortho_1804_Weblinks_s36_5.jpg" alt="" width="1417" height="1587" /></p> <h2 class="Zwischentitel-1">Nachbehandlung</h2> <p>Grundsätzlich erachten wir die Osteosynthese als übungsstabil. Sollte von der Erstversorgung ein gespaltener Gips vorhanden sein, wird er meist als Lagerungsschiene für die ersten Tage verwendet. Wir verwenden keine Drainagen, allerdings führen wir einen sehr lockeren Verschluss der Inzisionen durch.</p> <p>Eine frühzeitige Physiotherapie ist ein ganz wesentlicher Faktor. Auch wenn es aufgrund der komplexen Fragestellung mit verschiedensten Frakturvarianten und Versorgungsstrategien keinen wissenschaftlichen Nachweis gibt, sehen wir eindeutig positive Effekte hinsichtlich Schwellung, Beweglichkeit und vor allem auch auf die posttraumatischen Entkalkungsvorgänge an den angrenzenden Knochen. Wir bewerten auch die Effekte auf die verletzten Knorpelareale durch kontrollierte geführte Bewegung ohne Belastungsspitzen als positiv. Entlastung wurde früher für 12 Wochen durchgeführt, bei stabiler Versorgung erachten wir das Fersenbein aber nach 6 Wochen als knöchern fest. Nach dieser Zeit verordnen wir meist einen Fersenbeinentlastungsschuh oder beginnen mit Teilbelastung. <span class="Artikelende" style="font-size: 1em;" xml:lang="de-DE">n</span></p> <p>Eine ausführliche Konzeptbeschreibung mit Video finden Sie auf www.vumedi.com unter „calcaneus fractures“.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>bei den Verfassern</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Periphere Nervenkompressionssyndrome der oberen Extremität
Periphere Nervenkompressionssysteme der oberen Extremitäten sind verhältnismäßig häufig, insbesondere der Nervus medianus und der Nervus ulnaris sind oft im Bereich des Hand- bzw. ...
Konservative Behandlungsmöglichkeiten bei peripheren Nervenläsionen
Eine periphere Nervenläsion erfordert nicht nur eine Dekompression, Naht oder Rekonstruktion. Um Gelenke beweglich zu erhalten, eine Atrophie der Muskulatur zu verhindern und die ...
Bildgebende Diagnostik des peripheren Nervensystems
Die komplexen Nerventopografien machen die Nervenbildgebung zu einer fordernden Aufgabe, die allerdings eine wichtige Rolle dabei spielt, eine funktionelle Wiederherstellung der ...


