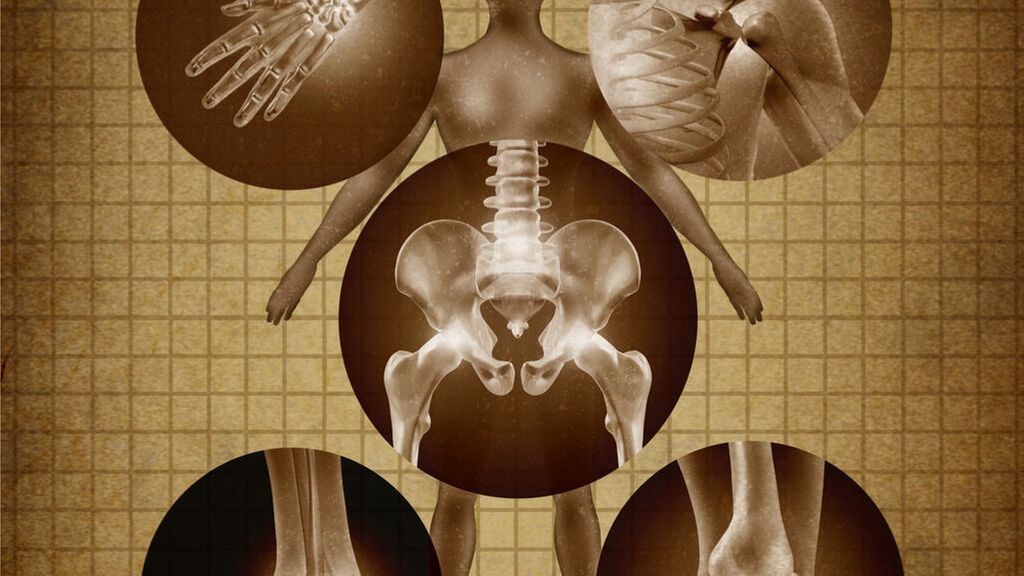
Management osteoporotischer Frakturen: How we do it
Jatros
Autor:
Evelyn Kungler
Department Orthopädie und Traumatologie, Universitätsspital Basel
Autor:
Sebastian Müller
Korrespondierender Autor<br> Department Orthopädie und Traumatologie, Universitätsspital Basel<br> E-Mail: s.mueller@usb.ch
30
Min. Lesezeit
07.07.2016
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Osteoporotische Frakturen stellen uns im Hinblick auf die alternde Gesellschaft vor immer größere Herausforderungen: Es bedarf eines optimierten Managements, um einerseits die höchst heterogenen Patienten bedarfsgerecht zu behandeln, ohne andererseits das Gesundheitssystem zu überfordern. In Basel betreiben wir seit einigen Jahren mit Erfolg ein interdisziplinäres Altersfrakturenzentrum, in dem wir unsere geriatrischen Patienten mittels eines individualisierten Therapieansatzes bestmöglich versorgen. Dies beinhaltet neben einer optimierten Primärversorgung auch die Sicherstellung der Sekundärprävention, um die Behandlungsziele (Erhalt der Wohnsituation sowie des Funktionszustandes vor der Fraktur) nachhaltig erreichen zu können.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Key Points</h2> <ul> <li>Ein spezialisiertes Altersfrakturenzentrum verbessert nachhaltig die Resultate der Behandlung osteoporotischer Frakturen: Wir konnten bereits zeigen, dass sowohl Komplikationen während der Hospitalisation als auch die Gesamthospitalisationszeit signifikant reduziert wurden.<sup>8</sup></li> <li>Dabei ist insbesondere der interdisziplinäre Therapieansatz entscheidend: Nur durch die Hand-in-Hand-Zusammenarbeit von Spezialisten verschiedener Disziplinen gelingt es, die heterogenen geriatrischen Patienten bedürfnisgerecht zu behandeln und somit ihre Behandlungsresultate zu optimieren.</li> <li>Unsere etablierten Behandlungsalgorithmen erfüllen in diesem Kontext die Kriterien eines Modells „D“ im Hinblick auf die Klassifikation von orthogeriatrischen Behandlungsmodellen nach Pioli et al.<sup>14</sup></li> <li>Ergänzt wird die Primärversorgung durch die Sicherstellung einer nachhaltigen Sekundärprävention, welche durch einen Fracture Liaison Service gewährleistet wird.</li> </ul> </div> <p>Angesichts des demografischen Wandels bestimmen osteoporotische Frakturen geriatrischer Patienten zunehmend unseren klinischen Alltag. Das Erleiden einer osteoporotischen Fraktur nach einem Bagatelltrauma stellt oftmals einen gravierenden Einschnitt im Leben der betagten Patienten dar, da sie nunmehr Gefahr laufen, ihre bisherige Lebensführung aufgeben zumüssen und Eigenständigkeit zu verlieren. Dies gilt im Besonderen für hüftgelenknahe Frakturen, die ca. 50 % aller osteoporotischen Frakturen ausmachen,<sup>1</sup> weshalb wir uns im Folgenden auf diese Entität konzentrieren.<br /> Patienten mit Hüftfrakturen weisen eine hohe Inzidenz an Morbidität und, je nach Literatur, eine 12-Monats-Mortalität von 25–36 % auf.<sup>2–5</sup> Daneben erfahren diese Patienten durch die Folgen der Fraktur oft einen signifikanten Verlust der präoperativen Funktionalität und Selbstständigkeit. So ist bekannt, dass bis zu 40 % nach einem Jahr nicht mehr in der Lage sind, ohne Gehhilfen zu gehen.<sup>6</sup> Weiterhin ist rund ein Drittel der zuvor selbstversorgenden Patienten im Anschluss an den Spitalaufenthalt auf permanente personelle Hilfe angewiesen.<sup>7</sup> Diese (unliebsame) Realität steht jedoch oft im Kontrast zu der teilweise hohen Erwartungshaltung der Patienten und der Angehörigen, die mit einer Rückkehr ins häusliche Umfeld sowie mit der Wiederherstellung einer Funktionalität wie vor dem Trauma rechnen.</p> <h2>Standardtherapien werden den Bedürfnissen geriatrischer Patienten unzureichend gerecht</h2> <p>Eine Ursache, dafür dass sich der tatsächliche Verlauf mitunter doch deutlich von diesem Wunschdenken unterscheidet und die Ergebnisse der Behandlung der Patienten mit osteoporotischen Frakturen oftmals unbefriedigend sind, liegt in der Heterogenität der Patienten: Geriatrische Patienten unterscheiden sich untereinander signifikant, z.B. im Hinblick auf die begleitenden Komorbiditäten, die kognitiven Leistungsfähigkeiten, den Ernährungszustand oder das Funktionslevel vor dem Trauma. Alle diese Faktoren können unabhängig voneinander eine entscheidende Rolle im Hinblick auf das Behandlungsresultat spielen. Es ist daher leicht nachvollziehbar, dass die bislang angewandte „Standardtherapie für alle Patienten“ (OP, einheitliche Standardbetreuung auf der Abteilung, Entlassung nach Hause, in die Reha oder ins Pflegeheim) den mannigfaltigen Bedürfnissen der Patienten schlichtweg nicht gerecht werden kann.<br /> Um dieses Problem an der Wurzel anzugehen, haben wir in Basel bereits im Jahr 2008 ein Altersfrakturenzentrum eingerichtet, in dem wir unseren geriatrischen Patienten eine bedarfsgerechte und individualisierte Behandlung anbieten können. Der Schlüssel zum Erfolg liegt dabei in der interdisziplinären Beurteilung und Behandlung unserer Patienten: Nur durch ein eingespieltes Team aus Vertretern verschiedener Disziplinen (Orthopäde/Unfallchirurg, Internist, Pflegeexperten und je nach Bedarf Geriater und Endokrinologe) kann eine nachhaltige und optimierte Versorgung der geriatrischen Patienten erreicht werden. Davon profitieren natürlich zunächst einmal die Patienten, sekundär jedoch auch die Allgemeinheit und das Gesundheitssystem, da eine bedarfsgerechte Therapie in einem kürzeren Spitalsaufenthalt und weniger Komplikationen resultiert.<sup>8</sup><br /> Der Grundstein unseres Altersfrakturenzentrums und der Optimierung der Behandlung von Patienten mit osteoporotischen Frakturen wurde bereits im Jahr 2006 im Rahmen des „Osteocare“-Projektes gelegt. In den folgenden Jahren wurden unsere Behandlungsalgorithmen ausgebaut, erweitert und angepasst. Dazu gehört selbstverständlich auch die Sicherstellung einer adäquaten Osteoporose-Sekundärprophylaxe (sofern indiziert). Seit Juni 2013 betreiben wir daher den Fracture Liaison Service Basel (FLS) als Kooperation des Universitätsspitals Basel mit einer endokrinologischen Schwerpunktpraxis mit Labor (ENDONET). Seit 2014 nehmen wir am Programm „Capture The Fracture“ der IOF teil. Unsere Leistungen auf diesem Gebiet wurden zu Beginn mit dem „Silver Star“ und seit Ende 2015 mit dem „Gold Star“ bewertet. Auf den folgenden Seiten möchten wir unser Konzept des „Managements osteoporotischer Frakturen“ vorstellen.</p> <h2>Von der Notfallstation bis zur Operation</h2> <p>Die zentrale Erstaufnahme aller Patienten mit osteoporotischen Frakturen erfolgt in unserem Notfallzentrum. Nach klinisch und radiologisch komplettierter Diagnostik erfolgt bereits hier eine erste Identifikation jener Patienten, die sich für die weitere spezialisierte orthogeriatrische Behandlung in unserem Altersfrakturenzentrum qualifizieren (Alter über 65 Jahre; nicht berücksichtigt werden Patienten mit Frakturen nach adäquatem Trauma, z.B. Verkehrsunfall, oder mit pathologischen Frakturen). Anschließend wird bereits präoperativ ein erster direkter und individueller Kontakt mit dem Patienten aufgenommen. Im Rahmen dessen wird auch eine interdisziplinäre Evaluation des präoperativen Status des Patienten hinsichtlich des kognitiven Status, des Ernährungs- und Funktionszustandes sowie der Mobilität durchgeführt (siehe Abb. 1). Auch werden schon präoperativ präventive Maßnahmen ergriffen, um bekannte und häufige Komplikationen bei geriatrischen Patienten (Delirium, Malnutrition, Thrombose) möglichst gar nicht erst entstehen zu lassen. Darunter fallen beispielsweise die möglichst frühzeitige Implementierung einer adäquaten Analgesie (Meiden von Opiaten, Anlage von Schmerzkathetern durch die Anästhesie), das Screening nach Triggermedikamenten, welche ein Delir begünstigen könnten (Antipsychotika, Anticholinergika) sowie – falls erforderlich – die Verordnung einer medikamentösen Prophylaxe.<br /> Weiterhin streben wir eine möglichst kurze Zeitspanne bis zur Operation an (Ziel <24h). Falls dies im Kliniksetting aufgrund weiterer Notfälle nicht möglich sein sollte, versuchen wir zumindest, die Nüchternphasen der Patienten möglichst kurz zu halten. Nach präoperativer Beurteilung und Freigabe der Patienten durch die Anästhesie erfolgt dann der operative Eingriff – am Beispiel der Hüftfrakturen bei pertrochantären Frakturen in der Regel mittels Marknagelosteosynthese und bei Schenkelhalsfrakturen mittels Endoprothese respektive Totalprothese (zementiert oder unzementiert). Das Behandlungsziel aller Operationen ist die postoperative Vollbelastung, um die schnellstmögliche Mobilisation der Patienten zu erreichen (Abb. 1). <br /> Bei osteoporotischen Frakturen anderer Lokalisation wird individuell mit dem Patienten entschieden, ob ein operativer Eingriff oder eine konservative Therapie durchgeführt werden soll. Die weiteren Behandlungsschritte sind mit den eingangs erwähnten identisch.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1604_Weblinks_Seite26.jpg" alt="" width="" height="" /></p> <h2>Postoperativ: auf Station bis zur Entlassung</h2> <p>Zentrales Ziel der postoperativen Behandlung ist das Vermeiden respektive das Verringern des Auftretens postoperativer Komplikationen. Dazu zählen das frühe Erkennen und Behandeln bekannter potenzieller Komplikationen, wie etwa postoperativer Infektionen, Anämien und daraus resultierender kardiovaskulärer Folgen oder deliranter Zustandsbilder, sowie das postoperative Flüssigkeits- und Nutritionsmanagement. Bereits Anzeichen solcher Komplikationen werden im Rahmen der täglichen interdisziplinären Visite (Orthopäde/Traumatologe, internistischer Stationsarzt gemeinsam mit Pflegefachkräften) individuell frühzeitig erfasst und mittels standardisierter Protokolle werden effektive Gegenmaßnahmen ergriffen. Hierunter fallen nach individueller Bewertung z.B. neben Transfusionen von Erythrozytenkonzentraten auch der frühzeitige Ausbau der Analgesie, das Screening und frühzeitige Erfassen eines Delirs (mittels standardisierter Screening-Tools wie z.B. DOS/CAM) sowie das Implementieren einer medikamentösen Delirprophylaxe. In enger Zusammenarbeit mit der Ernährungsberatung wird der Nutritionszustand unserer Patienten evaluiert und Substitutionstherapien, beispielsweise bei Proteinmangelernährung, werden eingeleitet.<br /> Ein wichtiger Aspekt in der postoperativen Behandlung ist jedoch auch die möglichst frühzeitige Mobilisation der Patienten. So konnte gezeigt werden, dass diese nicht nur einen positiven Einfluss auf die funktionellen Behandlungsresultate hatte, sondern darüber hinaus auch positiv auf das emotionale und soziale Wohlbefinden der betagten Patienten wirkt.<sup>9</sup> Zusammen mit geschulten Physiotherapeuten ist es daher das erklärte Ziel, eine Erstmobilisation bereits am ersten postoperativen Tag durchzuführen. Zur Infektprophylaxe wird als Ziel formuliert, Urindauerkatheter nach Möglichkeit bereits am ersten postoperativen Tag zu entfernen.<br /> Je nach Bedarf oder bei verzögerter Mobilisationsfähigkeit wird durch die Physiotherapie auch ergänzend eine Atemtherapie mit den Patienten durchgeführt, um Atemwegsinfektionen vorzubeugen.</p> <h2>Die Rolle der spezialisierten Altersfrakturenvisite</h2> <p>Im Rahmen einer spezialisierten Altersfrakturenvisite wird bei jedem Patienten ein „Osteoporose-Check-up“ durchgeführt – vorherige Abklärungen oder Therapien werden im persönlichen Gespräch erfragt. Sollte dies aufgrund einer Demenz des Patienten nicht in Erfahrung zu bringen sein, werden Familienangehörige und/oder Hausärzte kontaktiert. Sofern noch nicht vorhanden, wird bei jedem unserer Patienten eine Osteoporose-Basisprophylaxe (Vitamin D) implementiert und individuell gemeinsam mit den Patienten, Angehörigen und den Hausärzten entschieden, ob eine weiterführende Osteoporosediagnostik sinnvoll ist und durchgeführt werden soll. Bei positiver Bewertung erhalten unsere Patienten dann von unserem Fracture Liaison Service eine Einladung zur weiterführenden ambulanten Abklärung. <br /> Des Weiteren werden schon unmittelbar postoperativ gemeinsam mit dem Patienten realistische Behandlungsziele vereinbart (wenn möglich Rückkehr zum Funktionszustand und zur gleichen Wohnsituation wie vor der Fraktur). Davon abgeleitet wird das Prozedere nach dem Spitalaufenthalt besprochen (Entlassung nach Hause oder ins Pflegeheim möglich, vorhergehende Rehabilitation und/oder weitere Sozialplanung). Um Komplikationen und suboptimalen Behandlungsresultaten vorzubeugen, gilt es, die Hospitalisationszeit möglichst kurz zu halten.<sup>10</sup> Wir streben daher ein proaktives, frühzeitiges Austrittsmanagement mit einer Hospitalisationsdauer von maximal 7 Tagen nach Hüftfraktur an – natürlich sofern im Einzelfall vertretbar (Abb. 1). <br /> Als große Hilfe in der bedarfsgerechten Behandlung des äußerst heterogenen geriatrischen Patientenkollektivs haben sich ferner auch die Erhebung geriatrietypischer Scores erwiesen: Scores wie etwa der Charlson Comorbidity Index<sup>11</sup> oder der Penrod Score<sup>12</sup> machen eine Gliederung der Patienten in homogenere Untergruppen möglich. Dadurch lassen sich Prognosen hinsichtlich des zu erwartenden funktionellen Outcomes und der Mobilität im Alltag 6 Monate postoperativ ableiten,<sup>12</sup> welche wiederum eine wichtige Entscheidungsgrundlage für uns – die Akutbehandelnden – darstellen. Dadurch gelingt es uns, frühzeitig zu selektieren, welche Patienten die intensive und umfassende Betreuung des Altersfrakturenzentrums wirklich benötigen und bei welchen die intensiven (und kostenreichen) Maßnahmen nicht indiziert sind. Zur letzteren Gruppe gehören zum Beispiel junge, zuvor sehr aktive Patienten (65–75 Jahre) oder aber auch Patienten, die am anderen Ende des Spektrums zu finden sind: zuvor bettlägerige, dementen Patienten, bei denen eine Verbesserung des Allgemein- und Funktionszustandes außerhalb des Erreichbaren liegt. Natürlich entscheidet im Alltag jedoch wie immer der Einzelfall.</p> <h2>Nachbehandlung in der Sprechstunde und Sekundärprävention (FLS)</h2> <p>Es liegt auf der Hand: Die erfolgreiche Primärversorgung im Akutspital ist lediglich der erste Schritt in der Behandlung geriatrischer Frakturpatienten. Um nachhaltig ein möglichst optimales Behandlungsergebnis sicherzustellen, bedarf es einer Nachbehandlung – einerseits die Frakturversorgung betreffend, andererseits natürlich auch im Hinblick auf die Sekundärprophylaxe der Osteoporose. Für Ersteres werden alle Patienten standardmäßig 6 und 12 Wochen postoperativ in unsere Sprechstunde zur klinisch-radiologischen Kontrolle einbestellt; falls erforderlich werden weitere Nachkontrolltermine vereinbart. Wie bereits zuvor erwähnt, wird schon frühzeitig während des stationären Aufenthaltes gemeinsam mit dem Patienten, seinen Angehörigen und dem Hausarzt das weitere Vorgehen im Hinblick auf die Osteoporosetherapie festgelegt. Bei sehr alten, morbiden Patienten, die auch vor der Fraktur nicht mehr gehfähig waren, ist eine weitere Abklärung oftmals nämlich gar nicht gewünscht bzw. erforderlich. Indem wir in direkten Kontakt mit den Patienten und ihren behandelnden Ärzten treten und umfassend über die Risiken und Möglichkeiten der Osteoporose und der entsprechenden Therapie aufklären, steigt letztlich auch die Rate an Zustimmung zu weiterführenden Maßnahmen. Neben der implementierten Basisprophylaxe bei allen Patienten werden die weitere Diagnostik und Therapie im Rahmen des Fracture Liasion Service (FLS) in Kooperation mit einer osteologischen Schwerpunktpraxis mit eigenem Labor durchgeführt. Wir konnten bereits zeigen, dass durch die spezifischen Maßnahmen des FLS die in der Literatur oftmals zitierte „Versorgungslücke“ in der Sekundärprävention, also der Prozentsatz jener Patienten, die keine adäquate Sekundärprophylaxe erhalten (man spricht von 80 % ), deutlich auf unter 20 % gesenkt werden kann.<sup>13</sup> Da in dieser Ausgabe jedoch ein separater Artikel über die Rolle des Fracture Liaison Service erscheint, möchten wir für weitere Informationen auf diesen verweisen.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Svedbom A et al: Epidemiology and economic burden of osteoporosis in Switzerland. Arch Osteoporos 2014; 9: 187<br /><strong>2</strong> Abrahamsen B et al: Excess mortality following hip fracture: a systematic epidemiological review. Osteoporos Int 2009; 20: 1633-1650<br /><strong>3</strong> Leibson CL et al: Mortality, disability, and nursing home use for persons with and without hip fracture: a population-based study. J Am Geriatr Soc 2002; 50: 1644-1650<br /><strong>4</strong> Farahmand BY et al: Survival after hip fracture. Osteoporos Int 2005; 16: 1583-1590<br /><strong>5</strong> Cannada LK, Hill BW: Osteoporotic hip and spine fractures: a current review. Geriatr Orthop Surg Rehabil 2014; 5: 207-212<br /><strong>6</strong> Magaziner J et al: Recovery from hip fracture in eight areas of function. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2000; 55: M498-507<br /><strong>7</strong> Bonar SK et al: Factors associated with short- versus long-term skilled nursing facility placement among community-living hip fracture patients. J Am Geriatr Soc 1990; 38: 1139-1144.<br /><strong>8</strong> Suhm N et al: Orthogeriatric care pathway: a prospective survey of impact on length of stay, mortality and institutionalisation. Arch Orthop Trauma Surg 2014; 134: 1261-1269<br /><strong>9</strong> Kalisch BJ et al: Outcomes of inpatient mobilization: a literature review. J Clin Nurs 2014; 23: 1486-1501<br /><strong>10</strong> Kamel HK et al: Time to ambulation after hip fracture surgery: relation to hospitalization outcomes. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2003; 58: 1042-1045<br /><strong>11</strong> Charlson ME et al: A new method of classifying prognostic comorbidity in longitudinal studies: development and validation. J Chronic Dis 1987; 40: 373-383<br /><strong>12</strong> Penrod JD et al: Heterogeneity in hip fracture patients: age, functional status, and comorbidity. J Am Geriatr Soc 2007; 55: 407-413<br /><strong>13</strong> Suhm N et al: [FLS - three letters alter secondary fracture prevention]. Unfallchirurg 2016; 119: 12-17<br /><strong>14</strong> Pioli G et al: Orthogeriatric care for the elderly with hip fractures: where are we? Aging Clin Exp Res 2008; 20: 113-122</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Multiligamentverletzungen im Knie: die ideale Bandplastik
Kombinationsverletzungen mehrerer Bänder im Kniegelenk sind eine Herausforderung in der Orthopädie. Ohne korrekte Therapie ist das Risiko für Rotationsinstabilitäten hoch. Eine vordere ...
Patientenoptimierung in der orthopädischen Chirurgie
Die Patientenoptimierung vor orthopädischen Eingriffen, insbesondere in der Endoprothetik, spielt eine entscheidende Rolle für den Erfolg der Operation und die Zufriedenheit der ...
Versagensanalyse nach Rotatorenmanschettenrekonstruktion
Die Rotatorenmanschette (RM) besteht aus den Muskeln Supraspinatus, Infraspinatus, Teres minor und Subscapularis. Diese zentrieren den Oberarmkopf in der Gelenkpfanne und tragen jeweils ...


