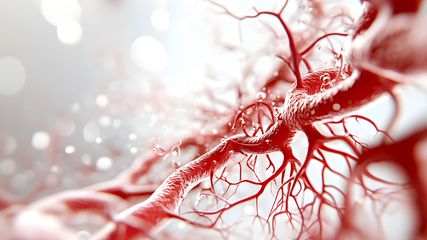©
Getty Images/iStockphoto
Ein Update zum universellen Ultraschall-Hüftscreening bei Neugeborenen
Jatros
Autor:
Doz. Dr. Rainer Biedermann
Universitätsklinik für Orthopädie<br> Medizinische Universität Innsbruck<br> E-Mail: rainer.biedermann@i-med.ac.at
30
Min. Lesezeit
13.02.2020
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die Mehrzahl der österreichischen Orthopäden ist mit der Selbstverständlichkeit eines generellen Hüftultraschall-Screenings Neugeborener ausgebildet worden, und kaum jemand käme auf die Idee, dessen Sinnhaftigkeit in Zweifel zu ziehen. International jedoch hat sich das universelle Screening bislang nicht durchgesetzt. Der folgende Artikel bietet einen Einblick in die laufende Diskussion.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Die Hüftdysplasie (DDH) umfasst ein breites Spektrum an Pathologien, welches von einer leichten Azetabulumdysplasie mit oder ohne Instabilität bis zu einer vollständigen Luxation bei der Geburt reichen kann.<sup>1</sup> Die Definitionen und die Diagnosemethoden sind unterschiedlich (klinische Untersuchung, Röntgen, Ultraschall).<br /> Die große Mehrheit der bei der Geburt klinisch instabilen Hüften stabilisiert sich innerhalb von 3 Monaten, während eine bleibende morphologische Hüftgelenksdysplasie zu einer Degeneration des Hüftgelenks und einer vorzeitigen Arthrose führt.<sup>2</sup> Eine leichte Dysplasie kann sich klinisch erst im Erwachsenenalter bemerkbar machen, während eine schwere Dysplasie mit hoher Wahrscheinlichkeit im Jugendalter symptomatisch wird. Die Inzidenz von beiden ist weitgehend unbekannt.<br /> Bildgebende Verfahren sind in der Lage, die verschiedenen Stadien von einer schwach dysplastischen, konzentrisch lokalisierten, stabilen Hüfte bis zu einer stark dysplastischen, instabilen oder sogar dislozierten Hüfte zu erfassen. Das rein klinische Screening kann möglicherweise strukturelle oder funktionelle Anomalien detektieren, ist jedoch nicht in der Lage, eine leichte Dysplasie bei stabilen Hüften zu erkennen.<br /> Während die Hüftsonografie im deutschsprachigen Raum als taugliches Werkzeug für ein generelles Hüftscreening Neugeborener anerkannt ist, gibt es international bisher keinen Konsens über die geeignetste Untersuchungsmethode. In einer rezenten Umfrage waren 94 % der befragten Mitglieder der Nordamerikanischen Gesellschaft für Kinderorthopädie (POSNA) der Meinung, dass ein generelles Ultraschallscreening in den USA nicht eingeführt werden sollte.<sup>3</sup> Darüber hinaus ist die Übereinstimmung zwischen der rein klinischen Stabilitätsuntersuchung und der morphologischen Ultraschalluntersuchung gering. In einer Studie von Kyung et al. stellten sich 93 % der klinisch subluxierbaren Hüften als sonografisch normal oder unreif dar, und nur 74 % der dislozierten Hüften und 67 % der Hüften mit Abduktionseinschränkung zeigten einen Hüfttyp schlechter als Graf IIa.<sup>4</sup><br /> Das klinische Screening mit oder ohne selektiven Ultraschall scheint weithin akzeptiert zu sein, während das universelle Ultraschall-Screening kontrovers diskutiert wird.<sup>2, 5, 6</sup> Letzteres ist seit 1992 Teil der Mutter-Kind-Pass-Untersuchung in Österreich und seit 1996 Bestandteil der U3-Vorsorgeuntersuchung in Deutschland. Es konnten durch diese Programme sowohl eine Reduzierung der Zahl chirurgischer Eingriffe bei Hüftdysplasien als auch eine Kosteneffizienz erreicht werden.<sup>7, 8</sup> Gegner eines universellen Screenings verweisen auf eine hohe Rate an spontanen Korrekturen und falsch positiven Screening- Ergebnissen, welche zu einer Überbehandlung und einer potenziell höheren Rate an avaskulären Nekrosen des Femurkopfes (AVN) führen können.<sup>5, 6</sup> In den klinischen Leitlinien der AAOS von 2014 empfahlen Mulpuri und Mitarbeiter daher ein rein klinisches Screening bei Kindern bis zum Alter von 6 Monaten. Ein universelles Ultraschall-Screening von Neugeborenen wurde nicht empfohlen. Es wurde jedoch vorgeschlagen, eine bildgebende Untersuchung vor dem 6. Lebensmonat bei Säuglingen mit signifikanten Risikofaktoren durchzuführen.<sup>6</sup> Diese Empfehlung basierte jedoch lediglich auf zwei älteren, prospektivrandomisierten Studien, welche die Rate an falsch negativen Screening-Ergebnissen als Outcome-Parameter untersuchten. In mehreren Übersichtsartikeln wurde in der Vergangenheit die am besten geeignete Screeningmethode diskutiert, wobei jedoch häufig Studien mit niedrigeren Evidenzniveaus und damit die Mehrzahl an Daten zu diesem Thema ausgeschlossen wurden.<sup>5, 6</sup> Die Rate an verspäteten Diagnosen (falsch negative Resultate) wird üblicherweise für die Bewertung eines Screening- Programms verwendet.<sup>9</sup> Dies erfordert jedoch eine große Zahl an Patienten, um valide Ergebnisse zu erreichen. Valide Umfragedaten wurden als praktikable Alternative zur Beurteilung der Wirksamkeit des Hüftdysplasie- Screenings vorgeschlagen, um die Rate an operativen Ersteingriffen an den Hüften Neugeborener innerhalb der ersten 5 Lebensjahre zu bestimmen.<sup>8</sup> In jüngeren Studien wurde die Rate an offenen Eingriffen innerhalb der ersten 5 Lebensjahre als Parameter für die Effektivität der Screening- Programme herangezogen.<sup>10, 11</sup> Ein universelles Screening kann zu einer Überbehandlung (falsch positive Ergebnisse) führen, welche eine Hüftkopfnekrose nach sich ziehen kann.<br /> Letztlich ist auch der Langzeiteffekt eines Hüft-Screenings auf die Rate an späteren Eingriffen zur Korrektur einer Hüftdysplasie, wie korrigierende Osteotomien, ein entscheidender Parameter, um den Wert eines solchen Screenings zu bestimmen.<sup>7, 11</sup> In den letzten Jahren ist eine Reihe von Artikeln veröffentlicht worden, die diesem viel diskutierten Thema neue Aspekte hinzugefügt haben.</p> <h2>Der natürliche Verlauf der Hüftdysplasie</h2> <p>Das Spektrum der morphologischen und klinischen Pathologien, die eine Hüftdysplasie ausmachen, ist gut bekannt, aber der natürliche Verlauf ist überraschend schlecht untersucht. Die Kontroverse basiert auf einem unzureichenden Follow-up von gescreenten Säuglingen bis zur Skelettreife und dem Mangel an gut geplanten, prospektiven Studien.<sup>5</sup> Die Prävalenz einer klinischen Instabilität ist altersabhängig, sie bildet sich innerhalb der ersten Lebenswochen infolge des erhöhten Muskeltonus zurück.<sup>2</sup> Sonografisch unauffällige Hüften in der Neugeborenenperiode haben ein 0,2 %iges Risiko, sich zu verschlechtern, und mehr als 90 % der als unreif kategorisierten Neugeborenenhüften bessern sich innerhalb der ersten 6 Lebenswochen.<sup>10</sup> Bei dysplastischen oder dezentrierten Hüften besteht eine signifikante Korrelation zwischen der Dauer einer Abspreizbehandlung und dem Schweregrad der Dysplasie (Abb. 1).<sup>10</sup> Die Schwierigkeit besteht jedoch darin, zu entscheiden, ob eine Hüfte als unreif oder tatsächlich als dysplastisch zu klassifizieren ist, und die Wahrscheinlichkeit einer spontanen Ausreifung dysplastischer Hüften ist unbekannt, da nur wenige solcher Hüften unbehandelt bleiben.<br /> Die Ergebnisse einer kleinen randomisierten Studie, in der Säuglinge mit stabilen, aber dysplastischen Hüften abgespreizt wurden, deuteten auf eine spontane Verbesserung im Rahmen des Wachstums und ohne Intervention hin.<sup>12</sup> Andererseits gilt eine persistierende Dysplasie bzw. Instabilität der Hüfte als Prädisposition für ein Hüftleiden im Erwachsenenalter. Die Ergebnisse einer Korrelation des norwegischen medizinischen Geburtenregisters mit dem Endoprothesenregister zeigten nach Berücksichtigung von Geschlecht und Geburtsjahr ein 2,6-fach erhöhtes Risiko (95 % CI: 30–105) für Kinder mit einer Neugeborenen-Hüftinstabilität, einem totalem Hüftgelenksersatz unterzogen zu werden. Von den 442 Patienten, die einen Hüftersatz erhielten, wurden 95 wegen einer degenerativen Gelenkerkrankung aufgrund einer Hüftdysplasie operiert, und nur 8 hatten eine neonatale Hüftinstabilität. Es wurde vermutet, dass es eine signifikante Menge an Hüftdysplasien gibt, bei denen im Kindesalter keine physischen Befunde vorliegen, die jedoch später im Erwachsenenalter symptomatisch werden.<sup>13</sup> Die klinische Herausforderung ist es daher, diejenigen bei der Geburt instabilen Hüften, welche sich spontan bessern, von jenen zu trennen, welche später symptomatisch werden und zu frühen degenerativen Veränderungen führen.</p> <p> </p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2020_Jatros_Ortho_2001_Weblinks_s26_abb1.jpg" alt="" width="650" height="512" /></p> <h2>Verspätete Diagnose einer Hüftdysplasie</h2> <p>Die Problematik einer verspäteten Diagnose liegt in der potenziell höheren Invasivität bzw. der höheren Rate an Komplikationen bei der Behandlung der Hüftdysplasie.<sup>14</sup> Price et al. berichteten von einem 12-fachen Anstieg des relativen Risikos für eine offene Reposition nach einer verspäteten Diagnose. Im Falle einer Diagnose vor der 6. Lebenswoche war eine Abduktionsbehandlung in 84 % erfolgreich, wohingegen 86 % der Kinder, die erst nach dem 10. Lebensmonat behandelt wurden, schließlich eine Operation mit offener Hüftgelenksreposition benötigten.<sup>15</sup> Eine der wenigen prospektiven Studien wurde von Holen et al. durchgeführt, welche ebenfalls die Rate an Spätdiagnosen als Outcome-Parameter wählten. Die prospektive randomisierte Studie umfasste 15 529 Säuglinge mit zwei Screeningstrategien: entweder einem klinischen Screening und einer universellen Ultraschalluntersuchung oder einem klinischen Screening aller Hüften und einer selektiven Ultraschalluntersuchung. Die Rate an Spätdiagnosen in Holens Studie betrug 0,13/1000 in der Gruppe mit universeller Ultraschalluntersuchung (wobei der Patient mit verspäteter Diagnose keine Ultraschalluntersuchung hatte) und 0,65/1000 in der Gruppe mit selektiver Untersuchung.<sup>9</sup> Da der Unterschied nicht statistisch signifikant war, sahen Holen et al. keinen Vorteil in einem universellen Screening, was auch in vielen Übersichtsarbeiten als Argument gegen ein universelles Screening herangezogen wird.<br /> In einer anderen prospektiven Studie verglichen Rosendahl et al. 3 übereinstimmende Studiengruppen: universelles Ultraschall- Screening, Risikofaktor-Screening und rein klinisches Screening. Die Rate an Spätdiagnosen betrug 0,3/1000, 0,7/1000 bzw. 1,3/1000, wobei auch in dieser Studie die Unterschiede nicht statistisch signifikant waren.<sup>16</sup><br /> Das enge Wickeln der Beine wurde kürzlich als Risikofaktor für eine spät auftretende Hüftdysplasie identifiziert.<sup>14</sup> In Japan war die traditionelle Methode, die Neugeborenen in Hüftextension eng zu wickeln, stark mit Hüftdysplasien verbunden, diese gingen nach einer Aufklärungskampagne in Kyoto von 52,9 auf 5,6 pro 1000 Lebendgeborenen zurück.<sup>17</sup> Moderne Methoden der Säuglingspflege und -lagerung in Industrieländern, wie zum Beispiel das Pucken, könnten ebenso die Hüftentwicklung beeinflussen. Eine verspätet diagnostizierte Hüftdysplasie kann somit ein sekundäres Phänomen einer anfangs normalen Hüfte sein.</p> <h2>Therapierate</h2> <p>Die oben zitierte Studie von Rosendahl ergab darüber hinaus, dass das generelle Ultraschall-Screening zu einer höheren Behandlungsrate (3,4 %) führte als das selektive Ultraschall-Screening (2,0 %) oder das klinische Screening (1,8 %). Die höhere Rate beim universellen Screening war statistisch signifikant.<sup>16</sup> Die Sonografiedaten aus Österreich legten jedoch eine Abnahme der Behandlungsraten mit zunehmender Screening-Erfahrung dar.<sup>18</sup> In einer prospektiven Kohortenstudie über einen Zeitraum von 20 Jahren zeigten Clarke et al. eine Abnahme der Zahl der verspäteten Diagnosen von 1,28/1000 auf 0,74/1000 bei Anwendung eines selektiven Hüftultraschalls, jedoch eine höhere Rate als bei universellem Ultraschall-Screening.<sup>19</sup> In einer rezenten Publikation der eigenen Arbeitsgruppe lag die Behandlungsrate bei 28 092 nachuntersuchten Hüften bei 1 %, wenn man die Fälle mit IIa+-Hüften ausnimmt, bei welchen empfohlen wurde, die Kinder breit zu wickeln. Chirurgische Eingriffe (geschlossene und offene Reposition) waren bei etwa 10 % der Patienten mit Hüftdysplasie erforderlich, die Rate an größeren (offenen) Operationen betrug jedoch nur 0,4 % und war damit erheblich niedriger als in den bisher publizierten Studien.<sup>10</sup></p> <h2>Rate an Erstoperationen in den ersten 5 Lebensjahren</h2> <p>Godward und Dezateux zeigten, dass die Inzidenz an operativen Eingriffen aufgrund einer kongenitalen Hüftgelenksluxation in den ersten 5 Lebensjahren 0,78/1000 Lebendgeburten betrug, was der Prävalenz in früheren Studien in Großbritannien entsprach.<sup>20</sup> Die Autoren stellten auch fest, dass eine Hüftgelenksluxation bei 70 % der Kinder, die dem nationalen orthopädischen Überwachungssystem gemeldet wurden, nicht vor dem Alter von 3 Monaten durch ein Routine-Screening nachgewiesen worden war. Es wurde daraus geschlossen, dass das 1969 in Großbritannien eingeführte klinische Screening-Programm die Inzidenz von chirurgischen Eingriffen aufgrund dieser Erkrankung nicht wirksam senken konnte und alternative Screening-Methoden notwendig sind.<br /> Von Kries et al. stellten eine Rate an Erstoperationen an der Neugeborenenhüfte in den ersten 5 Lebensjahren von 0,26/1000 Lebendgeburten in Deutschland fest – deutlich niedriger als vor der Einführung eines universellen Ultraschall-Screening- Programms.<sup>8</sup></p> <h2>Rate an offenen operativen Eingriffen</h2> <p>Die Rate der Erstoperationen an Neugeborenenhüften kann nur eingeschränkt als Maß für die Beurteilung der Wirksamkeit eines Screening-Programms herangezogen werden, da diese unabhängig vom Zeitpunkt und damit der Invasivität des Eingriffes ist. Schwere Formen einer primären Hüftdysplasie oder sekundäre Dislokationen, die durch eine frühe Diagnose geschlossen reduziert werden könnten, erfordern bei einer späten Diagnosestellung möglicherweise eine offene Reposition.<sup>10</sup><br /> Die Rate an offenen operativen Eingriffen weist erhebliche regionale Unterschiede auf.<sup>21</sup> In einer Publikation aus Taiwan lag die Rate an kongenitalen Hüftgelenksluxationen und Spätdiagnosen bei 1,2/1000 Lebendgeburten. 40 % dieser Kinder wurden operiert, 85 % davon hatten größere Eingriffe. Dies ließ die Autoren zu dem Schluss kommen, dass ihr Screening-Programm insuffizient sei.<sup>22</sup> Die Inzidenz an größeren Operationen pro 1000 Lebendgeburten (bzw. der Prozentsatz der offenen Repositionen mit oder ohne Osteotomie von allen chirurgischen Eingriffen) bei rein klinischem Screening betrug 0,38 (47 %) in Nordirland,<sup>23</sup> 0,3 (47 %) in Großbritannien<sup>20</sup> und 0,15 (29 %) in Südaustralien<sup>24</sup>. Bei Anwendung des universellen Ultraschall-Screenings lag die Inzidenz in der bisher größten nachuntersuchten Kohorte in Österreich bei 0,04 (4,2 %)<sup>10</sup> bzw. bei 0,09 (33 %) in einer Studie aus Deutschland<sup>8</sup>. Die Anzahl der offenen Interventionen scheint ein verlässlicherer Indikator für die Beurteilung der Effektivität eines Screening- Programms zu sein und liegt bei einem universellen Ultraschall-Screening praktisch bei null.<sup>25</sup></p> <h2>Späteingriffe bei Hüftdysplasie</h2> <p>Die Mehrzahl der aktuellen Studien befasst sich mit dem Einfluss des selektiven Ultraschall-Screenings auf die Rate an übersehenen Hüftdysplasien (verspätete Diagnosen) bei skelettunreifen Patienten. Die Auswirkungen des selektiven Ultraschall-Screenings auf die Rate an operativen Interventionen aufgrund einer Hüftdysplasie, die nach Erreichung der Skelettreife festgestellt wurde, sind seltener untersucht. Eine Stichprobenuntersuchung von 3935 Probanden im Erwachsenenalter aus einer ursprünglich randomisierten kontrollierten Studie mit 11 925 Säuglingen ergab keine Verringerung der Zahl an radiologischen Hüftdysplasien bzw. degenerativen Veränderungen der Hüftgelenke.<sup>26</sup> Allerdings betrafen alle moderaten Fälle nur die Gruppe der nicht gescreenten Hüften und es folgten nur 51,8 % (2011) der Probanden der Einladung und nahmen an dieser Nachuntersuchung teil. Um die Prävalenz von Risikofaktoren für eine Hüftdysplasie zu identifizieren, die ein rein selektives Ultraschall-Screening der Patienten mit Hüftdysplasie rechtfertigen könnte, zeigten Sink et al., dass 85,3 % der 68 nachuntersuchten Patienten mit symptomatischer Hüftdysplasie im Erwachsenenalter nicht die aktuellen Empfehlungen für ein selektives Screening in den USA erfüllt hätten.<sup>21</sup> In einer retrospektiven Studie unserer Arbeitsgruppe, in der zwei 5-Jahres-Zeiträume vor und nach der Einführung des universellen Ultraschall-Screenings verglichen wurden, konnte ein Rückgang der hüftdysplasie-bezogenen Operationen bei Kindern und Jugendlichen seit Einführung des Screening- Programms um 76 % nachgewiesen werden.<sup>7 </sup></p> <h2>Avaskuläre Femurkopfnekrose</h2> <p>Die avaskuläre Femurkopfnekrose (AVN) wird als häufigste und potenziell schädlichste Komplikation sowohl chirurgischer als auch nichtchirurgischer Eingriffe bei der Hüftdysplasie beschrieben.<sup>27</sup> In einer kürzlich durchgeführten Metaanalyse wurde eine durchschnittliche AVN-Rate von 10 % in einem 5-Jahres-Zeitraum nach geschlossener Reposition ermittelt.<sup>28</sup> Das Risiko steigt mit dem radiologischen Schweregrad der Luxation und dem Ausmaß der zur Retention notwendigen Abduktion sowie der Repositionsmethode.<sup>29</sup> Williams et al. berichteten über ein Nekroserisiko von unter 1 % bei frühem Screening, Früherkennung und Verwendung einer Pavlik-Bandage.<sup>30</sup> In einer randomisierten kontrollierten Studie mit Langzeit-Follow-up aus Norwegen stellten die Autoren keine höheren Nekroseraten in Zusammenhang mit den höheren Behandlungsraten bei universellem Screening fest.<sup>26</sup> Auch die Art und Flexibilität der Orthese sowie die Hüftposition während der Abspreizbehandlung spielen eine Rolle bei der Entstehung einer Hüftkopfnekrose.<sup>29</sup> In einer prospektiven Kohortenstudie wurde bei der Verwendung der Tübinger Abduktionsorthese über keinerlei Hüftkopfnekrosen berichtet.<sup>31</sup></p> <h2>Zusammenfassung</h2> <p>Die Ergebnisse der jüngsten Literatur unterstreichen die Notwendigkeit hochwertiger Screening-Programme zur Früherkennung der Hüftdysplasie. Es wurde aufgezeigt, dass die Rate an Spätdiagnosen durch beide Screening-Modalitäten (klinisch und Ultraschall) reduziert wird<sup>8–10</sup> und bei einem universellen Ultraschall-Screening wahrscheinlich bei null liegt<sup>25</sup>, wohingegen Einzelfälle bei einem rein klinischen Screening übersehen werden können. In den älteren (auch in den randomisierten) Studien war die Behandlungsrate bei universellem Ultraschall-Screening am höchsten.<sup>16</sup> In den jüngeren Arbeiten lag sie unter den Zahlen des rein klinischen Screenings mit selektivem Ultraschall.<sup>10, 31</sup> Die Behandlungsraten variieren naturgemäß mit der Inzidenz, die innerhalb ethnischer Gruppen und nach geografischer Lage erheblich voneinander abweichen.<sup>1</sup> Alternative Outcome-Parameter, wie die Rate an Ersteingriffen an der Neugeborenenhüfte innerhalb der ersten 5 Lebensjahre oder der prozentuelle Anteil an invasiven Eingriffen, haben sich bei Anwendung eines universellen Ultraschall-Screenings als am niedrigsten dargestellt.<sup>8, 10, 16, 31</sup> Darüber hinaus zeigte sich eine signifikante Reduktion der Zahl von Späteingriffen in Verbindung mit einer Hüftdysplasie nach Einführung eines generellen Ultraschall-Screenings,<sup>7</sup> wohingegen die derzeit gültigen Kriterien für ein selektives Screening die überwiegende Mehrheit der betroffenen Patienten nicht zu identifizieren vermag.<sup>31</sup> Das Hauptargument für die Infragestellung eines universellen Ultraschall-Screenings ist das potenzielle Risiko einer iatrogenen Femurkopfnekrose.<sup>5</sup> Es wurde kürzlich gezeigt, dass geschlossene Repositionen mit einem durchschnittlichen Risiko einer Hüftkopfnekrose von 10 % verbunden sind,<sup>28</sup> wohingegen die Rate einer Nekrose nach bloßer Abduktionsbehandlung unter Verwendung moderner Abduktionsorthesen vernachlässigbar erscheint.<sup>31</sup> Es sind jedoch weitere Studien mit ausreichendem Follow-up erforderlich, um diese Ergebnisse zu bestätigen. In ihrem Übersichtsartikel über die Hüftdysplasie aus dem Jahr 2007 kamen Dezateux und Rosendahl zum Schluss, dass eine Ausweitung des klinischen Screenings auf universelles Ultraschallscreening aus wissenschaftlicher und ethischer Sicht nicht gerechtfertigt sei.<sup>5</sup> Die Autoren wiesen auf die Notwendigkeit randomisierter kontrollierter Studien hin, um die Wirksamkeit und Sicherheit des Neugeborenen-Screenings und der Frühbehandlung zu bewerten, und forderten qualitativ hochwertige Studien zu den Behandlungsergebnissen der Hüftdysplasie im Erwachsenenalter sowie zu den kindlichen Ursprüngen einer frühen degenerativen Hüfterkrankung. Derartige Studien erfordern jedoch einen Beobachtungszeitraum über Jahrzehnte, bis der Einfluss der verschiedenen Screening-Programme auf die Rate an hüftdysplasiebedingten Operationen im späteren Leben ausreichend bestimmt ist. Außerdem müssten mehrere Zehntausend Patienten einbezogen werden, um in allen Leitfragen signifikante Beurteilungen treffen zu können. Eine ähnlich ehrgeizige Studie, die Informationen über 80 000 britische Babys während ihres gesamten Lebens sammeln sollte, ist nur 8 Monate nach ihrem offiziellen Start zu Ende gegangen, da sich nicht genügend Eltern angemeldet haben. Der Studienabbruch erfolgte weniger als ein Jahr später, nachdem das US-amerikanische National Institute of Health (NIH) einen ähnlichen Versuch, 100 000 Kinder von Geburt an zu beobachten, abgesagt hatte.<sup>32</sup> <br />Insgesamt liegen die Ergebnisse des universellen Hüftultraschall-Screenings deutlich über denen alternativer Screening- Strategien. Wenn zukünftige Studien bestätigen, dass die bloße Hüftabduktion in flexiblen Orthesen kein bzw. nur ein geringes Risiko einer iatrogenen AVN in sich birgt, fällt das letzte Argument gegen ein universelles Ultraschallprotokoll und es ebnet sich der Weg für einen Paradigmenwechsel auch in denjenigen Ländern, in denen die Hüftdysplasie immer noch häufig in einem operativen Eingriff mündet. Damit wäre der letzte Schritt getan, der von Lorenz Böhler eingeführten unblutigen Methode zur Behandlung der Hüftdysplasie zum endgültigen globalen Durchbruch zu verhelfen, deren Diagnostik durch einen weiteren verdienten Österreicher, Reinhard Graf, bereits vor Jahrzehnten perfektioniert wurde.<sup>33</sup></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2020_Jatros_Ortho_2001_Weblinks_s26_abb2.jpg" alt="" width="650" height="414" /></p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Loder RT, Skopelja EN: ISRN Orthop 2011; 10: 238607 <strong>2</strong> Barlow TG: J Bone Joint Surg [Br] 1962; 44: 292-301 <strong>3</strong> Taylor IK et al.: J Ped Orthop 2020; epub ahead of print <strong>4</strong> Kyung BS et al.: Clin Orthop Surg 2016; 8: 203-9 <strong>5</strong> Dezateux C, Rosendahl K: Lancet 2007; 369: 1541-52 <strong>6</strong> Mulpuri K et al.: J Am Acad Orthop Surg 2015; 23: 202-5 <strong>7</strong> Thaler M et al.: J Bone Joint Surg [Br] 2011; 93: 1126-30 <strong>8</strong> Von Kries R et al.: Lancet 2003; 362: 883–7 <strong>9</strong> Holen KJ et al.: J Bone Joint Surg [Br] 2002; 84: 886-90 <strong>10</strong> Biedermann R et al.: Bone Joint J 2018; 100: 1399-404 <strong>11</strong> Biedermann R, Eastwood DM: J Child Orthop 2018; 12: 296-301 <strong>12</strong> Wood MK et al.: J Pediatr Orthop 2000; 20: 302-5 <strong>13</strong> Engesæter IØ et al.: Acta Orthopaedica 2008; 79: 321-6 <strong>14</strong> Mulpuri K et al.: Clin Orthop Relat Res 2016; 474: 1131-7 <strong>15</strong> Price KR et al.: Bone Joint J 2013; 95: 846- 50 <strong>16</strong> Rosendahl K et al.: Pediatrics 1994; 94: 47-52 <strong>17</strong> Ishida K: Clin Orthop Rel Res 1977; 126: 167-9 <strong>18</strong> Grill F, Müller D: Orthopade 1997; 26: 25-32 <strong>19</strong> Clarke NM et al.: Arch Dis Child 2012; 97: 423-9 <strong>20</strong> Godward S, Dezateux C: Lancet 1998; 351: 1149-52 <strong>21</strong> Sink EL et al.: J Child Orthop 2014; 8: 451-5 <strong>22</strong> Chang CH et al.: J Formos Med Assoc 2007; 106: 462-6 <strong>23</strong> Maxwell SL et al.: BMJ 2002; 324: 1031-3 <strong>24</strong> Chan A et al.: Lancet 1999; 354: 1514-7 <strong>25</strong> Sanghrajka AP et al.: Ann R Coll Surg Engl 2013; 95: 113-7 <strong>26</strong> Laborie LB et al.: Pediatrics 2013; 132: 492-501 <strong>27</strong> Shipman SA et al.: Pediatrics 2006; 117: 557- 76<strong> 28</strong> Bradley CS et al.: J Child Orthop 2016; 10: 627-32 <strong>29</strong> Suzuki S et al.: J Bone Joint Surg [Br] 1996; 78: 631-5 <strong>30</strong> Williams PR et al.: J Bone Joint Surg [Br] 1999; 81: 1023-8 <strong>31</strong> Munkhuu B et al.: PLoS One 2013; 8:e79427 <strong>32</strong> Pearson H: Nature 2015; 526: 620–1 <strong>33</strong> Graf R: J Pediatr Orthop 1984; 4: 735-40</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Neueste Entwicklungen der spinalen EndoskopieNachhaltige keramische Knochenimplantate bald aus dem 3D-Drucker
Die endoskopische Wirbelsäulenchirurgie hat sich von einer rein perkutanen Technik zu einer hochpräzisen, technisch ausgereiften Methode entwickelt, die ein weites Spektrum degenerativer ...
Seltene Kleingefässvaskulitiden im Fokus
Bei Vaskulitiden der kleinen Gefässe liegt eine nekrotisierende Entzündung der Gefässwand von kleinen intraparenchymatösen Arterien, Arteriolen, Kapillaren und Venolen vor. Was gilt es ...
Elektive Hüft-TEP bei Adipositas Grad III
Übergewichtige Patient:innen leiden früher als normalgewichtige Personen an einer Hüft- oder Kniearthrose. Allerdings sieht die aktuelle S3-Leitlinie zur Behandlung der Coxarthrose in ...