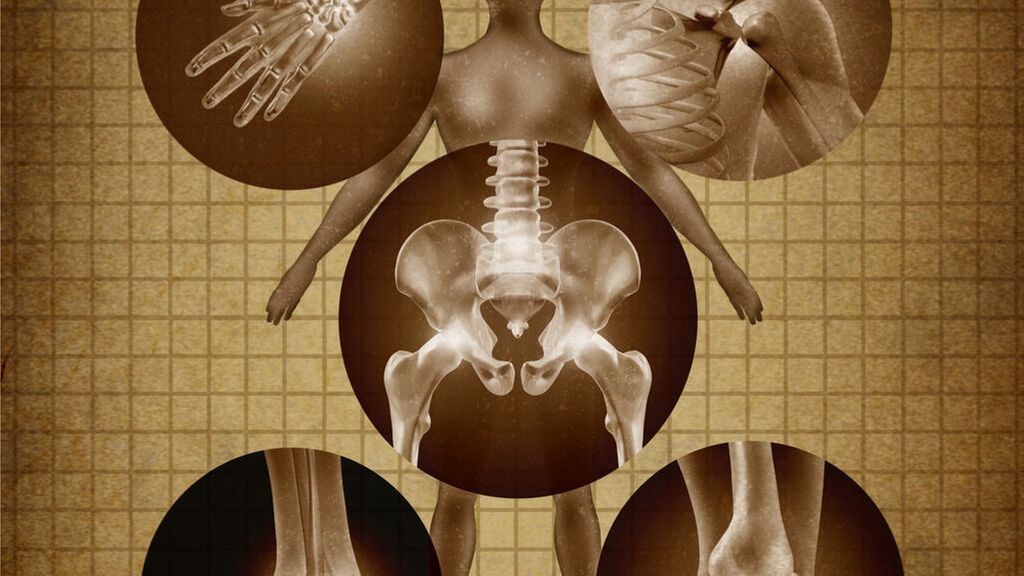
Ein Leben lang aktiv bleiben
Jatros
30
Min. Lesezeit
15.09.2016
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">„Maintaining activity through life“ und was die Orthopädie dazu beitragen kann, so das Motto und das Hauptthema beim 17. EFORT-Kongress in Genf, der diesmal gemeinsam mit der Schweizerischen Gesellschaft swiss orthopaedics gestaltet wurde. Rund 6.000 Expertinnen und Experten – nicht nur aus Europa, sondern aus aller Welt – waren bei diesem wissenschaftlichen Großereignis versammelt.</p>
<hr />
<p class="article-content"><h2>Präsident für kindliche Frühförderung</h2> <p>„Die Grundlagen für körperliche Mobilität im Alter werden in der frühen Kindheit gelegt. Sie hängen eng mit sozialer Mobilität und einem förderlichen Umfeld zusammen“, sagte EFORT-Präsident Prof. Enric Cáceres aus Barcelona. Er verwies auf eine wachsende Kluft zwischen Arm und Reich in Europa und forderte hochwertige Frühförderungsprogramme für sozial benachteiligte Kinder: „Wer in beengten Verhältnissen leben muss, keine Förderung seiner Bewegungslust erfährt und wenig Gespür für seinen Körper entwickeln kann, wird diese Nachteile ein Leben lang am eigenen Leib spüren.“ Kinder mit einem schlechten sozioökonomischen Start ins Leben seien unter den Ersten, die an Schmerzen des Bewegungsapparats leiden, ihren Beruf aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben könnten oder irgendwann einen Gelenksersatz brauchten. Investitionen in mehr und bessere pädagogische Programme würden eine hohe gesundheitsökonomische und soziale Rendite für die Gesellschaft bringen.</p> <div id="rot"> <p>„Schmerz und Entzündung der Achillessehne beginnen nicht in der Sehne selbst, sondern im umgebenden Gewebe.“ - Dr. Carla Stecco, Padua</p> </div> <h2>Pflegeheim vermeiden</h2> <p>Altersbedingte Verletzungen wie Schenkelhalsbrüche münden oft direkt in Pflegebedürftigkeit. Das ließe sich vielfach verhindern, ist Prof. Tim Pohlemann, Universitätsklinikum des Saarlandes, Deutschland, überzeugt. Bei der Behandlung von multiplen Verletzungen bei Menschen ab 70 gäbe es eindeutig Potenzial nach oben: „Orthopädisch-geriatrische Rehabilitationskonzepte können nachweislich viel dazu beitragen, um zentrale Therapieziele wie Selbstständigkeit, Mobilität und Lebensqualität auch bei Menschen fortgeschrittenen Alters zu erreichen. Sie sollten daher dringend weiterentwickelt und flächendeckend implementiert werden.“<br /> Eine deutsche Metastudie, an der Pohlemann mitgewirkt hat, zeigt: Die Sterblichkeit nach Polytraumata ist zwar deutlich zurückgegangen, doch die Lebens­qualität der Betroffenen wurde nicht im gleichen Ausmaß verbessert. Besonders schlecht geht es der Studie zufolge Frauen, die sehr alt sind, einen geringen sozialen Status haben, sich eine Fraktur an den unteren Extremitäten zugezogen und zusätzlich am Kopf verletzt haben. „In den letzten Jahren konnten große Fortschritte erzielt werden. Die Heilungschancen nach schwierigen Brüchen sind besser denn je. Offenbar kommen aber die Innovationen nicht in vollem Umfang bei den Patienten an. Sie bräuchten gleich nach dem Unfall eine maßgeschneiderte Behandlung in einer spezialisierten Einrichtung“, meint Pohlemann.<br /> Es brauche nicht nur eine Akuttherapie, um Brüche und andere Verletzungen zu behandeln, so der Referent, sondern überlappend frührehabilitative Maßnahmen und eine geriatrische Komplextherapie. Entscheidend sei dabei unter anderem die intensive Zusammenarbeit mit spezialisierten Internisten, denn Polytraumata sind bei älteren Menschen besonders schwer zu behandeln. Jeder zweite Patient über 55 weist mindestens eine Begleiterkrankung auf, allen voran Bluthochdruck. „Komorbiditäten können chirurgische Eingriffe besonders riskant gestalten, die Wund- und Knochenheilung verzögern und das Infektionsrisiko vergrößern.“ Die Nachbetreuung sollte Pohlemann zufolge ebenfalls multidisziplinär aufgestellt sein und alles daransetzen, die Betroffenen körperlich und – gerade nach schweren Verletzungen und Operationen – auch seelisch wieder aufzurichten und zu mobilisieren.<br /> „Mit Blick auf die demografische Entwicklung sind die gesundheitspolitischen Entscheidungsträger gefordert, effektivere und somit auch kostengünstige Rehabilitationsmethoden zu implementieren. Wir werden es uns nicht leisten können, darauf zu verzichten. Die Alternative würde bedeuten: Wir lassen Menschen pflegebedürftig werden, die ihren Alltag noch gut allein oder mit wenig Unterstützung bewältigen könnten“, unterstrich Pohlemann. Tatsächlich ist mit einem drastischen Anstieg altersassoziierter Verletzungen zu rechnen.</p> <div id="rot"> <p>„Eine periphere Nervenblockade über mehrere Wochen könnte Phantomschmerzen vorbeugen.“ - Prof. Battista Borghi, Bologna</p> </div> <h2>Mit dem BMI steigt das Komplikationsrisiko</h2> <p>Jeder zehnte Patient, der in Europa ein künstliches Hüftgelenk benötigt, ist fettleibig. Eine große Herausforderung für die orthopädische Chirurgie, denn wer allzu viele Kilos auf die Waage bringt, muss mit Komplikationen rechnen. Einer Schweizer Studie zufolge sind vor allem Adipöse ab einem BMI von 35kg/m<sup>2</sup> Risikokandidaten für Nachoperationen und Infektionen: Einer Auswertung von 2.500 Knieprothetikdaten zufolge brauchen Patienten ab diesem BMI im Vergleich zu anderen doppelt so häufig Revisionsoperationen und leiden auch doppelt so oft an tiefen Infektionen. „Adipositas ist nicht nur ein biomechanisches, sondern auch ein biologisches Problem“, erklärt Prof. Sébastien Lustig, Croix-Rousse Universitätsklinik Lyon. So hat sich inzwischen die Erkenntnis durchgesetzt, dass Fettleibigkeit, metabolisches Syndrom und kardiovaskuläre Erkrankungen auf komplexe Weise zusammenspielen. Sie begünstigen Entzündungsprozesse und Knorpeldegeneration, die an der Entstehung von Arthrosen beteiligt sind. Diabetes, eine der typischen Komorbiditäten von Adipositas, erhöht das Infektionsrisiko bei Hüftoperationen um 10 % und sollte daher unbedingt vor der Operation gut behandelt werden. Andere infektionsvermeidende Maßnahmen sind Raucherentwöhnung vor der OP, eine spezielle Vorbereitung der Haut und die Verwendung von Knochenzement mit Antibiotika. Sie sind im Fall von starkem Übergewicht besonders wichtig.<br /> „Auch wenn es keine offizielle Gewichtsgrenze für das Implantieren von Gelenksprothesen gibt: Gerade bei Fällen von krankhafter Adipositas wäre es sehr angezeigt, vor der OP Kilos loszuwerden“, meint Prof. Sébastien Parratte von der Universität Aix-Marseille. Die Operateure sollten daher mit den Patienten alle Risiken durchgehen, die sich bei einem Eingriff ohne vorherigen Gewichtsverlust ergeben können. Außerdem sollten die Möglichkeiten besprochen werden, um Gewicht zu reduzieren – wenn nötig auch chirurgische Optionen. Vor der Operation müssen Patienten zudem genau darüber informiert werden, was sie mit dem neuen Hüftgelenk tun können und was nicht. „Gerade bei Adipösen ist die Gefahr einer Dislokation höher als bei Normalgewichtigen“, betont Lustig. Vermutet wird auch, dass aseptische Lockerungen von Hüftendoprothesen bei Fettleibigkeit häufiger vorkommen. Diese entstehen vor allem durch Abriebpartikel oder fehlende initiale Stabilität des Implantats. „Um eine Dislokation der Hüfte zu vermeiden, haben sich künstliche Hüftgelenke bewährt, die einen hohen Offset sowie einen verminderten Abduktionswinkel der Gelenkspfanne und einen größeren Hüftkopfdurchmesser haben“, erläutert Lustig.<br /> Schließlich spielt auch die passende Operationstechnik eine wichtige Rolle für erfolgreiche Eingriffe. „Die operierenden Ärzte sollten bei adipösen Patienten nur jenen chirurgischen Zugang wählen, der ihnen bestens vertraut ist. Minimal invasive Eingriffe sind jedenfalls nicht angezeigt“, so Parratte. Da es in Zukunft immer mehr adipöse Menschen geben wird, die einen Gelenksersatz benötigen, könnten spezielle Operationstechniken Schule machen. Eine Empfehlung lautet etwa, bei adipösen Patienten maßgeschneiderte patientenspezifische Schablonen als Führung zu verwenden, wenn eine Prothese angepasst wird. Das steigert die Genauigkeit, reduziert Blutverlust und Operationszeit und hilft zudem, die Größe von Schnitten und Implantaten bei Patienten mit hohem BMI richtig zu bemessen. Mit patientenspezifischen Schablonen kann auch die mechanische Achse verlässlicher wiederhergestellt werden.<br /> „Aus ärztlicher Sicht ist es jedenfalls sinnvoll, auch extrem fettleibigen Menschen bei Bedarf eine Hüftprothese einzusetzen. Das ist die effektivste Methode, um die Beweglichkeit von Personen mit schweren Arthrosen wiederherzustellen. Die Alternative wären chronische Schmerzen, Behinderung und sogar Pflegebedürftigkeit“, so das Resümee von Lustig und Parratte.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1605_Weblinks_Seite15_1.jpg" alt="" width="550" height="421" /></p> <h2>Lernen aus der Praxis</h2> <p>Datensammlungen rund um Gelenks­implantate und orthopädische Eingriffe zeigen oft besser als klinische Studien, welche Stärken und Schwächen künstliche Gelenke haben. Die Datenlage von Endoprothetikregistern ist aber noch verbesserungswürdig. Die EFORT-Initiative NORE (Network of Orthopaedic Registries of Europe) will das ändern.<br /> „Die Vorteile von Registern liegen inzwischen auf der Hand, doch die Datenlage lässt zum Teil noch zu wünschen übrig“, so EFORT-Generalsekretär Prof. Per Kjærsgaard-Andersen, South Danish University, Vejle, Dänemark. „NORE hat sich zum Ziel gesetzt, die Entwicklung von Registern rund um die Gelenksprothetik zu fördern und die Datensammlungen und Berichte zu harmonisieren und zu standardisieren.“ In Vorreiterstaaten wie Australien, den Niederlanden, Norwegen und Schweden wurden bereits in den späten 1990ern die kompletten Daten zu Gelenkimplantaten in Registern erfasst. Andere Staaten sammeln bis heute keine Informationen – oder nur in manchen Kliniken oder zu bestimmten Implantaten, was die Aussagekraft der Ergebnisse schwächt. Oft sind vorhandene Daten schwer mit jenen anderer Register vergleichbar, angefangen bei der Nomenklatur. „Register sollten in allen Ländern verpflichtend eingeführt werden, und zwar flächendeckend und in einer Art, die aussagekräftige Vergleiche ermöglicht“, fordert Kjærsgaard-Andersen. NORE strebt keinen gemeinsamen Datenpool an, regt aber in Symposien den nötigen Diskussionsprozess rund um Datenerfassung und -harmonisierung an und engagiert sich im Wissenstransfer. „Derzeit unterstützt NORE Ägypten und die Türkei dabei, nationale Register einzuführen“, berichtet Kjærs­gaard-Andersen. In Zukunft sollten nationale Registerdaten weltweit ähnlich leicht vergleichbar sein, wie es schon in den nordischen Ländern der Fall ist. „Registerdaten sind nicht nur für hochkomplexe Studien eine wichtige Grundlage, sie können auch für die breite Öffentlichkeit aufbereitet werden. In Schweden können beispielsweise alle Interessierten bestimmte Daten recherchieren, um sich über die Lebensdauer von Implantaten zu informieren oder um die Komplikationsraten in bestimmten Spitälern zu vergleichen.“</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1605_Weblinks_Seite15_2.jpg" alt="" width="553" height="423" /></p> <h2>Tendinitis oder Paratendinitis?</h2> <p>Neues von der Achillessehne bis zum Phantomschmerz wurde im Symposium „Chronic Pain“ berichtet. Dr. Carla Stecco, Orthopädin und Anatomin aus Padua, ist der Meinung, dass die Ursache für schmerzhafte Achillessehnen nicht in der Sehne selbst, sondern im umgebenden Bindegewebe (Paratenon) zu suchen ist. „Neuere Studien haben gezeigt, dass Inflammation und Schmerz nicht in der Sehne, sondern im Paratenon beginnen“, so Stecco. Einige weitere Beobachtungen stützen diese Hypothese: So zeigen 34 % aller asymptomatischen Achillessehnen histopathologische Veränderungen. In schmerzhaften Achillessehnen findet man Nervengewebe, das vom Paratenon in die Sehne einwächst. Geschädigte Achillessehnen zeigen oft gar keine Inflammations-, sondern nur degenerative Zeichen. Und Achillesehnenrisse können auch ohne vorhergehende Schmerzen eintreten.<br /> Ausgehend von diesen Beobachtungen haben Stecco et al anatomisch-histologische, MRI- und Ultraschalluntersuchungen durchgeführt, um herauszufinden, welche Rolle das Paratenon in der Pathogenese von Tendinopathien spielt. Die radiologischen Ergebnisse zeigten, dass bei Patienten mit Beschwerden das Paratenon verdickt ist. „Die Sehne selbst ist nicht innerviert, die paratendinösen Gewebe dagegen sehr gut“, erklärt Stecco. Tendinitis ist also meist eher eine Paratendinitis, der Schmerz geht nicht von der Sehne aus, sondern vom Paratenon. Erst die chronische Alteration des Paratenons führt zur Degeneration der Achillessehne, so Steccos Conclusio.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1605_Weblinks_Seite16.jpg" alt="" width="556" height="461" /></p> <h2>Nervenblockade kann Phantomschmerz verhindern</h2> <p>Noch immer leiden 50 bis 80 % aller Patienten nach Amputationen an Phantomschmerzen. Die Behandlungsversuche reichen von Akupunktur und Elektrostimulation über medikamentöse Therapie (Antikonvulsiva, Antidepressiva, Opioide) bis zu Neurektomie und Lobektomie und sind doch allesamt wenig zufriedenstellend. Auch die präemptive epidurale Blockade vor der Amputation hat nicht die Erwartungen erfüllt: Es kann damit zwar der akute postoperative Schmerz reduziert werden, auf die Prävention von Phantomschmerzen hat sie jedoch keinen Effekt (Halbert J et al: Clin J Pain 2202; 18).<br /> Periphere Nervenblockaden, die nur drei Tage lang postoperativ durchgeführt werden, sind ebenfalls nicht dazu geeignet, spätere Phantomschmerzen zu verhindern. Prof. Battista Borghi, Anästhesist aus Bologna, der sich schon seit Langem der Erforschung des Phantomschmerzes widmet, plädiert für eine längere postoperative Verweildauer der Nervenkatheter. 2004 hat er damit begonnen, Amputationspatienten mit einer peri- oder intraneuralen lokalen Anästhesie (Katheterinfusion mit 0,5 % Ropivacain 5ml/h) zu versorgen. Im Rahmen einer Studie sollte diese Behandlung mit patientengesteuerter Morphinbehandlung verglichen werden. Doch schon die ersten 4 Patienten der Morphingruppe verlangten wegen schwerer bis unerträglicher Schmerzen den Switch zur lokalen Anästhesiegruppe. Insgesamt wurden 60 perineurale und 15 intraneurale Katheter platziert. „Der Intraneuralkatheter sollte zumindest vier Zentimeter tief, in einem adäquaten Abstand von der Operationswunde vom Stumpf Richtung Körper gelegt werden“, empfiehlt Borghi. „Zu beachten ist, dass der Nerv durch Retraktion den Kontakt zum Katheter verlieren kann.“ Im Gegensatz zu früheren Studien wurde die Behandlung über mehrere Wochen fortgesetzt, wenn es nötig war, d.h. wenn nach Absetzen der Infusion Schmerzen auftraten. Die durchschnittliche Verweildauer der Katheter war 28 Tage. Die Ergebnisse der nunmehr observationalen Studie: Von 62 Patienten, die nach 12 Monaten die Studie beendeten, litten nur 3 % an schweren Phantomschmerzen. Phantomempfindungen gaben jedoch 39 % der Probanden an (Borghi B et al: Anesth Analg 2010; 111). „Diese Studie zeigt vor allem, dass diese Behandlung sicher ist und ohne große Komplikationen auf mehrere Wochen und Monate ausgedehnt werden kann“, so Borghi. „Auch über längere Perioden wurden keine toxischen Nebenwirkungen beobachtet.“</p></p>
Das könnte Sie auch interessieren:
«Auch Patienten mit Demenz profitieren von einer chirurgischen Stabilisierung»
Patienten mit Hüftfraktur und einer leichten, mittelschweren oder schweren Demenz haben ein geringeres Risiko zu sterben, wenn sie operiert werden – vor allem wenn es sich um Kopf-Hals- ...
Management periprothetischer Frakturen am Kniegelenk
Mit steigenden Versorgungszahlen der Knieendoprothetik und dem höheren Lebensalter entsprechend der Alterspyramide nimmt auch die Zahl der periprothetischen Frakturen zu und stellt die ...
Patellofemorale Instabilität
In diesem Übersichtsartikel möchten wir ein Update über die aktuelle Diagnostik und die konservativen wie auch operativen Behandlungsmöglichkeiten der patellofemoralen Instabilität geben.


