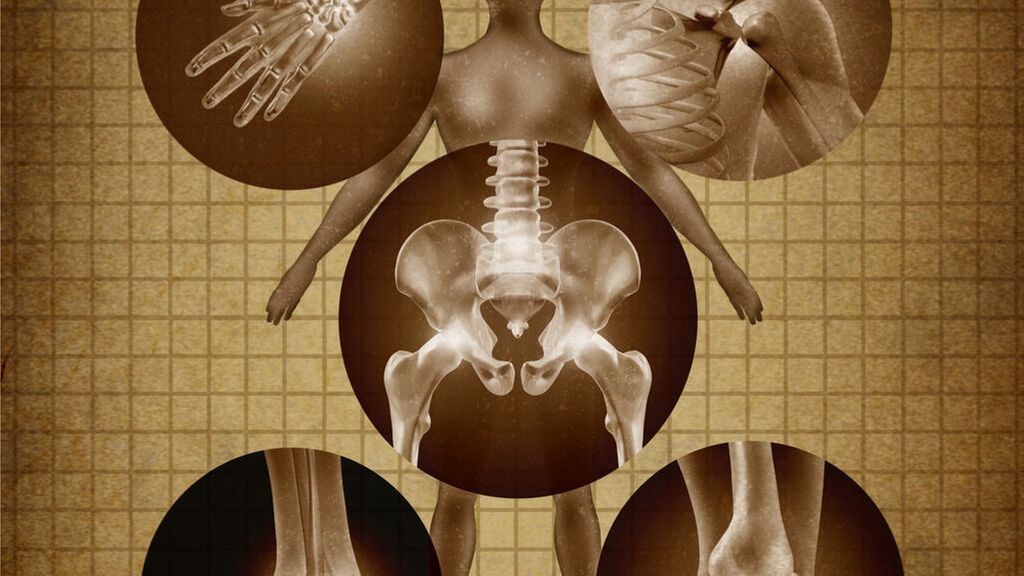
Die arthroskopische J-Span-Plastik bei vorderer Schulterinstabilität mit knöchernem Glenoiddefekt
Jatros
Autor:
Dr. Leo Pauzenberger
II. Orthopädische Abteilung, Herz-Jesu Krankenhaus Wien<br>E-Mail: leo.pauzenberger@kh-herzjesu.at
30
Min. Lesezeit
16.11.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die arthroskopische J-Span-Plastik ist, wie auch ihr offenes Pendant, eine österreichische Entwicklung, die eine minimal invasive Rekonstruktion des Glenoids bei Schulterinstabilität mit knöchernen Defekten erlaubt. Dabei durchläuft der eingebrachte Knochenspan einen physiologischen Umbauprozess, der zur Wiederherstellung einer natürlichen Skapulaanatomie führt. Die vorliegenden kurz- bis mittelfristigen Ergebnisse sind ausgesprochen vielversprechend, wobei Patienten ohne Einschränkung zu jeglichen beruflichen und sportlichen Aktivitäten zurückkehren konnten.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Die arthroskopische J-Span-Plastik bietet eine minimal invasive, implantatfreie Möglichkeit zur Rekonstruktion knöcherner Glenoiddefekte.</li> <li>Kurz- bis mittelfristig zeigen sich bisher exzellente klinische Ergebnisse.</li> <li>Postoperative knöcherne Umbauvorgänge führen zur Wiederherstellung einer natürlichen Glenoidanatomie mit Normalisierung der glenohumeralen Kontaktflächen und Druckbelastungen.</li> <li>Biomechanische Untersuchungen bestätigten die hohe erreichbare glenohumerale Stabilität sowie die Sicherheit der initialen J-Span-Fixation.</li> </ul> </div> <p>Die vordere Schulterinstabilität ist üblicherweise assoziiert mit Verletzungen der anterioren kapsulolabralen Strukturen des Schultergelenks und knöchernen Defekten unterschiedlichen Ausmaßes. <br />Die Prävalenz klinisch signifikanter Glenoiddefekte wird in der Literatur mit 5 bis 67 % angegeben<sup>1–3</sup> und konnte als entscheidender Faktor für das Versagen von reinen Weichteil-Operationstechniken identifiziert werden.<sup>1, 4–7</sup> Zusätzlich zu diesen klinischen Beobachtungen konnten experimentelle Studien die biomechanische Wichtigkeit einer intakten anterioren Skapulaanatomie für stabile glenohumerale Verhältnisse aufzeigen.<sup>8–11</sup> Seit der Erkenntnis um die Relevanz glenoidaler Knochendefekte für die Stabilität des Schultergelenks wurden zahlreiche offene, minimal invasive und arthroskopische Operationstechniken entwickelt.<sup>12–17</sup><br />Obwohl nicht anatomische Operationsmethoden – allen voran der Korakoidtransfer nach Latarjet gefolgt von schraubenfixierten Knochenblockaugmentationen – weltweit breite Anwendung finden, sind diese Techniken mit speziellen und teils schwerwiegenden Komplikationen vergesellschaftet. So zeigen sich unter anderem regelmäßig Pseudoarthrosen, Osteolysen, Korakoidfrakturen, sekundäre Gelenksdestruktionen durch freiliegende Schrauben und eine technisch aufwendige Revisionssituation.<sup>18, 19</sup> <br />Eine mögliche Alternative zu diesen Operationstechniken stellt die anatomische, implantatfreie Glenoidrekonstruktion mittels J-förmigen Beckenkammspans dar. Diese wurde von Resch<sup>14</sup> entwickelt und ist in offener Weise seit beinahe drei Jahrzehnten erfolgreich in Verwendung. Eine Weiterentwicklung dieser Technik stellt die arthroskopische J-Span-Plastik nach Anderl<sup>12, 13</sup> dar, welche im bisherigen Untersuchungszeitraum ebenfalls exzellente klinische und radiologische Ergebnisse geliefert hat. Unabhängig von der Wahl des Zugangs ist beiden Varianten gemeinsam, dass der implantierte Span einen physiologischen Remodelingprozess entsprechend dem Wolff’schen Gesetz der Anpassung des Knochens an die Belastungen durchläuft.<sup>20–22</sup> Dieser Prozess resultiert in einer Wiederherstellung der anterioren Skapulahalsmorphologie.<sup>13</sup> <br />Trotz der Vermeidung von implantatspezifischen Komplikationen und vielversprechenden klinischen Resultaten hat die schraubenfreie Fixation auch spezielle Nachteile. Aufgrund der initial nicht rigiden Fixation wird die postoperative Stabilität und demzufolge die frühe Rehabilitation vorrangig von den zugrunde liegenden Knochenumbauvorgängen vorgegeben. Bis vor Kurzem lagen keine Daten zur Stabilität des implantatfrei fixierten Spans vor, weshalb die Rehabilitation in den ersten postoperativen Wochen durchwegs sehr vorsichtig gehandhabt wurde.</p> <h2>Arthroskopische Operationstechnik</h2> <p>Die Operation kann sowohl in Seitenlagerung als auch in Beach-Chair-Position unter Interskalenus-Blockade und Allge­meinnarkose durchgeführt werden. Nach einer diagnostischen Arthroskopie zur Darstellung des Glenoiddefekts und eventueller Begleitpathologien wird ein bikortikaler Knochenblock aus dem Beckenkamm gewonnen. Üblicherweise beläuft sich die Größe des Spans auf ca. 15 x 15 x 5mm, wobei in unseren Händen bei entsprechend großen knöchernen Glenoiddefekten auch etwas größere Knochenblöcke zum Einsatz kommen. Anschließend wird der entnommene Knochenblock mithilfe einer oszillierenden Säge und Feile in eine J-förmige Form gebracht. Dabei wird am langen J-Schenkel nur kortikaler Knochen belassen (Abb. 1). Abschließend wird der so zugerichtete Span über zwei 1,6mm-Bohrdrähte an einem speziellen Impaktor fixiert.<br />Zur weiteren arthroskopischen Präparation werden neben dem dorsalen Standardportal ein anteroinferiores Portal direkt über der Subscapularissehne sowie ein anterosuperiores Portal direkt ventral der langen Bizepssehne angelegt. Zur besseren Visualisierung des anterioren Gle­noidaspekts wird das Arthroskop in das anterosuperiore Portal umgesteckt. Vernarbtes Labrum und kapsuloligamentäre Strukturen sowie knöcherne Restfragmente werden vom anterioren Glenoid entfernt. Anschließend wird die Vorderwand des defekten Glenoids mit der arthroskopischen Fräse angefrischt und geglättet, um eine adäquate Kontaktfläche für die J-Span-Anlagerung zu schaffen. Zur korrekten Implantation des Spans wird ein mediales, anteriores, tief inferiores Portal angelegt. Für dieses wird nach Sondierung mit der Nadel ein Subscapularis-Split entlang der Sehnenfasern von intraartikulär her durchgeführt, während von außen das Portal auf 2cm Länge erweitert und stumpf lateral der Conjoint-Tendons auf das Gelenk zugegangen wird. Sobald dieses Portal etabliert ist, wird ein anteriorer Glenoidretraktor als sogenannte „Wasserrutsche“ eingebracht, über die in weiterer Folge die Glenoidosteotomie mittels speziellen Meißels erfolgt. Die Osteotomie wird in einem Winkel von 30° zur Glenoidoberfläche, 5mm medial der vorderen Glenoidkante angelegt. Um die Gefahr von Span- oder Glenoidfrakturen zu minimieren, muss die Osteotomie entsprechend der Länge des langen J-Span-Schenkels und einer superior-inferior etwas überdimensionierten Ausdehnung durchgeführt werden. Nach Vorbereitung dieser Nut wird der Impaktor samt Span über die „Wasserrutsche“ eingebracht und unter vorsichtigem Einhämmern im Osteotomiespalt versenkt, bis ein fester Kontakt zwischen dem kurzen Spanschenkel und der vorderen Glenoidwand besteht. Mithilfe der Fräse wird der Span nun noch modelliert, um die native Glenoidkonkavität bestmöglich wiederherzustellen (Abb. 2). Falls vorhanden bzw. von suffizienter Qualität werden die anterioren Weichteile noch über den Span refixiert, sodass dieser quasi extraartikulär liegt.<br />Postoperativ wird die Schulter nach Bedarf in einer Adduktionsbandage für 3 Wochen gelagert, wobei skapulothorakale Übungen in der geschlossenen Kette von Beginn an erlaubt sind. Ab der 4. Woche kann mit passiven, assistiven und aktiven Übungen begonnen werden, wobei die Außenrotation für 6 Wochen vermieden werden sollte. Die Rückkehr zu den meisten beruflichen Belastungen ist spätestens nach 3 Monaten uneingeschränkt möglich. Kontakt-, Überkopf- oder Wurfsportarten können nach 6 Monaten wieder begonnen werden.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Ortho_1706_Weblinks_s41_1.jpg" alt="" width="1417" height="1226" /></p> <h2>Datenlage</h2> <p>Die J-Span-Plastik kommt in offener Form seit beinahe drei Jahrzehnten sehr erfolgreich zur Anwendung. Mittlerweile sind Studien mit klinischen und radiologischen 10-Jahres-Ergebnissen verfügbar, die diese exzellenten Erfahrungen wissenschaftlich bestätigen.<sup>14, 23</sup> Unsere eigenen bereits publizierten Untersuchungen zur arthroskopischen J-Span-Plastik zeigten im 2-Jahres-Follow-up ebenfalls ausgezeichnete Ergebnisse (Abb. 3). Alle inkludierten Patienten konnten ohne wiederauftretende Schulterinstabilität zu ihren beruflichen und sportlichen Aktivitäten zurückkehren. Auch Patienten, die für das Schultergelenk höchst anspruchsvolle Sportarten, u.a. Vollkontakt-Kampfsport, Volleyball und Kite-Surfen, ausübten, waren in der Lage, zu ihrem ursprünglichen Sportlevel zurückzukehren.<sup>13</sup> Auch in der gerade laufenden 5-Jahres-Nachuntersuchung sind die Patienten bisher mit der Operation noch äußerst zufrieden und üben weiterhin uneingeschränkt sämtliche beruflichen und sportlichen Aktivitäten ohne rezidivierende Instabilität aus. <br />Neben den vorhandenen klinischen Daten lieferte eine aktuelle experimentelle Untersuchung erstmals biomechanische Daten zur J-Span-Plastik.<sup>24</sup> Dabei konnte im Labor gezeigt werden, dass mittels J-Span-Plastik ein anteriorer Glenoiddefekt von 30 % anatomisch rekonstruiert werden kann. Durch diese anatomisch korrekte Wiederherstellung der glenoidalen Gelenksfläche kam es zu einer Normalisierung der glenohumeralen Kontaktfläche und der Druckbelastungen, was hinsichtlich der Reduktion des Fortschreitens einer sogenannten Instabilitätsarthropathie (eine fortschreitende Abnutzung des Gelenks, ausgelöst durch das initiale Dislokationsereignis und resultierende Mikroinstabilität, das wahrscheinlich auch durch Stabilisationsoperationen nur verlangsamt, aber nicht verhindert werden kann) von Bedeutung sein könnte. Hinsichtlich der erzielbaren glenohumeralen Stabilität konnte das Niveau eines intakten Glenoids wiederhergestellt bzw. deutlich überschritten werden,<sup>24</sup> wobei sich die J-Span-Plastik nahtlos in die Reihe anderer bekannter Stabilisierungsoperationen einreihen konnte, über die solche Daten bereits seit Längerem zur Verfügung stehen. Die endgültige glenohumerale Stabilität und Fixation des J-Spans wird erst durch den physiologischen Remodelingprozess erreicht, weshalb die Frage nach der initialen Sicherheit einer implantatfreien Spanfixierung lange Zeit ungeklärt war. Hierzu zeigte sich in der biomechanischen Untersuchung, dass der Span bereits direkt nach Pressfit-Impaktion sicher fixiert ist und unter den getesteten Belastungen die Gefahr einer Protrusion des Spans aus dem Osteotomiespalt oder eines Spanbruchs äußert gering erscheint.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Ortho_1706_Weblinks_s41_2.jpg" alt="" width="2149" height="580" /></p> <h2>Schlussfolgerung</h2> <p>Die arthroskopische J-Span-Plastik erlaubt eine minimal invasive Rekonstruktion anteriorer Glenoiddefekte, wobei sich exzellente klinische und radiologische Ergebnisse im mittelfristigen Outcome zeigen. Dabei kommt es nach J-Span-Plastik durch einen physiologischen Remodelingprozess zu einer Wiederherstellung einer nativen Glenoidanatomie. Biomechanische Untersuchungen konnten eine direkt postoperativ sichere J-Span-Fixation, eine Normalisierung der glenohumeralen Kontaktfläche und der Druckbelastungen sowie eine exzellente glenohumerale Stabilität nachweisen.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Burkhart SS, De Beer JF: Arthroscopy 2000; 16(7): 677-94 <strong>2</strong> Kim DS et al.: Am J Sports Med 2010; 38(10): 2071-6 <strong>3</strong> Rowe CR, Sakellarides HT: Clin Orthop 1961; 20: 40-8 <strong>4</strong> Bigliani LU et al.: Am J Sports Med 1998; 26(1): 41-5 <strong>5</strong> Porcellini G et al.: J Bone Joint Surg Am 2009; 91(11): 2537-42 <strong>6</strong> Shin SJ et al.: Am J Sports Med 2016; 44(11): 2784-91 <strong>7</strong> Tauber M et al.: J Shoulder Elbow Surg 2004; 13(3): 279-85 <strong>8</strong> Itoi E et al.: J Bone Joint Surg Am 2000; 82(1): 35-46 <strong>9</strong> Montgomery WH et al.: J Bone Joint Surg Am 2005; 87(9): 1972-7 <strong>10</strong> Yamamoto N et al.: Am J Sports Med 2009; 37(5): 949-54 <strong>11</strong> Yamamoto N et al.: J Bone Joint Surg Am 2010; 92(11): 2059-66 <strong>12</strong> Anderl W et al.: Arthroscopy 2012; 28(1): 131-7 <strong>13</strong> Anderl W et al.: Am J Sports Med 2016; 44(5): 1137-45 <strong>14</strong> Auffarth A et al.: Am J Sports Med 2008; 36(4): 638-47 <strong>15</strong> Boileau P et al.: Arthroscopy 2010; 26(11): 1434-50 <strong>16</strong> Lafosse L, Boyle S: Arthroscopic Latarjet procedure. J Shoulder Elbow Surg 2010; 19(2 Suppl): 2-12 <strong>17</strong> Warner JJP et al.: Am J Sports Med 2006; 34(2): 205-12 <strong>18</strong> Di Giacomo G et al.: J Shoulder Elbow Surg 2011; 20(6): 989-95 <strong>19</strong> Griesser MJ et al.: J Shoulder Elbow Surg 2013; 22(2): 286-92 <strong>20</strong> Frost HM: Angle Orthod 2004; 74(1): 3-15 <strong>21</strong> Moroder P et al.: J Shoulder Elbow Surg 2014; 23(3): 420-6 <strong>22</strong> Moroder P et al.: J Shoulder Elbow Surg 2013; 22(11): 1522-29 <strong>23</strong> Deml C et al.: Am J Sports Med 2016; 44(11): 2778-83 <strong>24</strong> Pauzenberger L et al.: Am J Sports Med 2017; 45(12): 2849-57</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Periphere Nervenkompressionssyndrome der oberen Extremität
Periphere Nervenkompressionssysteme der oberen Extremitäten sind verhältnismäßig häufig, insbesondere der Nervus medianus und der Nervus ulnaris sind oft im Bereich des Hand- bzw. ...
Konservative Behandlungsmöglichkeiten bei peripheren Nervenläsionen
Eine periphere Nervenläsion erfordert nicht nur eine Dekompression, Naht oder Rekonstruktion. Um Gelenke beweglich zu erhalten, eine Atrophie der Muskulatur zu verhindern und die ...
Bildgebende Diagnostik des peripheren Nervensystems
Die komplexen Nerventopografien machen die Nervenbildgebung zu einer fordernden Aufgabe, die allerdings eine wichtige Rolle dabei spielt, eine funktionelle Wiederherstellung der ...


