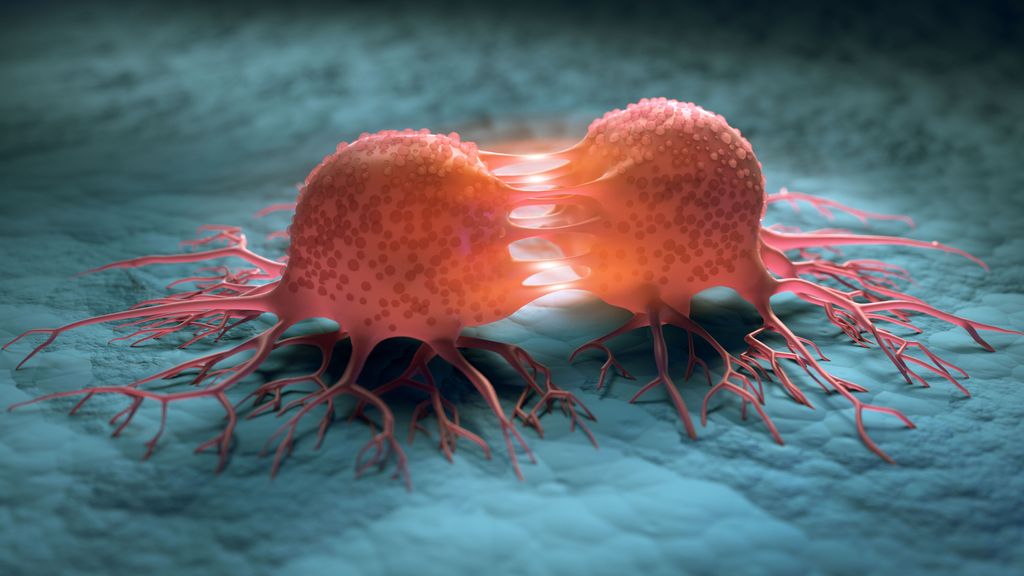
©
Getty Images/iStockphoto
Österreich ist am Studiensektor äußerst aktiv
Jatros
30
Min. Lesezeit
14.07.2016
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Bei der diesjährigen Tagung der AGO wurden zahlreiche Studien präsentiert, an denen österreichische Zentren aktiv beteiligt sind und deren Ergebnisse mit Spannung erwartet werden. Während die PARP-Inhibition beim <em>BRCA</em>-mutierten Ovarialkarzinom bereits erfolgreich etabliert wurde, muss ihre Effektivität beim Mammakarzinom erst bestätigt werden. In den Studien OlympiA und OlympiAD wird diese Fragestellung bei Patientinnen mit dem Nachweis einer <em>BRCA</em>-Mutation gegenwärtig untersucht. </p>
<hr />
<p class="article-content"><h2>WAAGO – aktuelle Studien in Österreich</h2> <p>In einer speziell dazu ausgerichteten Session wurden wieder spannende aktuelle Studienprojekte des WAAGO (wissenschaftlicher Ausschuss der AGO) präsentiert.<br /> <br /><strong> PITVIN und ITIC 2: intraepitheliale Neoplasien VIN und CIN</strong><br /> Die beiden akademischen Studien PITVIN (NCT01861535) und ITIC 2 (NCT01283763) haben gemeinsam, dass die Effektivität des Immunmodulators Imiquimod mit der operativen Exzision/Ablation bei HPV-assoziierten valvulären (PITVIN) bzw. der Schlingenkonisation bei zervikalen intraepithelialen Neoplasien (VIN bzw. CIN) der Grade 2 und 3 (ITIC 2) verglichen wird. Bei beiden Lokalisationen stellt zurzeit die chirurgische Sanierung den etablierten Standard dar. <br /> Ass.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Gerda Trutnovsky, Medizinische Universität (MU) Graz, die die Rationale für PITVIN erörterte, führte als Nachteile der chirurgischen Sanierung das Risiko für eine Rezidivierung und eine Narbenbildung an. Gemäß den Ergebnissen einer Übersichtsarbeit<sup>1</sup> kann mit Imiquimod in 50 % der Fälle eine komplette virale Clearance erzielt werden. „Welche Faktoren für das Therapieansprechen verantwortlich sind, ist noch ungeklärt. Jedenfalls sind bislang noch keine Studien zum direkten Vergleich der chirurgischen mit der medikamentösen Therapie durchgeführt worden. PITVIN soll dazu beitragen, mehr Klarheit in die Frage nach der Gleichwertigkeit von Imiquimod mit der Operation zu schaffen“, erläuterte Trutnovsky. In PITVIN werden insgesamt 110 Patientinnen im 1:1-Design zur medikamentösen Therapie (lokale Applikation als Suppositorium, 1–3x wöchentlich für 4 Monate) bzw. zur Operation (Exzision oder Ablation) randomisiert. Als primärer Endpunkt (EP) ist die komplette klinische Remission (CR) nach 6 Monaten definiert, zu den weiteren EP zählen histologische Remission, HPV-Clearance, ästhetisches Outcome (vulväre Narbenbildung) und gesundheitsbezogene Lebensqualität (HRQoL).</p> <p>An der österreichweiten Studie nehmen 10 Zentren teil. Zum Zeitpunkt der Präsentation waren 40 Patientinnen eingeschlossen. Als potenzielles Problem führte Trutnovsky die Thematik der Patientenpräferenz an: Viele Patientinnen tendieren aufgrund einer vorgefertigten Meinung zur Nichtteilnahme an der Studie. „In solchen Fällen ist es wichtig, der Patientin die aktuelle Datenlage zu erläutern und darauf hinzuweisen, dass gegenwärtig noch ungeklärt ist, welche Art der Therapie effektiver ist“, so der Tipp von Prof. Trutnovsky.<br /> Die bisher vorliegenden Auswertungen zur HRQoL sind ermutigend: Die Frage „Wie würden Sie die Qualität der Behandlung beurteilen?“ beantworteten 82 % der Patientinnen mit „sehr gut“ und die restlichen 18 % mit „gut“. 73 % würden bei erneutem Auftreten von VIN „eindeutig“ dieselbe Art der Behandlung durchführen lassen.<br /> <br /> Bei CIN der Grade 2 und 3 ist die Schlingenkonisation zurzeit der SOC („standard of care“). In einer österreichischen Studie wurde bereits vor einigen Jahren die signifikante Überlegenheit von Imiquimod vs. Placebo nachgewiesen: In der Studienperiode von 16 Wochen wurde bei 73 vs. 39 % der Patientinnen eine histologische Regression und bei 17 vs. 14 % sogar eine histologische CR verzeichnet (p=0,009 bzw. p=0,008). Die Rate der HPV-Clearance betrug 60 % .<sup>2</sup><br /> <br /> ITIC 2 ist die erste randomisierte Phase-III-Studie mit 500 geplanten Teilnehmerinnen zum Vergleich des SOC mit einer medikamentösen Therapie. Zum Einschlusskriterium eines Mindestalters von ≥30 Jahren bei Patientinnen mit kolposkopisch nachgewiesener CIN2 erklärte Assoc.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Stephan Polterauer, MU Wien: „Wir wissen, dass bei jüngeren Patientinnen eine sehr hohe Spontanremissionsrate zu beobachten ist.“<br /> <br /> Als primärer EP ist der Nachweis eines negativen HPV-Tests 6 Monate nach Therapiestart der 16-wöchigen Studienperiode festgelegt. Darüber hinaus wird der Remissionsstatus mittels Pap-Untersuchung, Koloskopie und 4-Quadranten-Zervixbiopsie beurteilt und die Nebenwirkungen über PRO („patient reported out­comes“) evaluiert. Zwecks Generierung von Daten zu den Langzeitout­comes (Rezidivrate, Identifikation prädiktiver Parameter für die Response wie HPV-Typ) werden bei Patientinnen, die eine Remission aufweisen, Follow-up-Untersuchungen zu den Zeitpunkten 12, 18 und 24 Monate nach Therapiebeginn durchgeführt (Abb. 1).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Gyn_1603_Weblinks_Seite15.jpg" alt="" width="572" height="499" /></p> <p>Die Studie wird an den MU Wien, Graz, Innsbruck und Salzburg sowie bei den Barmherzigen Schwestern in Linz durchgeführt. Zum Zeitpunkt der Präsentation waren 88 Patientinnen eingeschlossen, Studienstart war bereits im Mai 2013. Um die Rekrutierung voranzutreiben, wird angestrebt, auch ein Zentrum in Deutschland zu initiieren.<br /> <br /> „Wenn die Studie positiv ausgeht, könnten sich die Ergebnisse als ‚practice changing‘ auswirken“, so das Resümee von Prof. Polterauer.<br /> <br /><strong> LUSTIC: seröses intraepitheliales Ovarialkarzinom</strong><br /> Lange wurde die Frage diskutiert, wie ein nicht vom Müller’schen Gewebe abstammender Tumor in einem Müller-Organ (die Follikel­epithelzellen des Ovars entwickeln sich aus dem Müller-Gang)<sup>3</sup> entstehen kann. In der Pathogenese des Typ-II-Ovarialkarzinoms (OC) spielt die Tube eine wesentliche Rolle. Mittlerweile konnte herausgefunden werden, dass die maligne Transformation mit einer überschießenden (reversiblen) Proliferation der sekretorischen Zellen startet. Als nächster Schritt in der Karzinogenese erfolgt die Entwicklung von p53-Signaturen, die auch immunhistochemisch darstellbar sind. Schließlich erfolgt am Fimbrienende die Bildung von STIC („serous tubal intraepithelial carcinomas“), In-situ-Karzinomen, die fast alle eine p53-Mutation aufweisen. Gemäß der gegenwärtig geltenden Theorie streuen diese ins Ovar, wo eine maligne Entartung stattfindet.<sup>4, 5</sup> „STIC haben eine starke Exfoliationstendenz: Von der Oberfläche brechen ganze Zellschollen in die Tube ein“, erklärte Univ.-Prof. Dr. Paul Speiser, MU Wien, der das Konzept der AGO-45-Studie LUSTIC (Lavage of the Uterine cavity for the diagnosis of Serous Tubal Intraepithelial Carcinoma; NCT02039388) präsentierte. Basierend auf diesen Erkenntnissen wurde erstmals in Kooperation mit der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, USA, im Rahmen einer Pilotstudie mit einem nicht standardisierten Katheter der Frage nachgegangen, ob bei Patientinnen mit Typ-II-OC mittels Lavage des Cavum uteri STIC detektiert werden können. Dies war tatsächlich bei 80 % der untersuchten Proben der Fall.<sup>6</sup><br /> <br /> Inzwischen wurde ein Katheter entwickelt, der es erstmalig ermöglicht, die Spülungen des Cavum uteri unter standardisierten Bedingungen durchzuführen, was die Voraussetzung für die Durchführung der Studie darstellte. In der von Prof. Speiser als Principal Investigator geleiteten Studie LUSTIC wird bei Patientinnen, die sich aufgrund eines hohen Risikos für die Entwicklung eines hochgradig serösen OC einer bilateralen Salpingoophorektomie (BSO) bzw. einer Ovarektomie bzw. einer BSO + Hys­terektomie unterziehen, intra­operativ eine Lavage des Cavum uteri und der proximalen Tuben durchgeführt und auf das Vorliegen von STIC einschließlich p53-Mutationen untersucht. Darüber hinaus findet eine pathologische Aufarbeitung der Tuben statt. Es wird davon ausgegangen, dass bei 5–10 % der Patientinnen bereits STIC oder sogar ein okkultes OC nachgewiesen werden können. Für das Vorliegen eines okkulten OC präsentierte Speiser den Fall einer 41-jährigen <em>BRCA1</em>-Keimbahnmutationsträgerin mit unauffälligem CA-125-Spiegel, bei der STIC am Fimbrienende detektiert und im Anschluss ein seröses OC, G3, pT3b, pN0, FIGO IIIB, diagnostiziert worden war. In der Laparotomie fand sich bereits eine peritoneale Metastase (15mm Ø).<br /> <br /> Gegenwärtig ist dieses Prozedere nur intraoperativ möglich, aber es wird bereits eine weitere Studie entwickelt, in deren Setting die Lavage im ambulanten Setting und ohne Anästhesie durchgeführt werden soll.<br /> <br /> <strong>PAOLA-1</strong><br /> Nachdem sich Olaparib erfolgreich bei rezidivierten platinsensitiven OC-Patientinnen mit dem Nachweis einer <em>BRCA-1/2-</em>Mutation etabliert hat, wird dieser PARP-Inhibitor in diesem Kollektiv auch in der Erstlinie untersucht: In der doppelblinden Phase-III-Studie PAOLA-1 (NCT02477644) werden die Patientinnen (n=612) nach Verabreichung der Standard-Erstlinienchemotherapie mit Carboplatin + Paclitaxel und dem Zusatz von Bevacizumab im 2:1-Design zur zweijährigen Gabe von Olaparib (300mg 2x täglich [BID]) bzw. Placebo als Erhaltungstherapie randomisiert. Bevacizumab ist ebenfalls in beiden Armen für 15 Monate als Maintenancestrategie vorgesehen. Als primärer Wirksamkeits-EP ist das PFS1 gemäß RECIST-Kriterien, Version 1.1, definiert. Die Evaluierung des PFS2, d.h. der Zeitspanne bis zur zweiten Progression, und das Gesamtüberleben (OS) zählen zu den sekundären EP. In Österreich ist die Rekrutierung von 24 Patientinnen an 6 Zentren geplant. „Wir erwarten uns eine rasche Rekrutierung, damit auch die Frage der Effektivität einer PARP-Inhibition in der Erstlinie bald beantwortet werden kann“, gab sich OA Dr. Christian Schauer, Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Graz, zuversichtlich.<br /> <br /><strong><em> BRCA</em> und beyond <em>BRCA</em></strong><br /> Ca. 15 % der OC sind auf eine Keimbahnmutation zurückzuführen, 2–8 % der Patientinnen weisen eine somatische<em> BRCA1/2-</em>Mutation auf.<sup>7, 8</sup> Unabhängig davon, ob es sich um eine Keimbahn- oder um eine somatische Mutation handelt, weisen <em>BRCA-</em>mutierte Karzinome eine erhöhte Platinsensitivität auf, die wiederum gegenüber <em>BRCA-</em>Wildtyp(Wt)-Tumoren zu einer Verlängerung des progressionsfreien Überlebens (PFS) führt.<sup>9</sup> Ebenso wird aufgrund des mutationsbedingten Funktionsverlusts der <em>BRCA-</em>Gene im Vergleich zu Wt-Tumoren ein besseres Ansprechen auf PARP-Inhibitoren beobachtet.<sup>10</sup><br /> <br /> Neben <em>BRCA 1</em> und <em>2</em> gibt es viele andere Gene, die Aberrationen aufweisen können. So wurden Analysen von <em>RAD50</em> durchgeführt, aus denen hervorgeht, dass die Anzahl der Deletionen Voraussagen über die Häufigkeit der Gesamtheit an Mutationen im Tumor zulässt: Gegenüber hypomutierten (wenigen) Mutationen gehen hypermutierte (viele) Mutationen mit einem längeren OS und PFS einher. <em>BRCA</em>-mutierte Karzinome zählen gemäß dieser Analyse zu den hypermutierten Tumoren.<br /> <br /> Gleichzeitig konnte bei OC-Zelllinien in vitro gezeigt werden, dass der Nachweis von <em>RAD50</em>-Deletionen auch bei <em>BRCA</em>-Wt mit einem erhöhten Ansprechen auf PARP-Inhibitoren assoziiert ist.<sup>11</sup><br /> <br /> In einer Analyse zur Sensitivität auf den in Entwicklung befindlichen PARP-Inhibitor Rucaparib konnte bestätigt werden, dass <em>BRCA 1</em> und <em>2</em> die bes­te Response aufweisen, aber auch <em>RAD51</em> oder die Gruppe der Fanconi-Anämie-Gene gehen mit einem hohen bzw. mittelstarken Ansprechen einher.<sup>12</sup> „Andere Gene, von denen wir uns viel erwartet haben, wie beispielsweise <em>JAK2</em>, spielen offenbar keine Rolle“, merkte Univ.-Prof. Dr. Chris­tian Marth, MU Innsbruck, dazu an (Abb. 2).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Gyn_1603_Weblinks_Seite16_1.jpg" alt="" width="575" height="460" /></p> <p><strong>PARP-Inhibition beim Mammakarzinom</strong><br /> Für die Effektivität von PARP-Inhibitoren beim <em>BRCA</em>-mutierten Mammakarzinom ist die Datenlage noch nicht so klar und konklusiv wie beim Ovarialkarzinom und zweifellos müssen noch einige weitere Studien durchgeführt werden, um ihren Stellenwert nachweislich zu bestätigen. Ein positives Beispiel für die Wirksamkeit der PARP-Inhibition in der Indikation Mammakarzinom liefert die Phase-II-Studie Study 8, in der rezidivierte <em>BRCA</em>-mutierte Patientinnen (50 % waren tripelnegativ), zu zwei verschiedenen Dosen von Olaparib randomisiert worden sind. Gruppe 1 erhielt Olaparib in der für das Ovarial-Ca zugelassenen Dosis von 400mg BID, Gruppe 2 erhielt 100mg BID: Bereits nach der Durchführung einer Interimsanalyse hatten die Patientinnen in Kohorte 2 die Möglichkeit, auf die 400mg-Dosierung zu switchen. Die Ergebnisse waren durchaus ermutigend: Obwohl die Patientinnen zum Teil massiv vortherapiert waren (im Median 3, maximal 5 Chemotherapielinien), konnte unter der Gabe von 400mg BID eine Tumorshrinkage im Ausmaß von bis zu 100 % erzielt werden, nur wenige Patientinnen wurden progredient (Abb. 3).<sup>13</sup></p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Gyn_1603_Weblinks_Seite16_2.jpg" alt="" width="578" height="480" /></p> <p>In der Phase-III-Studie OlympiA (NCT02032823) wird Olaparib erstmals im postneoadjuvanten bzw. postadjuvanten Setting an HER2-negativen Patientinnen mit dem Nachweis einer <em>BRCA</em>-Mutation untersucht. Die Randomisierung der geplanten 1.320 Teilnehmerinnen zum Erhalt von Olaparib 300mg BID bzw. Placebo für 12 Monate erfolgt im 1:1-Design.<br /> <br /> OlympiAD (NCT02000622) ist eine weitere Phase-III-Studie, in der die Effektivität von Olaparib bei <em>BRCA-</em>mutierten Patientinnen mit metastasiertem Mammakarzinom, die bereits mit einer Anthrazyklin- oder taxanhaltigen Chemotherapie vorbehandelt sind, untersucht wird. Die Patientinnen werden im 2:1-Design zu Olaparib (300mg BID bis zur Progression) bzw. einer Chemotherapie nach Wahl des Prüfarztes (Capecitabin, Vinorelbin oder Eribulin) randomisiert. „Die Ergebnisse dieser Studie werden eine Antwort auf die Frage liefern, ob Olaparib in diesem Setting eine zusätzliche Option im Rahmen des Therapiearmamentariums darstellen könnte“, ergänzte Prof. Marth.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> De Witte CJ et al: Gynecol Oncol 2015; 139: 377-384<br /><strong>2</strong> Grimm C et al: Obstet Gynecol 2012; 120: 152-159<br /><strong>3</strong> Rohen JW, Lütjen-Drecoll E: Funktionelle Embryologie. Die Entwicklung der Funktionssysteme. 4. Auflage. Stuttgart: Schattauer, 2012<br /><strong>4</strong> Quick CM et al: Modern Pathology 2012; 25: 449-455<br /><strong>5</strong> Mehra K et al: Front Biosci (Elite Ed) 2011; 3: 625-634<br /><strong>6</strong> Maritschnegg E et al: J Clin Oncol 2015; 33: 4293-4300 <br /><strong>7</strong> Romero I et al: Endocrinology 2012; 153: 1593-1602<br /><strong>8</strong> Ramus MJ et al: Mol Oncol 2009; 3: 138-150<br /><strong>9</strong> Hennessy BT et al: J Clin Oncol 2010; 28: 3570-3576<br /><strong>10</strong> Ledermann LA et al: Lancet Oncol 2014; 15: 852-861<br /><strong>11</strong> Zhang M et al: Gynecol Oncol 2016; 141: 57-64<br /><strong>12</strong> Kristeleit R: ESMO 2015; Oral Presentation<br /><strong>13</strong> Tutt A et al: Lancet 2010; 376: 235-244</p>
</div>
</p>