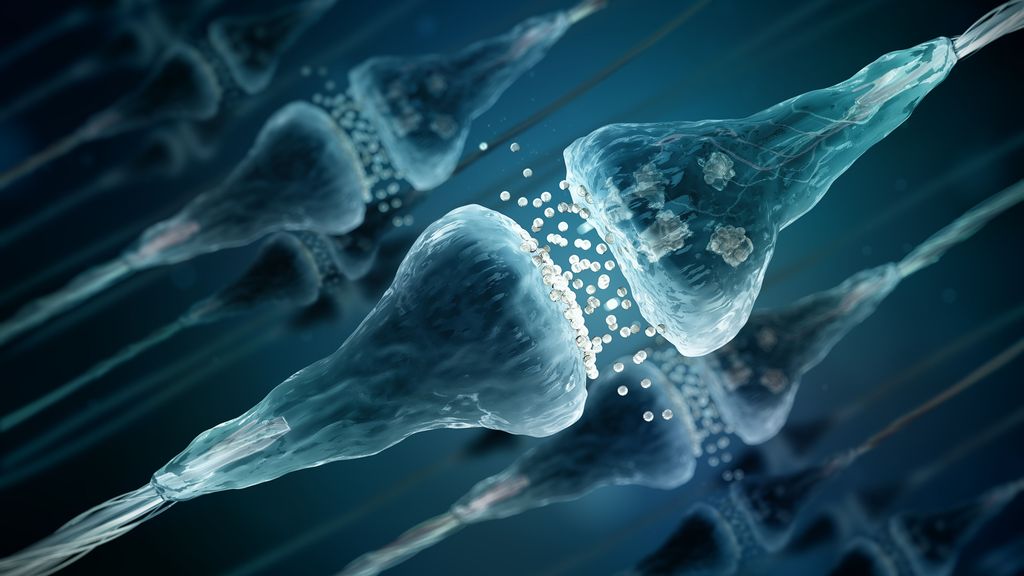
©
Getty Images/iStockphoto
Neue Studie bekräftigt Hyperurikämie als deutlichen Risikofaktor
Jatros
30
Min. Lesezeit
06.09.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Welchen Einfluss eine Hyperurikämie auf das Gehirn hat, wird kontrovers diskutiert. Einerseits soll Harnsäure neuroprotektiv wirken, andererseits weisen manche Studien auf ein erhöhtes Demenzrisiko durch zu viel Harnsäure hin. Eine neue longitudinale Studie scheint jetzt Klarheit zu bringen: Eine Hyperurikämie ist mit einem deutlich erhöhten Risiko für Demenz verbunden. Was das für die Praxis bedeutet, fragten wir den Alzheimer-Spezialisten Prof. Dr. Robert Perneczky aus München und den Rheumatologen Prof. Dr. Thomas Daikeler aus Basel.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Es ist die vernachlässigte Volkskrankheit: Unter einer Gicht leiden je nach Land zwischen 0,9 und 2,5 % der Bevölkerung.<sup>1–3</sup> Die europäischen und amerikanischen Leitlinien empfehlen, bei Gicht die erhöhte Harnsäure zu senken, jedoch nicht zu stark, denn Harnsäure solle neuroprotektiv<sup>4</sup> und antioxidativ<sup>5</sup> wirken. So zeigten denn auch Studien einen Zusammenhang zwischen einem niedrigen Harnsäurespiegel und neurodegenerativen Krankheiten wie Morbus Parkinson<sup>6</sup> oder amyotropher Lateralsklerose<sup>7</sup>. Umgekehrt ging ein erhöhter Harnsäurespiegel in manchen Studien mit einem verringerten Risiko für eine Demenz einher.<sup>8–10</sup> Die Assoziation zwischen einem niedrigen Harnsäurespiegel und neurodegenerativen Krankheiten wurde damit erklärt, dass Harnsäure ein natürliches Antioxidans ist, welches den oxidativen Stress reduziere und den schädlichen Effekten von freien Radikalen im Gehirn entgegenwirke.<sup>11–14</sup> Dieser Hypothese widersprechen aber andere Studienergebnisse. So konnten beispielsweise bei Patienten, die harnsäuresenkende Medikamente bekamen, keine Veränderungen bei den oxidativen Stressmarkern festgestellt werden.<sup>15</sup> In einer im vergangenen Jahr publizierten In-vitro- Studie erhöhte Harnsäure den oxidativen Stress und potenzierte die neurotoxischen Effekte von Amyloid in neuronalen Zellen. <sup>16</sup> Versuche, mit Inosin den Harnsäurespiegel im Serum und im Liquor zu erhöhen, um die „endogene Neuroprotektion“ zu fördern, schlugen fehl.<sup>17, 18</sup> Metaanalysen, die den Einfluss von Harnsäure auf das Demenzrisiko untersuchen, widersprechen einander.<sup>4</sup> Die meisten Studien waren Querschnittsstudien mit einem Risiko für Bias; es gab kaum longitudinale Untersuchungen. Auf der anderen Seite gab es Hinweise, dass erhöhte Harnsäurewerte zu funktionellen Hirnveränderungen und kognitiven Störungen führen können.<sup>19–22</sup> Der Zusammenhang bleibt also unklar. Nun zeigt eine französisch-spanische Forschergruppe um Augustin Latourte von der Universität Paris Diderot in einer großen longitudinalen Studie mit einer medianen Beobachtungszeit von 10,1 Jahren, dass eine Hyperurikämie offenbar doch mit einem deutlich erhöhten Demenzrisiko verbunden ist.<sup>23</sup> 598 durchschnittlich 72,4 Jahre alte Menschen in der Region Dijon wurden jährlich untersucht. 110 von ihnen entwickelten eine Demenz (8,2 auf 1000 Patientenjahre). Die Hazard-Ratio betrug 1,79 für hohe versus niedrige Serum-Harnsäure- Ausgangswerte (p=0,007). Die Assoziation schien bei vaskulärer oder gemischter Demenz stärker zu sein als bei Morbus Alzheimer.<br /><br /><strong> Herr Professor Daikeler, was stimmt denn nun: Erhöht zu viel Harnsäure das Risiko für eine Demenz oder nicht?<br /> T. Daikeler:</strong> Es scheint so zu sein, dass erhöhte Harnsäurewerte tatsächlich das Risiko erhöhen, vor allem für eine vaskuläre Demenz.<br /><br /><strong> Wie erklären Sie sich das?<br /> T. Daikeler:</strong> Wir wissen seit Längerem, dass Hyperurikämie und Gicht mit einer erhöhten kardiovaskulären Morbidität assoziiert sind.<sup>24</sup> Patienten mit Gicht erleiden häufiger Schlaganfälle und Herzinfarkte, auch wenn man andere Einflussfaktoren wie Hypertonus oder Diabetes herausrechnet.<br /><br /><strong> Warum ist das so?<br /> T. Daikeler:</strong> Hier gibt es bisher nur Hypothesen. Eine Hyperurikämie kann ein Grund für eine leichte systemische Entzündung sein – was man übrigens auch am erhöhten CRP der Patienten in dieser Studie sieht. Und der Arteriosklerose als Hauptrisikofaktor für Schlaganfälle und Herzinfarkte liegt ebenfalls unter anderem eine leichte chronische Entzündung zugrunde. Abgesehen davon wirkt sich Harnsäure ungünstig auf die endotheliale Funktion aus. Erhöhte Harnsäurewerte werden mit einer endothelialen Dysfunktion und mit verminderter Stickstoffoxidfreisetzung durch die Endothelzellen in Verbindung gebracht. Außerdem stimuliert Harnsäure die Proliferation der glatten Muskulatur in den Gefäßen.<br /><br /><strong> Wie gehen Sie bei erhöhten Harnsäurespiegeln zurzeit vor?<br /> T. Daikeler:</strong> Eine Indikation zur Therapie besteht zurzeit dann, wenn der Patient klinisch eine Gicht, also mindestens ein entzündetes Gelenk, und erhöhte Harnsäurespiegel von mehr als 360µmol/l hat. Die europäische Leitlinie empfiehlt, zur Schubprophylaxe den Spiegel auf unter 360µmol/l (<6mg/dl) zu senken, in manchen Fällen auf unter 300µmol/l (<5mg/dl), zum Beispiel, wenn ein Patient eine schwere Gicht mit Tophi, chronischen Arthropathien oder häufigen Attacken hat.<br /><br /><strong> In der Leitlinie heißt es, der Harnsäurespiegel sollte nicht unter 3mg/dl (ca. 180µmol/l) gesenkt werden. Wenn erhöhte Harnsäurespiegel das Risiko für eine Demenz erhöhen, wäre es dann nicht besser, die Spiegel so tief wie möglich zu senken?<br /> T. Daikeler:</strong> Studien weisen darauf hin, dass Harnsäure vor neurodegenerativen Krankheiten wie Parkinson, Alzheimer oder amyotropher Lateralsklerose schützen könnte.<sup>8–10</sup> Daher kam die Empfehlung, die Harnsäure nicht zu sehr zu senken.<br /><br /><strong> Aber widerspricht das nicht der neuen Studie?<br /> T. Daikeler:</strong> Vielleicht verhält es sich mit dem Demenzrisiko wie bei einer J-förmigen Kurve: Zu viel Harnsäure erhöht vor allem das vaskuläre Demenzrisiko, aber zu wenig ist auch nicht gut. Wir haben bisher aber noch zu wenige valide Daten, um hier eine eindeutige Aussage treffen zu können. Die Studien zu den neuroprotektiven Effekten von Harnsäure waren Kohortenbeobachtungen: Es wurde eine Assoziation nachgewiesen, was aber noch lange keine Kausalität bedeutet. Weil wir aber nicht ausschließen können, dass es nicht doch einen kausalen Zusammenhang zwischen zu niedrigen Harnsäurewerten und einem erhöhten Risiko für neurodegenerative Krankheiten gibt, hat die EULAR die Empfehlung ausgesprochen. Eines ist aber klar: Eine zu hohe Harnsäure schadet. Senken sollte man die Harnsäure bei entsprechender Klinik, die Frage ist nur, wie stark.<br /><br /><strong> Wie behandeln Sie konkret?<br /> T. Daikeler:</strong> Erste Wahl ist gemäß EULAR-Leitlinie Allopurinol. Wir starten mit 100mg pro Tag und erhöhen alle 2 bis 4 Wochen um 100mg, bis das Ziel erreicht ist. Wenn das Ziel mit adäquaten Dosen von Allopurinol nicht erreicht wird oder wenn der Patient es nicht verträgt, wechseln wir zu Febuxostat, das im letzten Jahr auch in der Schweiz zugelassen wurde, oder zu einem Urikosurikum wie Probenecid. Oder wir kombinieren Allopurinol mit einem Urikosurikum. Sinken die Harnsäurewerte unter 300µg/ml, reduzieren wir die Dosis.<br /><br /><strong> Bisher starten Sie eine Therapie, wenn der Patient eine Hyperurikämie und eine Gicht hat. Ist das nicht so, als würde man Lipidsenker erst dann geben, wenn der Patient erhöhte LDLWerte und einen Herzinfarkt hatte?<br /> T. Daikeler:</strong> In der Tat könnte die neue Studie für mich ein Argument sein, bereits eine Therapie anzufangen, wenn ein Patient „nur“ eine Hyperurikämie hat. Es wäre bei sehr hohen Harnsäurewerten eine Überlegung wert. Allerdings darf man die Nebenwirkungen nicht vergessen: Bei einem von zehn Patienten kommt es zu milden Nebenwirkungen wie Veränderungen im Blutbild oder bei den Leberwerten, bei einem von fünfzig zu allergischen Reaktionen. Leider haben wir bisher keine prospektiven kontrollierten Studien darüber, ob der Patient bereits davon profitiert, wenn man bei isolierter Hyperurikämie therapiert.<br /><br /><strong> Warum wird Gicht in der Forschung so stiefmütterlich behandelt?<br /> T. Daikeler:</strong> Immer noch haftet der Krankheit an, sie sei selbst verschuldet: „Leute mit Gicht haben beim Essen und Trinken über die Stränge geschlagen.“ Doch die Ernährung ist längst nicht mehr die häufigste Ursache. Gicht entsteht heute öfter, weil die Patienten die Harnsäure wegen einer Niereninsuffizienz nicht mehr ausscheiden können oder weil sie Medikamente nehmen, die die Ausscheidung der Harnsäure verhindern. Um wirklich zu erfahren, ob sich schon die Behandlung einer isolierten Hyperurikämie lohnt, bräuchte man eine große prospektive Studie, die jahrelang dauert. Ich frage mich, wer das finanzieren soll. Die Forschung ist hier aber dringend notwendig, denn eine isolierte Hyperurikämie ist wahrscheinlich gefährlicher, als wir dachten.<br /><br /><strong> Herr Professor Perneczky, wissen wir nach der neuen Studie jetzt mehr? Macht zu viel Harnsäure dement?<br /> R. Perneczky:</strong> Es häufen sich die Belege, dass Harnsäure nicht, wie man früher dachte, neuroprotektiv wirkt und dass hohe Harnsäurespiegel mit einem erhöhten Demenzrisiko einhergehen könnten.<br /><br /><strong> Warum zeigt die Studie plötzlich das Gegenteil von früheren Untersuchungen?<br /> R. Perneczky:</strong> Das liegt vor allem daran, dass die meisten der bisherigen Studien Daten nur im Querschnitt erhoben haben, was häufig zu einer Verfälschung der Ergebnisse führt. Die vorliegende, relativ große Studie hingegen beruht auf longitudinalen Daten mit einem durchschnittlichen Erhebungszeitraum von zehn Jahren. Mit diesem Studiendesign kann man gezielt das neue Auftreten von Demenzfällen überprüfen, in Querschnittsstudien lässt sich das nur rückblickend machen. Das geht immer mit einem Risiko für ein Bias einher.<br /><br /><strong> Welcher Mechanismus könnte erklären, dass Leute mit erhöhtem Harnsäurespiegel in der Studie ein höheres Risiko für eine Demenz hatten?<br /> R. Perneczky:</strong> Der Zusammenhang fand sich vor allem in der Gruppe der Patienten mit einer vaskulären Demenz, weniger bei denen mit Alzheimer. Allerdings muss man mit der Interpretation vorsichtig sein, denn insgesamt hatten nur 20 der 1598 Studienteilnehmer eine vaskuläre Demenz entwickelt – 76 eine Alzheimer-Demenz. Es könnte sein, dass eine Hyperurikämie das Risiko für eine vaskuläre Demenz erhöht, weil Harnsäure die Blutgefäße im Hirn schädigt. Andererseits könnte die vaskuläre Demenz durch eine gleichzeitige Arteriosklerose bedingt sein und die Harnsäure ist nur durch Zufall zur gleichen Zeit auch erhöht. Den kausalen Zusammenhang wird man aus so einer epidemiologischen Studie nicht erkennen können. Dafür bräuchte man eine randomisierte kontrollierte Studie.<br /><br /><strong> Früher war man eher davon ausgegangen, dass Harnsäure als Antioxidans wirkt und daher auch neuroprotektiv wirkt.<br /> R. Perneczky:</strong> Ja, bewiesen wurde diese Hypothese jedoch nie richtig. In der letzten Zeit häufen sich die Belege, dass Harnsäure nicht antioxidativ wirkt. Harnsäure könnte zum einen die Gefäße schädigen, zum anderen entzündliche Prozesse begünstigen, welche das Alzheimer- Risiko erhöhen. Dafür spricht, dass bei den Studienteilnehmern mit erhöhter Harnsäure auch das CRP als Entzündungsmarker erhöht war.<br /><br /><strong> Welche Schlüsse ziehen Sie aus der Studie: Soll man den Harnsäurespiegel mehr senken als bisher empfohlen, um eine Demenz zu vermeiden?<br /> R. Perneczky:</strong> Dafür reicht die Datenlage noch nicht. Die Ergebnisse müssen erst in anderen, populationsbezogenen Stichproben repliziert werden, bevor man das abschließend bewerten kann. Eine wesentliche Einschränkung der Studie ist, dass die Harnsäure im weiteren Verlauf nicht mehr bestimmt wurde. Es kann zum Beispiel sein, dass der Harnsäurespiegel mit Beginn der Alzheimer- Krankheit aus noch ungeklärten Gründen absinkt, was dann bei Querschnittsuntersuchungen danach aussehen würde, als ob niedrige Spiegel mit erhöhtem Demenzrisiko assoziiert wären. Was man bei all der Harnsäure-Diskussion nicht vergessen darf: Es gibt viele Faktoren, für die viel besser nachgewiesen ist, dass sie das Demenzrisiko erhöhen. Etliche davon sind durch eine Umstellung der Lebensgewohnheiten modifizierbar.<br /><br /><strong> Welche sind das?<br /> R. Perneczky:</strong> Die wichtigsten sind eine mediterrane Ernährung, ausreichend körperliche Aktivität, rege soziale Kontakte und lebenslange kognitive Stimulation. Besonders günstig ist es, diesen Lebensstil bereits als junger Mensch anzunehmen, es gibt jedoch auch Hinweise darauf, dass positive Verhaltensänderungen auch in höherem Alter noch vor Demenz schützen können. Außerdem darf man nicht vergessen, dass alles, was das Gefäßsystem schützt, auch vor Alzheimer schützt. Das heißt: nicht rauchen, wenig Alkohol, Blutdruck und Blutzucker gut einstellen und zu hohe Cholesterinwerte behandeln.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Bardin T et al.: Arthritis Care Res (Hoboken) 2016; 68: 261-6 <strong>2</strong> Trifirò G et al.: Ann Rheum Dis 2013; 72: 694-700 <strong>3</strong> Kuo CF et al.: Ann Rheum Dis 2015; 74: 661-667 <strong>4</strong> Khan AA et al.: Age 2016; 38: 16 <strong>5</strong> Maxwell SR et al.: Eur J Clin Invest 1997; 27: 484-90 <strong>6</strong> Shen L et al.: BMJ Open 2013; 3: e003620 <strong>7</strong> Abraham A, Drory VE: J Neurol 2014; 261: 1133-8 <strong>8</strong> Chen X et al.: PLoS One 2014; 9: e94084 <strong>9</strong> Hong JY et al.: Arthritis Res Ther 2015; 17: 139 <strong>10</strong> Lu N et al.: Ann Rheum Dis 2016; 75: 547-51 <strong>11</strong> Bowman GL et al.: J Alzheimers Dis 2010; 19: 1331-6 <strong>12</strong> Cervellati C et al.: J Neurol Sci 2014; 337: 156-61 <strong>13</strong> Hatanaka H et al.: Geriatr Gerontol Int 2015; 15(Suppl 1): 53-8 <strong>14</strong> Schrag M et al.: Neurobiol Dis 2013; 59: 100-10 <strong>15</strong> Hershfield MS et al.: Proc Natl Acad Sci U S A 2010; 107: 14351-6 <strong>16</strong> Desideri G et al.: J Cell Physiol 2017; 232: 1069-78 <strong>17</strong> Gonsette RE et al.: Mult Scler 2010; 16: 455-62 <strong>18</strong> Schwarzschild MA et al.: JAMA Neurol 2014; 71: 141-50 <strong>19</strong> Schretlen DJ et al.: Neuropsychology 2007; 21: 136-40 <strong>20</strong> Cicero AF et al.: Intern Emerg Med 2015; 10: 25-31 <strong>21</strong> Ruggiero C et al.: Dement Geriatr Cogn Disord 2009; 27: 382-9 <strong>22</strong> Beydoun MA et al.: J Alzheimers Dis 2016; 52: 1415-30 <strong>23</strong> Latourte A et al.: Ann Rheum Dis 2018; 77: 328-35 <strong>24</strong> Perez-Ruiz F et al.: Ann Rheum Dis 2014; 73: 177-82</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Blutbiomarker-Diagnostik in der klinischen Praxis: Anwendungsempfehlungen
Blutbasierte Biomarker (BBM) eröffnen neue Möglichkeiten für die frühzeitige Diagnostik der Alzheimererkrankung. Sie könnten die Identifikation von Patient:innen mit kognitiven ...
Optische Kohärenztomografie bei Multipler Sklerose – wie viel ist genetisch?
Mit der optischen Kohärenztomographie kann durch die Messung retinaler Schichtatrophie die neuroaxonale Schädigung bei Multipler Sklerose erfasst werden. Eine neue Studie gibt Einblick ...
APOE und Anti-Amyloid-Therapien: Genetik im klinischen Alltag
Mit der Zulassung der ersten krankheitsmodifizierenden Therapien hat ein Paradigmenwechsel in der Behandlung der Alzheimerkrankheit begonnen. Anti-Amyloid-Antikörper können den ...


