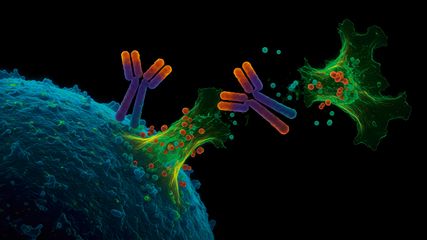Infektionen in der Schwangerschaft: Zikavirus, Parvovirus, CMV & Co
Bericht:
Reno Barth
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Das Thema viraler Schwangerschaftsinfektionen präsentiert sich wie ein Eisberg, so Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Lukas Weseslindtner, Zentrum für Virologie der Medizinischen Universität Wien. Hinter den sichtbaren Phänomenen verbirgt sich eine unsichtbare Zone, über die bislang wenig bekannt ist. Man nähert sich dem Thema also am besten über die Faktenlage.
1. Ein breites Spektrum an Viren kann intrauterin übertragen werden.
Hier sind vor allem die Herpesviren Varicella-zoster-Virus (VZV) und Zytomegalievirus (CMV) zu nennen. Beide Viren persistieren nach der Erstinfektion im Körper und können reaktivieren. Gegen VZV stehen eine aktive Impfung sowie Hyperimmunglobulin zur Verfügung,gegen CMV befinden sich potenzielle Impfungen in weit fortgeschrittenen Studienphasen.
Die VCV-Seroprävalenz liegt im gebärfähigen Alter in der Größenordnung von 90%, bei einer Reaktivierung (Herpes Zoster) besteht allerdings in der Regel keine Gefahr für eine intrauterine Übertragung. Bei CMV liegt die Seroprävalenz im gebärfähigen Alter abhängig von regionalen und sozioökonomischen Faktoren zwischen 40 und 90%. Bei Reaktivierung oder Reinfektion ist eine intrauterine Übertragung möglich. Mit rund 75% ist die Seroprävalenz von Parvovirus B19 (B19V) ebenfalls hoch, gegen das es keine Impfung gibt. Hier kann es vor allem im Rahmen der Primärinfektion zur intrauterinen Übertragung kommen. Wobei B19V-Infektionen bei Schwangeren in den Jahren 2023 und 2024 zugenommen haben. Gegen das Rubellavirus (Röteln) sollten in Österreich alle Frauen geimpft sein, tatsächlich bewegt sich die Seroprävalenz aber aufgrund von Impflücken zwischen 80 % und 90%. Ebenfalls intrauterin übertragen werden im Rahmen der Primärinfektion das Zikavirus und das Oropouchevirus, die allerdings in Europa vor allem ein reiseassoziiertes Problem darstellen.
2. Die Infektion mit diesen Viren bleibt oft asymptomatisch und die Symptome sind nicht spezifisch!
Nur bei der VZV-Infektion kommt es i.d.R. zu einer typischen Klinik („Feuchtblattern“). Bei den anderen für die Schwangerschaft relevanten Viren sind jedoch milde, oligosymptomatische Verläufe bzw. unspezifische Symptome häufig. So verursacht CMV nur in rund 10% der Fälle Symptome. Auch Röteln verlaufen bei 50% der Betroffenen asymptomatisch. Eine Diagnose bzw. Differenzialdiagnose ist allein anhand der Symptomatik daher oft nicht möglich. Zudem sind bei einigen Viren die Inkubationszeiten lang. Im Falle von VZV haben bereits zwei Virämiezyklen stattgefunden, bevor der charakteristische Ausschlag auftritt. Im Fall von Zika bleiben 60–80% der Infektionen asymptomatisch, Schädigungen des Fötus sind aber trotzdem möglich.
3. Die Mechanismen der intrauterinen Virusübertragung sind kompliziert und werden nicht zur Gänze verstanden!
Das individuelle Risiko für eine intrauterine Übertragung kann oft nicht exakt bestimmt werden! Je nach Virus kommt es eher durch eine fortschreitende Infektion der Plazentazellen oder durch eine direkte Infektion der fetalen Membranen zur Übertragung. Weiters kann eine Schädigung der Plazenta zu einer Schädigung des Fötus führen. Die genauen Mechanismen sind meist nicht im Detail geklärt, so Weseslindtner. Bei CMV wurde sogar immer wieder diskutiert, ob die Übertragung nicht erst durch unreife Antikörper ermöglicht wird. Bei Parvovirus B19 dürften sowohl Virusreplikation in den Endothelzellen der Plazenta als auch eine rezeptormediierte Transzytose im Spiel sein. Beim Oropouchevirus kommt es zu einer diaplazentaren Übertragung über eine Infektion der Plazenta.
4. Kongenitale Virusinfektionen kommen häufig vor!
Es ist ebenso schwierig, die genaue Inzidenz von Virusinfektionen in der Schwangerschaft in Österreich zu ermitteln (Klinik nicht eindeutig, Labordiagnose schwierig, keine Meldepflicht für viele Virusinfektionen). Wie häufig alleine CMV-Infektionen in der Schwangerschaft auftreten dürften, zeigt eine ältere Modellrechnung aus Großbritannien: Von insgesamt 1000 Schwangerschaften (und einer Seroprävalenz von 60%) kommt es bei 600 Seropositiven in 6 Fällen durch eine Reaktivierung während der Schwangerschaft zur Übertragung auf das Ungeborene (Übertragungsrate ca. 1%!). Bei den 400 Seronegativen kommt es insgesamt zu 7 CMV-Primärinfektionen (geschätzte Inzidenz: 1,75%), was durch die höhere Übetragungsrate zu 2–3 bei Geburt mit CMV-infizierten Kindern führt. Rechnet man das auf das gesamte Land hoch, so wären das bei rund 800000 jährlichen Geburten im UK 6000–8000 Kinder, die mit einer CMV-Infektion zur Welt kommen.1,2 In Österreich ist die Seroprävalenz vergleichbar, sodass angenommen werden kann, dass die britischen Daten auf Österreich übertragbar sind. Weseslindtner: „Wie erwähnt, waren die Jahre 2023 und 2024 durch zahlreiche B19V-Infektionen bei Schwangeren gekennzeichnet, wobei die B19V-Inzidenz starken saisonalen Schwankungen unterliegt.“
5. Die vertikale Übertragungsrate ist hoch. Besonders die Frühschwangerschaft ist die vulnerable Periode für eine intrauterine Übertragung!
Die Folgen einer Virusübertragung auf den Fötus sind potenziell schwerwiegend. Im Falle einer Primärinfektion mit CMV liegt die Übertragungsrate zwischen 25% und 75% (Median: 40%). Die kritische Periode liegt in der Frühphase der Schwangerschaft und endet in etwa zwischen den Schwangerschaftswochen 19 und 25. Mögliche Folgen einer intrauterinen CMV-Infektion sind Mikrozephalie, Mindergeburt, intrakranielle Verkalkungen und sensoneurinale Taubheit. Für Parvovirus B19 endet die kritische Periode etwa zwischen der 20. und 25. SSW. Mögliche Folgen einer Primärinfektion in der Schwangerschaft sind Abort, intrauteriner Fetaltod, fetale Anämie und Hydrops fetalis. Die Übertragungsrate von B19V liegt zwischen 30% und 50%.
Bei einer Primärinfektion mit VZV bestehen zwei kritische Perioden. Einmal bis zu circa der 21. SSW mit dem Risiko eines fetalen Varizellensyndroms und danach rund um die Geburt. Neonatale Varizellen weisen eine Mortalitätsrate von 30% auf. Die VZV-Übertragungsrate liegt bei ca. 25%.
Die höchste Übertragungsrate hat das Rötelnvirus mit 80% bis 90%. Die kritische Phase geht hier bis ungefähr zur 20. SSW. Typische Folge einer Virusübertragung auf das Kind ist das Gregg-Syndrom mit Taubheit, Katarakt und Herzfehler.
6. Fetale Virusinfektionen verursachen ein weites Spektrum von mitunter schweren Komplikationen. Diese können sich erst nach der Geburt manifestieren.
Daten zum Hörverlust infolge einer kongenitalen CMV-Infektion zeigen, dass das Risiko mit der Viruslast in Blut und Urin korreliert. Sowohl bei symptomatischen als auch asymptomatischen CMV-infizierten Kindern steigt die kumulative Inzidenz von Hörverlust in den ersten 72 Monaten nach der Geburt an.3,4Die Epidemiologie der vertikalen CMV-Infektion am Beispiel UK zeigt bei 688120 Lebendgeburten 0,3% kongenitale CMV-Infektionen, davon 12,7% symptomatisch bei Geburt. Von diesen Kindern entwickelten 44% einen Hörverlust. Unter den 87,3% der bei Geburt asymptomatischen Kindern kam es bei 15 zu Hörverlust. In beiden Gruppen war der Hörverlust zu 50% bereits neonatal manifest. Was andererseits bedeutet, dass neurologische Komplikationen zu einem Zeitpunkt auftreten können, zu dem die kongenitale Infektion kaum mehr nachweisbar ist. Weseslindtner sprach von einem „Heuschreckenschwarm schrecklicher Komplikationen“ durch die kongenitale CMV-Infektion. Sie reichen von vermindertem IQ und Lernbeeinträchtigungen unterschiedlichen Grades über Mikrozephalie, intrakranielle Verkalkungen, Thrombozytopenie mit Petechien bis zu Hepatitis oder Pneumonie. Das fetale Varizellensyndrom ist nicht harmloser – mit einer langen Liste möglicher neurologischer Defekte, Augenerkrankungen und/oder Beteiligung innerer Organe, Hypoplasie von Gliedmaßen oder Anomalien des Urogenital- oder Gastrointestinaltraktes. Auch postnatale Zoster-Episoden sind möglich.
Die Folgen von Zikavirusinfektionen während der Schwangerschaft wie Mikrozephalie, Hirnfehlbildungen, Verkalkungen, Wachstumsstörung und Augendefekte sind durch Medienberichte aus Brasilien bekannt. Das Risiko bei Infektion in der Schwangerschaft wird mit 1–30% angegeben und ist im 1. Trimenon höher als im späteren Verlauf der Schwangerschaft.
7. Die Möglichkeiten einer therapeutischen Intervention der intrauterinen Transmission sind überschaubar.
Eine Übertragung von CMV kann durch die Gabe von hoch dosiertem Valaciclovir mitunter vermieden werden – vorausgesetzt, die Infektion wird erkannt. Bei Kontakt einer Schwangeren mit VZV und negativem Antikörpertiter sollte eine Postexpositionsprophylaxe mit VZ-Immunglobulin innerhalb von 72 Stunden bis zu 10 Tagen erfolgen. Bei Erkrankung derMutter sollte die antivirale Therapie mit Aciclovir (oder einem Derivat) erfolgen. Bei Erkrankung fünf Tage vor bis zwei Tage nach der Geburt sollte das Neugeborene Immunglobulin erhalten. Bei anderen Viren wie dem Parvovirus B19 bestehen kaum Möglichkeiten einer medikamentösen Therapie gegen die Infektion. Hier hilft nur engmaschige Kontrolle des Fötus, bei Bedarf gefolgt von Maßnahmen wie einer intrauterinen Transfusion.
8. Routinelabortests (z.B. IgM-Antikörpertests) sind für die Diagnose von schwangerschaftsrelevanten Virusinfektionen oft nicht ausreichend!
Dies ist dadurch begründet, dass die Sensitivität und Spezifität von kommerziellen IgM-Antikörpertests sehr unterschiedlich sind. Zum einen bestimmt der Zeitpunkt nach Infektion stark, wie sensitiv ein Test ist (oft wird „zu früh“ auf IgM-Antikörper getestet), zum anderen kommt es bei manchen Tests häufig zu falsch positiven Ergebnissen, die besonders dann auftreten, wenn eine Infektion mit einem anderen Virus vorliegt (z.B. durch unspezifische Reaktivität oder Kreuzreaktivität der Antikörper). Zudem sind die Tests nicht harmonisiert, wodurch jeder einzelne Test für seinen spezifischen Einsatz evaluiert werden muss.
9. Die Labordiagnose von schwangerschaftsrelevanten Virusinfektionen ist kompliziert und sollte die Bestimmung des Infektionszeitpunktes einschließen!
In jedem Fall sofort eine PCR durchzuführen, ist aber auch nicht die Lösung. Das Problem der PCR liegt darin, dass die Infektion oft zu einem Zeitpunkt nachgewiesen werden soll, zu dem das Virus selbst noch nicht oder nicht mehr präsent ist. Daher sollten PCR und unterschiedliche Antikörpertests in einem spezialisierten Labor kombiniert eingesetzt werden, um die Infektion nachzuweisen und ihr Stadium zu bestimmen. Insbesondere mit Aviditätstests kann dabei bestimmt werden, wann eine Infektion stattgefunden hat. IgG-Avidität ist die Bindungsstärke, mit der polyklonale IgG-Antikörper spezifisch an antigene Epitope binden. Da die Avidität im Verlauf einer Infektion steigt, kann sie genützt werden, um Infektionen zu datieren.
10. Allein der Verdacht auf eine Virusinfektion stellt für betroffene Schwangere eine schwere seelische Belastung dar.
Weseslindtner: „Bei all diesen Tests dürfen wir nie vergessen, dass der beste Laborbefund nur so gut ist wie seine klinische Interpretation und dass hinter jedem dieser Tests eine schwangere Frau steht. Es ist erforderlich, dass wir im Zweifelsfall alles einsetzen, was wir haben, um sicherzugehen, ob tatsächlich eine Infektion vorliegt.“
Quelle:
„Schwangerschaftsrelevante Virusinfektionen: Zikavirus, Parvovirus, CMV und Co.“, Vortrag von Assoc.Prof. Priv.-Doz. Dr. Lukas Weseslindtner, Wien, im Rahmen des ÖIK am 21.März 2025 in Saalfelden
Literatur:
1 Dollard SC et al.: Rev Med Virol 2007; 17(5): 355-63 2 Kenneson A, Cannon MJ: Rev Med Virol 2007; 17(4): 253-76 3 Boppana SB et al.: J Pediatr 2005; 146(6): 817-23 4 Fowler KB et al.: J Pediatr 1999; 135(1): 60-4
Das könnte Sie auch interessieren:
HIV-Infektion im Alter: Was sind die Herausforderungen?
Dank des medizinischen Fortschritts ist HIV heute eine behandelbare chronische Erkrankung mit nahezu normaler Lebenserwartung. Immer mehr HIV-positive Menschen erreichen ein höheres ...
Mit Antikörpern gegen bakterielle Infektionen
In Zeiten zunehmender Antibiotikaresistenzen werden innovative Strategien gegen bakterielle Erreger dringend benötigt. Als eine der potenziellen Lösungen bieten sich therapeutische ...
Globale Statistik zu HIV/Aids: Ein Ende der Epidemie ist nicht in Sicht
Im Juli 2025 wurde von UNAIDS die globale HIV/Aids-Statistik für das Vorjahr veröffentlicht. Die Daten zeigen den grossen Handlungsbedarf auf und veranschaulichen Versäumnisse, die in ...