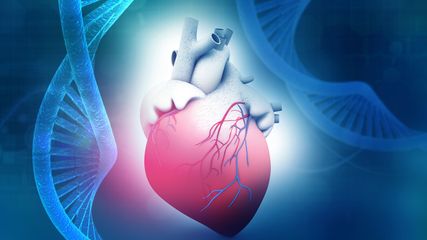©
Getty Images/iStockphoto
Strategien der Krankheitsbewältigung bei koronarer Herzkrankheit
Jatros
Autor:
OÄ Dr. Evelyn Kunschitz
Wiener Gebietskrankenkasse<br>Hanusch-Krankenhaus, Wien<br> 2. Med. Abteilung, Psychokardiologie-Schwerpunkt<br> E-Mail: evelyn.kunschitz@wgkk.at
30
Min. Lesezeit
31.05.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Ob im Krankenhaus, in Akutambulanzen oder in Ordinationen – wir begegnen vielen Personen, die erstmalig mit Krankheit, insbesondere mit koronarer Herzkrankheit, umgehen müssen. Je jünger die Patienten, desto eher ist dies auch die erste Erkrankung, durch die sie mit regelmäßiger Einnahme von Medikamenten, Abhängigkeit vom medizinischen System und Lebensstiländerungen konfrontiert werden. Dies stellt eine Herausforderung an ihr bisheriges Vertrauen in Körper und Psyche sowie für das soziale Umfeld dar.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Die Strategien zur Krankheitsbewältigung sind individuell und hängen von der subjektiven Krankheitstheorie ab.</li> <li>Sie orientieren sich sehr an Vorerfahrungen wie der Art und Schwere der Erkrankung, eigenen Bewältigungserfahrungen, Fremderfahrungen.</li> <li>Krankheitsbewältigung ist sinn- und hoffungsorientiert.</li> <li>Die Strategien bedürfen einer gemeinsamen Therapieplanung und Zielfindung sowie einer Ressourcenaktivierung und sozialer Unterstützung.</li> </ul> </div> <p>Frühe Beratung, Motivation und Rehabilitation erleichtern den Prozess der Krankheitsbewältigung, doch gelingt es nicht allen Patienten gleich zu Beginn ihrer Krankheit, zusätzliche Veränderungsschritte hinsichtlich der durch die akute Erkrankung plötzlich eintretenden Lebensveränderung zu setzen.<sup>1</sup> Der Begriff Krankheitsbewältigung, oder auch „Coping“ umfasst die Bemühungen erkrankter Menschen, die subjektiv erlebten inneren und äußeren Belastungen, welche im Rahmen der Erkrankung auftreten und mit ihr assoziiert werden, zu meistern. Er umfasst sowohl bewusste Prozesse wie handlungsbezogene Bewältigung (z.B. Ablenkung, aktive Informationssuche), kognitionsbezogene Bewältigung (z.B. Relativieren, Bagatellisieren, Problemanalyse) als auch unbewusste Abwehrbemühungen (z.B. Verleugnung, Verdrängung).<sup>2</sup><br /> Die wissenschaftlich unter verschiedenen Gesichtspunkten zusammengefassten häufigsten Krankheitsbewältigungsstile sind:</p> <ul> <li>verleugnender Bewältigungsstil</li> <li>sinnsuchender Bewältigungsstil</li> <li>aktiver Bewältigungsstil</li> <li>Suche nach sozialer Einbindung und sozialer Unterstützung</li> </ul> <h2>Krankheitsverarbeitungsprozesse</h2> <p>Diese Prozesse verlaufen nicht linear, sondern einander überspringend, sich abwechselnd, wiederholend oder auch parallel zueinander laufend. Das nachfolgend geschilderte Phasenmodell soll dem Verständnis dienen, in welcher Situation sich ein Patient gerade befindet.</p> <p><strong>Schock/Verleugnung</strong><br /> Die Konfrontation mit der Diagnose kann zu einem Schock, zu Unruhe, Angst und einem Verlust bewährter intellektueller Fähigkeiten führen. Häufig wird versucht, die Bedrohung mittels Verleugnung zu reduzieren. Dies führt zu einer Verlangsamung der Krankheitswahrnehmung und ermöglicht ein schrittweises Annehmen der Krankheit.</p> <p><strong>Aggression</strong><br /> Ungeduld, Ablehnung der Behandlungsangebote und noch mehr der „hilfreich“ gemeinten Ratschläge, Sinnfragen wie „Warum gerade ich?“ prägen diese Phase. Es besteht oft eine Verwicklungsgefahr durch Schuldzuweisungen und Projektion auf Behandler und Angehörige.</p> <p><strong>Depression</strong><br /> Aktuelle Funktionseinschränkungen, Veränderungen der sozialen Rolle, des Selbstbildes („Was bin ich noch wert?“), existenzielle Sorgen führen zu einer depressiven Phase. Patienten, die sich in dieser Phase befinden, scheinen ständig Hilfe zu fordern, sind aber nicht in der Lage, diese auch anzunehmen. Gerade jetzt braucht es eine aufrechterhaltene Beziehung, sodass die Patienten spüren können, dass ihre Depressivität als Reaktion auf die Erkrankung verstanden und auch akzeptiert wird.</p> <p><strong>Verhandeln</strong><br /> Hierbei wird nicht nur mit Ärzten verhandelt, sondern auch mit dem „Schicksal“. Lebenskonzepte müssen angesichts der Erfahrung von realer Todesdrohung neu definiert werden, und darüber die Kontrolle zu behalten stellt eine besondere Herausforderung dar.</p> <p><strong>Akzeptanz/Annehmen</strong><br /> In dieser Phase der Krankheitsverarbeitung kann die Erkrankung angenommen werden, neue Rollendefinitionen werden gefunden und in das weitere Lebenskonzept integriert.</p> <h2>Verfügbare Ressourcen</h2> <p>Dabei werden die persönlichen Ressourcen beansprucht. Individuelle Ressourcen sind bewusst oder unbewusst und hängen eng mit dem Selbstbild und dem Beziehungsverhalten zusammen. Soziale Ressourcen schöpfen Patienten vor allem aus emotionaler Unterstützung, aber auch aus der Verfügbarkeit therapeutischer Angebote. Forschungsergebnisse unterstreichen die wichtige Rolle der Arzt-Patienten-Beziehung bei der Krankheitsverarbeitung.<sup>3</sup> Die INTERHEART-Studie zeigte bereits den hohen protektiven Faktor der Kontrollüberzeugung. Das Konstrukt bezieht sich auf das Ausmaß, mit dem eine Person glaubt, dass das Auftreten eines Ereignisses abhängig vom eigenen Verhalten ist, ob also der Ort der Kontrolle innerhalb oder außerhalb des Individuums liegt.<sup>4</sup></p> <h2>Abwehrmechanismen</h2> <p>Natürliche Bewältigungsstrategien werden oft von Abwehrmechanismen gebremst, auch sie treten unbewusst oder bewusst auf. Beispiele dafür sind Verleugnung, Intellektualisierung und Projektion. Sie helfen, unerträgliche Affekte wie Angst, überschwemmende Wut oder Scham auf ein erträgliches Maß zu senken und damit Situationen zu kontrollieren. So findet man verleugnende Reaktionen, welche bewusst ablaufen, vor allem auf Intensivstationen, nach Herzinfarkten, welche als bedrohlich erlebt wurden, nach Eingriffen, welche die persönlichen Verarbeitungsmöglichkeiten überschritten haben.<br /> Während man bei Resignation, Selbstbeschuldigung, Hadern, persönlichem Rückzug und Bagatellisierung von einem depressiven Coping spricht, drückt sich aktives Coping durch die aktive Suche nach Information und Unterstützung, die Problemanalyse, das Relativieren von Risiken und sozialen Vergleichen aus. Optimismus, Selbstermutigung oder adaptive Ablenkung unterstützen diese Bewältigungsprozesse.<sup>5</sup></p> <h2>Anpassungsstörungen</h2> <p>Können Abwehrmechanismen nicht überwunden, belastende Situationen nicht oder nur mangelhaft verarbeitet werden und gelingt die Anpassung an die geänderten körperlichen, psychischen und sozialen Gegebenheit inadäquat, so sprechen wir von Anpassungsstörungen (Tab. 1). Diese können in unterschiedlichem Ausmaß auftreten und nehmen Einfluss auf den Krankheitsverlauf und die Mortalität.<sup>6</sup><br /> Neben protrahierter depressiver Verstimmung, anhaltenden, vor allem herzbezogenen Ängsten und Schlafstörungen, welche im Sinne von länger anhaltenden Anpassungsstörungen auftreten können, ist es wichtig, auch Zeichen einer posttraumatischen Belastungsstörung zu erkennen. Manche Patienten beschreiben Erinnerungslücken, eine erhöhte Schreckhaftigkeit, Hypervigilanz, Konzentrationsschwierigkeiten, Albträume und eine anhaltende Reizbarkeit. Zusätzlich sind einige Risikofaktoren für die Entwicklung einer posttraumatischen Belastungsstörung bekannt (Tab. 2).<sup>7, 8</sup></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Kardio_1702_Weblinks_ka1702-seite69_abb1+2.jpg" alt="" width="1414" height="1161" /></p> <h2>Genderspezifische Unterschiede</h2> <p>Es zeigen sich auch geschlechtsspezifische Unterschiede in der Krankheitsbewältigung. Frauen profitieren von sozialer Unterstützung, Zuhören und emotionslösungsorientierten Strategien. Nach einem Infarkt wie auch nach kardiovaskulären Eingriffen profitieren sie eher von geschlechtsspezifischen Therapieangeboten als Männer. Bei beiden Geschlechtern ermöglichen stressreduzierende Programme wie Entspannungsgruppen und themenzentrierte psychoedukative Therapieangebote eine Reduktion des Stresserlebens bei familiären und beruflichen Belastungen und eine deutliche Senkung von Ängsten.<sup>9</sup> In rehabilitativen Einrichtungen zeigen Männer weniger stark das Bedürfnis nach sozialer Unterstützung, profitieren eher von konkreten Ratschlägen und problemlösungsorientierten Strategien bezüglich Ernährung und Lebensstilmodifikation, aber auch von der Unterstützung durch die Partnerin.<sup>10</sup></p> <h2>Sozioemotionaler Rückhalt</h2> <p>„Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.“ (Definition von Gesundheit gemäß WHO, New York, 22. Juli 1946)<br /> Eine der grundlegenden Bedingungen von Gesundheit ist der sozioemotionale Rückhalt. Die Teilhabe an einem sozialen Netzwerk, das wechselseitige emotionale Wertschätzung und Vertrauen vermittelt. Rückhalt, auch in kritischen Situationen, wie auch die Bereitschaft, Wissen und Erfahrung zu teilen und Unterstützung in angemessener Qualität und Quantität zu erfahren, sind gesundheitsfördernd. Freundschaften, gute zwischenmenschliche Beziehungen und ein starkes, stützendes soziales Netz verbessern die Gesundheit zu Hause, am Arbeitsplatz und in der sozialen Gemeinschaft. Daher sind gruppentherapeutische Angebote und Rehabilitation in Zentren Einzelbehandlungen vorzuziehen. Lediglich Patienten mit einer mittelschweren bis schweren Depression brauchen mehr Einzelunterstützung, wogegen Ängstliche besonders von den sozialen Kontakten in der Rehabilitation profitieren.<br /> Die subjektiven Krankheitstheorien verweisen zu etwa 40 % auf einen krankheitsfördernden Lebensstil, ebenso viel wird allgemeinem und beruflich bedingtem Stress zugeschrieben und der Rest verweist auf die genetische Disposition und andere Faktoren. Im Bereich des Lebensstils liegen die subjektiven Ursachen beim Rauchen und bei der Fehlernährung, seltener wird Bewegungsmangel angegeben. So zeigt sich die Wichtigkeit, die subjektiven Krankheitstheorien in die Therapieplanung miteinzubeziehen und je nach Motivation der Patienten zu berücksichtigen und zu fördern. Einheitliche, strikt leitlinienorientierte Therapieprogramme greifen oft zu kurz und halten nicht länger als im streng kontrollierten Rahmen an. Ziel sei es jedoch, gesundheitsfördernde Veränderungen zu implementieren, welche auch nach der Phase-II-Rehabilitation greifen und eine anhaltende Wirkung entfalten können.<br /> Eine Metaanalyse aus 83 Studien ging der Frage des Einflusses von Optimismus und körperlicher Gesundheit auf die Krankheitsbewältigung nach. Eine optimistische Grundhaltung zeigte sich als signifikante Wirkungsvariable in Bezug auf kardiovaskuläre Erkrankungen.11 So konnte auch gezeigt werden, dass positive Affekte wie Optimismus, Freude, Angeregtheit, Wohlbehagen, Enthusiasmus und Glücksempfinden die kardiovaskuläre Mortalität bei Gesunden um 29 % reduzieren konnten.<sup>12</sup></p> <h2>Was können wir tun?</h2> <p><strong>Erkennen</strong><br /> Indem der biopsychosozialen Anamnese ein besonderer Stellenwert eingeräumt wird.</p> <p><strong>Benennen</strong><br /> Indem die Diagnose um subjektive Krankheitstheorie, Motivation zu Veränderung, psychosoziale Last erweitert wird.</p> <p><strong>Individuelle Strategien</strong><br />Diese sollen gemeinsam mit den Patienten entwickelt werden – Therapie als „shared decision“.</p> <p><strong>Bewusstmachen und verankern</strong><br />Psychosomatische und rehabilitative Maßnahmen können nur greifen, wenn sie in Aus- und Fortbildung sowie in der Gesundheitspolitik verankert sind.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Weibel L et al: Eur J Cardiovasc Nurs 2014; 15(4): 213-22 <strong>2</strong> Schüssler G; in: Leitfaden für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Deutscher Ärzteverlag 2006, 220ff <strong>3</strong> Muthny FA: Fragebogen zur Krankheitsverarbeitung. FKV 1996 <strong>4</strong> Yusuf S et al: L ancet 2 004; 3 64: 9 37-52 <strong>5</strong> Bardé B, Jordan J: Klinische Psychokardiologie. Frankfurt: Brandes & Apsel, 2015 <strong>6</strong> Ladwig KH et al: Der Kardiol 2013; 7(1): 7-27 <strong>7</strong> Gander M et al: Eur J C ardiovasc Prev Rehabil 2006, 13: 165-72 <strong>8</strong> Kubzansky LD et al: Health Psychol 2009, 28: 125-30 <strong>9</strong> Orth-Gomér K: Biopsychosoc Med 2012; 6(1): 5 <strong>10</strong> Hermann-Lingen C et al: Psychokardiologie. Köln: Deutscher Ärzteverlag, 2014, 100ff <strong>11</strong> Rasmussen HN et al: Ann Behav Med 2009; 37(3): 239-56 <strong>12</strong> Chida Y, Steptoe A: Psychosom Med 2008; 70(7): 741-56</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport
Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...
ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen
Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...
Inclisiran bei Patienten mit Statinintoleranz wirksam und sicher
Eine Analyse statinintoleranter Patienten aus dem Phase III Studienprogramm ORION zeigt, dass Inclisiran die LDL-Cholesterinspiegel kardiovaskulärer Hochrisikopatienten, die kein Statin ...