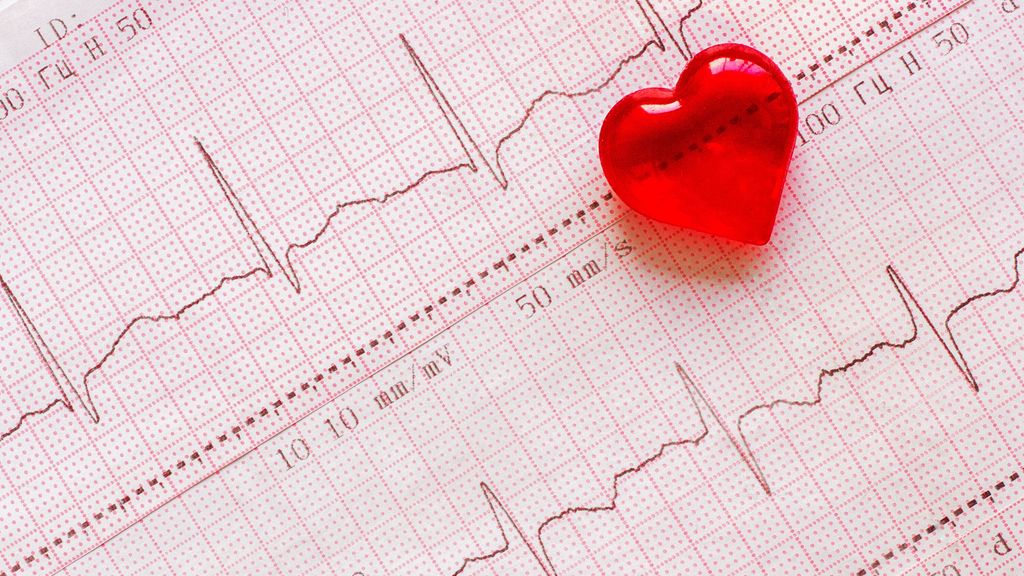
©
Getty Images/iStockphoto
Sinnvolle Unterstützung oder nettes Spielzeug?
Jatros
Autor:
Univ.-Prof. Dr. Gerhard Pölzl
Univ.-Klinik für Innere Medizin III,<br> Kardiologie und Angiologie<br> Medizinische Universität Innsbruck<br> E-Mail: gerhard.poelzl@tirol-kliniken.at
30
Min. Lesezeit
31.05.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die Anwendungsbereiche der Telemedizin sind vielfältig. In dieser Übersicht sollen der Einsatz und Stellenwert der Telemedizin in der Versorgung von Patienten mit Herzinsuffizienz allgemein und am Beispiel von HerzMobil Tirol im Speziellen diskutiert werden.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Telemedizin ist ein wertvolles Instrument und erleichtert die Betreuung von Patienten mit Herzinsuffizienz.</li> <li>Trotz zahlreicher Studien sind nach wie vor noch einige Fragen zu klären.</li> <li>Voraussetzung für den sinnvollen Einsatz von Telemedizin ist die Einbindung der Technologie in eine funktionierende Netzwerkversorgung.</li> </ul> </div> <p>Der Begriff Telemedizin umfasst den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie in der Medizin („eHealth“ – „electronic Health“). Die Anwendungsgebiete reichen von der Telekommunikation (elektronische Übermittlung von Überweisungen, Befunden und Leistungsanforderungen) über Telekonsultation (Fernbegutachtungen von Bildern und Gesundheitsparametern) und Teledokumentation (einrichtungsübergreifende elektronische Behandlungsdokumentation – ELGA) bis zu Telemonitoring und Telekooperation.</p> <h2>Telemonitoring („mHealth“ – „mobile Health“)</h2> <p>Dabei handelt es sich um ein Instrument zur Überwachung von Patienten in ihrer häuslichen Umgebung durch Übertragung von Biosignalen oder Messwerten.</p> <p><strong>Nicht invasives Telemonitoring</strong><br /> Dazu zählen der strukturierte Telefonkontakt zwischen Versorgern und Patienten sowie die Erhebung nicht invasiver Daten wie Blutdruck, Herzfrequenz, Gewicht oder Informationen zum körperlichen Wohlbefinden oder der Medikamenteneinnahme. Sämtliche Daten werden vom Patienten selbst erhoben und telemetrisch an den Versorger übermittelt.</p> <p><strong>Invasives Telemonitoring</strong><br /> Die Erhebung invasiver Daten zu Volumenstatus (OptiVol®) oder Herzrhythmus ist über implantierte Devices wie CRT oder ICD möglich. Invasive Druckwerte in der Pulmonalarterie können über einen implantierten Drucksensor (CardioMEMSTM HF System) kontinuierlich erhoben werden. Ebenso ist eine permanente Druckmessung im linken Vorhof möglich. Eine aktuelle Studie (LAPTOP-HF) mit diesem Device musste jedoch kürzlich wegen Sicherheitsbedenken abgebrochen werden.<br /> Die bisherigen Studienergebnisse zur Effektivität von Telemonitoring bezogen auf harte Endpunkte wie Krankenhausaufnahmen wegen akuter Herzinsuffizienz oder Mortalität sind nicht eindeutig. Während sich Untersuchungen zur invasiven Druckmessung (CHAMPION Trial) und Überwachung von Herzfrequenz und Rhythmus (IN-TIME) als höchst effektiv erwiesen haben, war das für die invasive Volumenmessung (DOT-HF, REM-HF, MORECARE) nicht der Fall. Das gilt auch für den ausschließlichen Telefonkontakt mit Patienten (TELE-HF). Dem steht eine signifikante Reduktion beider Endpunkte in großen Metaanalysen (Abb. 1) sowie einer Cochrane-Analyse gegenüber. Ebenso konnte die Kosteneffektivität des Telemonitorings bei Herzinsuffizienz gezeigt werden.<img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Kardio_1702_Weblinks_seite12_1.jpg" alt="" width="1234" height="1810" /></p> <p>Viele der bisher durchgeführten Studien beschränken sich auf das frühzeitige Erkennen einer sich anbahnenden Instabilität der Herzinsuffizienz in der Frühphase nach Entlassung aus dem Krankenhaus, um so eine zeitgerechte medikamentöse Intervention (z.B. Anpassung der Diuretikatherapie) zu ermöglichen. Für die mittel-/langfristige Effektivität sind jedoch die stetige Optimierung der evidenzbasierten Herzinsuffizienztherapie und eine gestärkte Eigenkompetenz des Patienten unabdingbar.</p> <p>Persönliche Erfahrungen im praktischen Umgang mit mit Telemonitoring bei Herzinsuffizienz zeigen, dass die Effektivität in erster Linie an die Einbindung dieser Technologie in eine funktionierende Netzwerkversorgungsstruktur (Disease-Management- Programm) gebunden ist. Nicht die Datenerhebung an sich, sondern erst die Umsetzung der erfassten Information in einer umfassenden Patientenversorgung ist für den Erfolg verantwortlich. Dieser Aspekt wird derzeit in einer groß angelegten Studie in Deutschland untersucht (TIM-HF II). Trotz oder gerade wegen der bereits vorliegenden Studienergebnisse sind noch eine Reihe von Fragen offen:</p> <ol> <li>Welche Parameter sollen erhoben werden? Sind invasiv gemessene Daten zu Hämodynamik und Volumenstatus aussagekräftiger als nicht invasive Daten? Ist die Kombination unterschiedlicher Informationen günstiger als die Erhebung von Einzelinformationen?</li> <li>Welche Patienten sollen überwacht werden und in welcher Phase? Soll die Überwachung auf instabile Patienten in der vulnerablen Phase nach einem Krankenhausaufenthalt beschränkt sein oder auch auf stabile Patienten ausgedehnt werden?</li> <li>Wie lange sollen Patienten überwacht werden? Ist die kurzfristige Erhebung (3–6 Monate) von Daten in der vulnerablen Phase ausreichend oder soll die Datenüberwachung auf Jahre, z.B. bei implantierten Devices, ausgedehnt werden?</li> <li>Inwieweit ist eine strukturierte Patientenschulung bzw. Erkrankungsprävention telemedizinisch machbar und sinnvoll?</li> </ol> <p>Diese und andere mit eHealth assoziierten Fragen werden in einem aktuellen Positionspapier der ESC angesprochen und sollen in den nächsten Jahren schrittweise abgearbeitet werden.</p> <h2>HerzMobil Tirol</h2> <p>HerzMobil Tirol ist ein integratives Versorgungsprogramm für Patienten nach akuter kardialer Dekompensation, bei dem ein nicht invasives Telemonitoringsystem in ein umfassendes Betreuungsnetzwerk eingebunden ist. Dieses Netzwerk umfasst neben Krankenhäusern niedergelassene Internisten und praktische Ärzte sowie geschulte Herzinsuffizienz- DGKS/P. Die PatientenbetreuerInnen auf den verschiedenen Versorgungsebenen sind durch ein gesichertes, internetbasiertes Kommunikationssystem (Telekooperation) verbunden (Abb. 2). Patienten erhalten vor der Entlassung und anlässlich eines Hausbesuchs eine eingehende krankheitsbezogene Schulung und werden mit einer Telemonitoringeinheit ausgestattet. Diese umfasst eine Waage und ein Blutdruckmessgerät sowie ein speziell konzipiertes Smartphone, welches durch eine ID-Karte aktiviert wird (kein Einwählen erforderlich!) und nach Annäherung an Waage und Blutdruckmessgerät Gewicht, Blutdruck und Herzfrequenz über eine „Near-field sensing“-Schnittstelle (kein Knopfdruck erforderlich!) an einen datengeschützten Server überträgt (Abb. 3). Patienten sind angehalten, diese Parameter täglich zu erheben und zu übermitteln. Dies kann bei Bedarf auch von Angehörigen übernommen werden. Über die Aktivierung von entsprechenden Symbolen erfolgt eine Information über die aktuelle Befindlichkeit. Zudem ist der Patient aufgefordert, die Einnahme der auf dem Handy gut ersichtlich dargestellten aktuellen Therapie täglich zu bestätigen.<br /> Einmal wöchentlich erfolgt die Übertragung einer grafisch aufbereiteten Datensammlung an den betreuenden Arzt. Über- oder unterschreiten die übertragenen Daten vorgegebene, individuelle Grenzwerte, wird dies vom zentralen Server automatisch erkannt und an den betreuenden niedergelassenen Arzt per SMS oder E-Mail weitergeleitet. Dieser kann unmittelbar über Telefon/SMS-Kontakt oder über Vermittlung durch die Herzinsuffizienz- DGKS/P mit einer Therapieanpassung, z.B. Anpassung der Diuretikadosis oder Optimierung der neurohumoralen Therapie, reagieren. Damit ist eine wohnortnahe Patientenversorgung möglich – „move the information, not the patient“.<br /> HerzMobil Tirol integriert die zentralen Elemente eines Disease-Management-Programms: Patientenschulung, welche die Eigenkompetenz von Patienten stärkt und damit die Nachhaltigkeit des Programms gewährleistet; Monitoring zum frühzeitigen Erkennen einer drohenden Dekompensation und damit Sicherstellung einer rechtzeitigen Intervention; kontinuierliche Therapiemodifikation/-optimierung zur längerfristigen Stabilisierung der Erkrankung.<br /> Die vom Austrian Institute of Technology (AIT) entwickelte Telemonitoringeinheit erfüllt die grundsätzlichen Anforderungen an ein derartiges Instrument. Sie gewährleistet eine effektive und für Patienten praktikable Signalübertragung. Relevante Daten werden automatisch erkannt und aufbereitet sowie in einem leicht interpretierbaren Format zur Verfügung gestellt. Im Hintergrund agieren kompetente Versorgungsstrukturen, die auf relevante Signale entsprechend reagieren. Und schließlich erfolgen eine effiziente Rückmeldung der notwendigen Intervention an den Patienten und die Überwachung der Interventionseffizienz, wodurch der Versorgungskreis geschlossen wird.<br /> Die Betreuung im HerzMobil-Tirol-Programm erfolgt für einen Zeitraum von drei Monaten nach der Krankenhausentlassung und kann bei Bedarf auf sechs Monate verlängert werden. Damit ist die vulnerable Phase der häufigsten Wiederaufnahmen abgedeckt. HerzMobil Tirol wurde auf Entschluss der Landeszielsteuerungskommission mit Beginn des Jahres 2017 im Bundesland Tirol in den Regelbetrieb übernommen. <img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Kardio_1702_Weblinks_seite12_2.jpg" alt="" /><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Kardio_1702_Weblinks_seite12_3.jpg" alt="" width="868" height="1078" /></p> <div id="fazit"> <h2>Zusammenfassung</h2> <p>Telemedizin ist ein wertvolles Instrument zur Steigerung von Effizienz und Kosteneffektivität in der Betreuung von Patienten mit Herzinsuffizienz. Trotz vieler Studien sind allerdings noch Fragen offen. Voraussetzung für den sinnvollen Einsatz von Telemedizin ist die Einbindung der Technologie in eine funktionierende Netzwerkversorgung. Seitens der Kostenträger ist eine entsprechende Remuneration notwendig.</p> </div></p>
Das könnte Sie auch interessieren:
ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport
Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...
ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen
Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...
Inclisiran bei Patienten mit Statinintoleranz wirksam und sicher
Eine Analyse statinintoleranter Patienten aus dem Phase III Studienprogramm ORION zeigt, dass Inclisiran die LDL-Cholesterinspiegel kardiovaskulärer Hochrisikopatienten, die kein Statin ...


