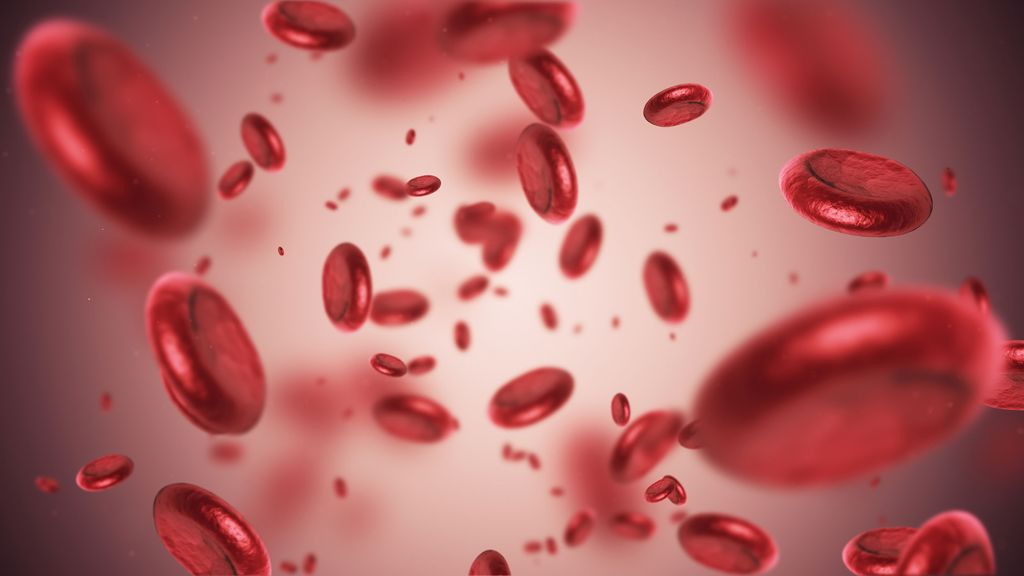
©
Getty Images/iStockphoto
Medikamentöse Therapie und Kardioversion
Jatros
Autor:
Assoc. Prof. Martin R. Martinek
Ordensklinikum Linz, Krankenhaus der Elisabethinen<br> E-Mail: martin.martinek@ordensklinikum.at
30
Min. Lesezeit
07.09.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die ESC Guidelines für das Management von Vorhofflimmern sind Ende 2016 überarbeitet worden. Die folgende Kurzzusammenfassung beschäftigt sich mit dem Abschnitt der medikamentösen Therapie und Kardioversion. Eingegangen wird auf die Aspekte der medikamentösen Frequenzkontrolle, der antiarrhythmischen Therapie sowie der Empfehlungen zur medikamentösen Kardioversion.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <p>1. Medikamentöse Frequenzkontrolle mit dem Ziel Symptomfreiheit:</p> <ul> <ul> <li>Betablocker und/oder Digitalis (bei LVEF >40 % alternativ Verapamil/ Diltiazem)</li> </ul> </ul> <p>2. Antiarrhythmische Therapie bei persistierender Symptomatik unter Frequenzkontrolle:</p> <ul> <ul> <li>keine oder minimale strukturelle Herzerkrankung: Dronedaron, Flecainid, Propafenon oder Sotalol</li> <li>koronare Herzerkrankung, signifikante Klappenvitien, Linksventrikelhypertrophie: Dronedaron, Sotalol oder alternativ Amiodaron</li> <li>Herzinsuffizienz: Amiodaron</li> </ul> </ul> <p>3. Medikamentöse Kardioversion ist der elektrischen Kardioversion laut Guidelines gleichgesetzt (außer für Notfälle mit hämodynamischer Instabilität):</p> <ul> <li>ohne strukturelle Herzerkrankung: Flecainid, Propafenon oder Ibutilid</li> <li>auch bei milder Herzinsuffizienz (NYHA I oder II) oder ischämischer Kardiomyopathie (ohne Hypotension oder Aortenklappenstenose): Vernakalant</li> <li>bei struktureller Herzerkrankung oder Herzinsuffizienz: Amiodaron</li> </ul> </div> <p>Gravierende Änderungen haben sich gegenüber den letzten ESC Guidelines von 2010 nicht ergeben, da die „neuen“ antiarrhythmischen Substanzen Dronedaron und Vernakalant bereits in das Guideline- Update 2012 eingearbeitet worden waren. Bedauerlicherweise sind seitdem keine weiteren innovativen Substanzen zur Zulassung gelangt, auch das in den USA verfügbare Dofetilid ist in Europa weiterhin nicht zugelassen. Die orale Antikoagulation wird in diesem Artikel nicht behandelt, sie folgt auch nach den Guidelines 2016 dem CHA<sub>2</sub>DS<sub>2</sub>-VASc-Score.</p> <h2>Medikamentöse Frequenzkontrolle</h2> <p>Seit den Ergebnissen des AFFIRM-Trials 2002 ist evident, dass die reine Frequenzkontrolle tendenziell sogar ein besseres Outcome erbringt als die Rhythmuskontrolle, deren Vorteile in Form des Sinusrhythmuserhalts um den Preis der Nachteile der antiarrhythmischen Therapie „erkauft“ werden müssen. Die Frequenzkontrolle ist bei vielen, vor allem älteren Patienten ein probates Mittel, um Symptomfreiheit zu erreichen. In den Guidelines 2016 wird zwar die akute Frequenzkontrolle von einer Langzeittherapie unterschieden, aufgrund der begrenzten Anzahl an Substanzen jedoch folgt die Therapie schlussendlich demselben Schema. Hier wird gemäß Empfehlung in eine Patientengruppe mit einer LVEF unter und eine mit LVEF über 40 % unterteilt: Bei LVEF unter 40 % stehen Betablocker und Digitalisglykoside zur Verfügung, bei einem Wert darüber zusätzlich Kalziumkanalblocker vom Nicht-Dihydropyridin-Typ. Diese Kalziumkanalblocker (Verapamil und Diltiazem) sind aufgrund ihrer negativ inotropen Effekte bei eingeschränkter LVEF kontraindiziert!</p> <p><strong>Akute Frequenzkontrolle</strong><br /> Die akute Frequenzkontrolle sollte mit Betablockern oder Verapamil/Diltiazem eingeleitet werden, da diese Substanzen im Vergleich zu Digitalis schneller und bei hohem Sympatikotonus besser wirken. Auch im akuten Setting wird ein moderates Herzfrequenzziel unter 110 pro Minute empfohlen, hier aber vom Patienten und von Symptomen, LVEF und Hämodynamik abhängig gemacht. Oft wird eine Kombinationstherapie aus Betablockern und Digitalis (bei HFrEF oder LVEF <40 % ) bzw. alternativ Verapamil/Diltiazem und Digitalis notwendig sein, wenn die Monotherapie alleine nicht zu einer ausreichenden Frequenzsenkung und Symptombesserung führt. Bei kritisch kranken Patienten oder schwerer Einschränkung der Linksventrikelfunktion kann i.v. Amiodaron überlegt werden, wobei bei hämodynamischer Instabilität eine akute Kardioversion indiziert ist.</p> <p><strong>Langzeittherapie</strong><br /> Auch in der Langzeittherapie zur Frequenzkontrolle stehen oben genannte Substanzen zur Verfügung. Wiederum sollten Betablocker oder Digoxin bei Patienten mit einer LVEF unter 40 % verwendet werden. Hier wird zusätzlich eine frühe Kombination dieser Substanzen in niedriger Dosis empfohlen. Bei einer LVEF ≥40 % sind Betablocker, Kalziumantagonisten und Digitalis „gleichberechtigt“ möglich, wobei mir persönlich eine Monotherapie mit Digitalis aufgrund der schwachen Wirksamkeit unter hohem Sympatikotonus für die meisten Patienten nicht sinnvoll scheint. Zusätzlich scheinen niedrige Digitalisspiegel eine bessere Prognose zu erbringen als hohe, welche teilweise eine erhöhte Mortalität gezeigt haben. Nach den Ergebnissen des RACE-Trials und gepoolter Analysen aus AFFIRM und RACE wird primär eine moderate Herzfrequenzsenkung unter 110 pro Minute in Ruhe empfohlen. Eine striktere Frequenzkontrolle sollte von der Symptomatik des Patienten abhängig gemacht werden. Amiodaron ist in der Frequenzkontrolle lediglich eine Reservesubstanz, wenn die oben genannten Kombinationstherapien keinen ausreichenden Effekt erbringen. Bei einem Versagen der frequenzregulierenden Therapie sollte auf die Alternative einer „ Ablate and pace“-Therapie nicht vergessen werden.</p> <h2>Antiarrhythmische Therapie</h2> <p>Da harte Endpunkte durch die antiarrhythmische Therapie nicht verbessert werden, ist diese indiziert, um Symptome des Vorhofflimmerns zu reduzieren. Gleichzeitig wird in den Guidelines 2016 hervorgehoben, dass die Wirksamkeit antiarrhythmischer Medikamente moderat ist und eher zu einer Reduktion als einer Elimination von Vorhofflimmern führt. Es ist bei Unwirksamkeit einer medikamentösen Therapie durchaus möglich, dass ein Alternativpräparat wirksam ist. Auch eine kurzzeitige antiarrhythmische Therapie (z.B. Flecainid für 4 Wochen) sollte – vor allem bei erstmaligem Vorhofflimmern – in Betracht gezogen werden, da sich die Wirksamkeit nicht massiv von einer Langzeittherapie unterscheidet. Da die Nebenwirkungsrate durchaus hoch ist, sollte sich die Auswahl der Medikation primär nach dem Sicherheitsprofil und erst danach nach der antiarrhythmischen Potenz orientieren.</p> <p>Die Guidelines 2016 unterscheiden in den Therapieempfehlungen drei Patientengruppen, wobei in jeder Gruppe Klasse- IA-Empfehlungen zu antiarrhythmischen Medikamenten und Klasse-IIaB-Empfehlungen für die Katheterablation ausgesprochen worden sind. In jeder dieser Gruppen soll die Entscheidung über medikamentöse Therapie oder Katheterablation nach der Patientenpräferenz fallen. Grundsätzlich haben alle randomisierten Studien bisher eine deutliche Überlegenheit der Katheterablation gegenüber der medikamentösen Therapie gezeigt. Hier müssen aber natürlich prozedurbezogene Komplikationen und die weiterhin unbefriedigenden Langzeitresultate mit den Nebenwirkungen einer medikamentösen Dauertherapie mit schwächerer Wirksamkeit aufgewogen werden. Eine Entscheidung zur Langzeittherapie mit Amiodaron sollte bei medikamentöser Therapiealternative nur als Second-Line-Therapie fallen.</p> <p><em>Gruppe 1 – keine oder minimale strukturelle Herzerkrankung:</em> Hier steht die gesamte Palette der Antiarrhythmika zur Verfügung: Dronedaron, Flecainid, Propafenon und Sotalol. Propafenon und vor allem auch Flecainid (aufgrund seiner vagolytischen Effekte) sollen zur Vermeidung von 1:1 übergeleitetem Vorhofflattern immer mit Betablockern oder Verapamil/Diltiazem kombiniert werden. Flecainid könnte potenziell bei Patienten mit vagal induziertem Vorhofflimmern Vorteile bieten.</p> <p><em>Gruppe 2 – koronare Herzerkrankung, signifikante Klappenvitien, Linksventrikelhypertrophie:</em> Hier sind Dronedaron, Sotalol oder alternativ Amiodaron möglich. Die „Bevorzugung“ von Sotalol aus dem letzten Guideline-Update ist zurückgenommen worden (Dronedaron gleichgestellt) und es wird explizit auf das proarrhythmische Risiko von Sotalol hingewiesen.</p> <p><em>Gruppe 3 – Herzinsuffizienz:</em> Hier steht lediglich Amiodaron zur Verfügung. Unbedingt sollte bei Patienten mit Herzinsuffizienz aufgrund einer Tachymyopathie die Ablation als First-Line-Therapie beachtet werden.<br /> Tabelle 1 zeigt die Dosisempfehlungen und EKG-Warnzeichen für proarrhythmische Effekte der einzelnen Substanzen (adaptiert nach: ESC Guidelines on atrial fibrillation 2016. Table 17).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Kardio_1703_Weblinks_kardio_1703_s35_tab1.jpg" alt="" width="1419" height="984" /></p> <h2>Medikamentöse Kardioversion</h2> <p>Für die akute pharmakologische Kardioversion stehen grundsätzlich fünf Substanzen zur Verfügung:</p> <p><strong>Flecainid und Propafenon</strong><br /> Flecainid und Propafenon können bei Patienten ohne strukturelle Herzerkrankung (i.v. oder oral) eingesetzt werden und haben den Vorteil, dass sie bei gutem Ansprechen auch als „Pill in the pocket“- Therapie weiterverschrieben werden können. Oral sollten bei Flecainid als erste Dosis 200–300mg bzw. bei Propafenon 450–600mg verabreicht werden. Bei i.v. Gabe wird bei beiden Substanzen eine Dosierung von 1,5–2mg/kg über 10 Minuten empfohlen.</p> <p><strong>Ibutilid</strong><br /> Ibutilid ist ebenso eine Alternative bei Patienten ohne strukturelle Herzerkrankung, ohne QT-Verlängerung und ohne Hypokaliämie, birgt aber ein höheres Risiko für Torsades-de-Pointes-Tachykardien (3–4 % ). Hier sollte 1mg/kg über 10 Minuten verabreicht werden und bei fehlendem Ansprechen nach 10 Minuten dieselbe Dosis wiederholt werden.</p> <p><strong>Vernakalant</strong><br /> Als neuere Therapie steht seit einiger Zeit Vernakalant i.v. zur Verfügung, das als selektiv atrial wirksame Substanz auch bei milder Herzinsuffizienz (NYHA I oder II) oder ischämischer Kardiomyopathie verabreicht werden darf, wenn keine Hypotension oder schwere Aortenklappenstenose besteht. Diese Substanz ist für postoperatives oder kurz anhaltendes Vorhofflimmern von weniger als 7 Tagen zugelassen. Die Verabreichung erfolgt i.v. mit einer Dosierung von 3mg/kg über 10 Minuten, mit einer zweiten Dosis von 2mg/kg und bei Nichtansprechen nach 15 Minuten.</p> <p><strong>Amiodaron</strong><br /> Bei struktureller Herzerkrankung oder Herzinsuffizienz bleibt als Alternative Amiodaron. Hier ist bei i.v. Gabe primär ein frequenzregularisierender Effekt zu erwarten, eine Kardioversion erst nach ca. 8–12 Stunden. Als Erstdosis sollen 5–7mg/kg über 1–2 Stunden, danach 50mg/h bis zu einem Maximum von 1g pro Tag gegeben werden.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>Kirchhof P et al.: 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J 2016; 37: 2893-2962</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport
Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...
ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen
Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...
Inclisiran bei Patienten mit Statinintoleranz wirksam und sicher
Eine Analyse statinintoleranter Patienten aus dem Phase III Studienprogramm ORION zeigt, dass Inclisiran die LDL-Cholesterinspiegel kardiovaskulärer Hochrisikopatienten, die kein Statin ...


