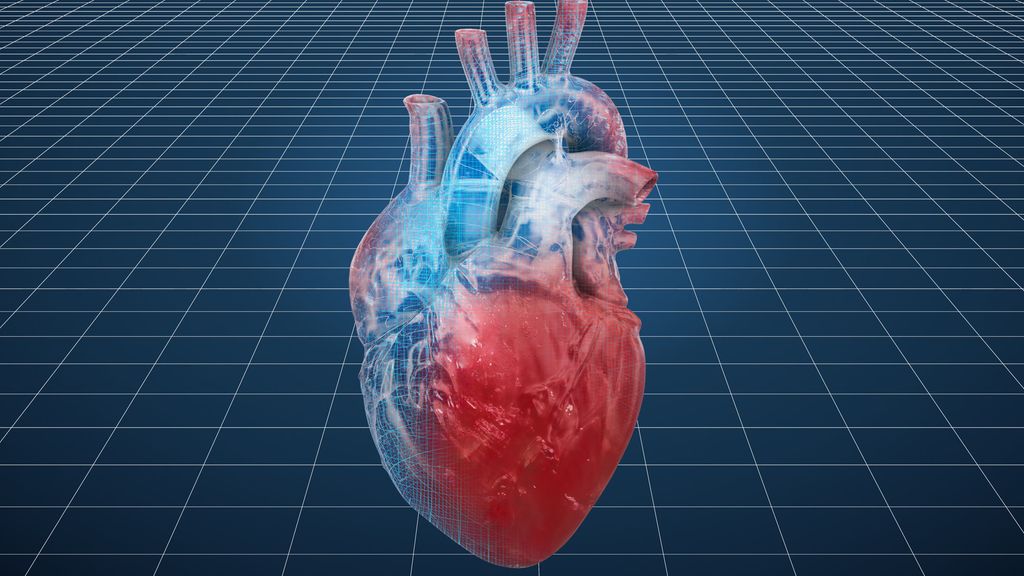<p class="article-intro">Die erfolgreiche Wiedereröffnung verengter Koronararterien beim Menschen mittels eines arteriell eingeführten Ballonkatheters wurde erstmalig 1977 durch Andreas Grüntzig durchgeführt. Häufige Komplikationen dieser Technik waren akute Gefässverschlüsse und das Auftreten hochgradiger Dissektionen, sodass in Ermangelung einer doppelten Plättchenhemmung die sog. Stents, also Gefässstützen aus Metall («bare metal stents», BMS), entwickelt wurden. Die BMS konnten diese Komplikationen zuverlässig verhindern, führten aber zu Restenosen, weshalb sich in der Folge die medikamentenbeschichteten Stents («drug-eluting stents», DES) durchsetzen konnten, welche die Häufigkeit von In-Stent-Restenosen stark reduzieren, in einem kleinen Prozentsatz aber zu akuten Gefässverschlüssen durch Gerinnsel führen. Diese Probleme sind bei kleinen Gefässen besonders ausgeprägt, sodass hier eine neue Technik in den Fokus tritt, welche bei anderen Indikationen schon erfolgreich angewandt wurde: die medikamentenbeschichteten Ballonkatheter.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Medikamentenbeschichtete Ballonkatheter («drug-coated balloons», DCB) sind bereits seit einigen Jahren eine therapeutische Option für die Behandlung von In-Stent-Restenosen.</li> <li>In nativen Koronararterien waren medikamentenbeschichtete Stents («drug-eluting stents», DES) bislang die einzige Behandlungsoption. Allerdings zeigen diese Stents, insbesondere in Koronararterien mit einem geringen Gefässdurchmesser, eine hohe Rate an In-Stent-Restenosen.</li> <li>Die Studie BASKET-SMALL 2 konnte zeigen, dass der medikamentenbeschichtete Ballon dem medikamentenbeschichteten Stent bezüglich klinischer Endpunkte nach einem Jahr nicht unterlegen ist (sog. «noninferiority »).</li> <li>DCB stellen somit eine sichere und effektive Alternative zu DES in Koronararterien mit kleinem Durchmesser dar und bieten zusätzlich die Möglichkeit einer kürzeren Dauer der dualen Thrombozytenaggregationshemmung bei Patienten mit stabiler koronarer Herzkrankheit.</li> </ul> </div> <p>Die medikamentenbeschichteten Ballonkatheter («drug-coated balloons», DCB) wurden in den letzten 10 Jahren zur Behandlung von In-Stent-Restenosen entwickelt und haben für diese Indikation mittlerweile eine Klasse-IA-Empfehlung der neuesten Guidelines der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) erhalten.<sup>1</sup> In-Stent-Restenosen sind mit der Entwicklung von DES zwar seltener geworden; leider kommt es aber immer noch bei bis zu 10 % der Fälle nach Stentimplantationen zu einer Stenosebildung im Stentlumen, wobei gerade Koronararterien mit einem geringen Gefässdurchmesser häufiger davon betroffen sind.<sup>2</sup> Die DCB als Weiterentwicklung der herkömmlichen Ballonkatheter sind auf der Oberfläche mit einem antiproliferativen, lipophilen Wirkstoff beschichtet, der am Ort der Stenose rasch und direkt in die Gefässwand abgegeben wird.<sup>3</sup> Gegenüber einem DES hat ein DCB den Vorteil, dass keine zweite Metallstütze implantiert werden muss und die duale Thrombozytenaggregationshemmung über eine kürzere Zeitspanne verabreicht werden kann. Bisher fehlten allerdings noch valide Daten in Bezug auf die Anwendung von DCB in nativen Koronargefässen, insbesondere im Hinblick auf die Effektivität und Sicherheit.<sup>4, 5</sup></p> <h2>BASKET-SMALL 2: DCB versus DES</h2> <p>Die Studie «Basel Kosten-Effektivitäts Trial – Drug Coated Balloons versus Drug Eluting Stents in Small Vessel Interventions 2» (BASKET-SMALL 2) untersuchte nun die Effektivität und Sicherheit der Anwendung der DCB gegenüber den DES an einem grossen Patientenkollektiv mit Verengungen in kleinen Koronargefässen und wurde als «Late-breaking Trial» am diesjährigen Kongress der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie in München präsentiert.<sup>6</sup> Es handelt sich um eine prospektiv- randomisierte, multizentrische Open-label-Studie, die in 14 Studienzentren in der Schweiz, Deutschland und Österreich durchgeführt worden ist.<sup>6, 7</sup> Eingeschlossen wurden erwachsene Patientinnen und Patienten mit einer Indikation für eine perkutane koronare Intervention (akutes Koronarsyndrom, stabile Angina pectoris oder asymptomatische Ischämie) und einer Stenose in einem Gefäss mit einem Durchmesser von</p> <p>Zwischen April 2012 und Februar 2017 konnten 883 Patienten in die Studie eingeschlossen werden, wovon schliesslich 758 (86 % ) randomisiert werden konnten; 382 Patienten wurden der DCB-Gruppe zugeordnet und 376 Patienten der DES-Gruppe. In Bezug auf demografische Daten, Vorerkrankungen, kardiovaskuläre Risikofaktoren und Indikation für die Koronarintervention waren beide Gruppen sehr ausgeglichen. Die Häufigkeit des primären Endpunktes innerhalb von 12 Monaten betrug 7,3 % in der DCB-Gruppe und 7,5 % in der DES-Gruppe (Hazard-Ratio [HR]: 0,97; 95 % CI: 0,58–1,64; p=0,918). Die Differenz zwischen den beiden Gruppen betrug lediglich 0,0005 (95 % CI: 0,038–0,039), womit die Nichtunterlegenheit von DCB gegenüber DES gezeigt werden konnte (Abb. 1 und 2). Die Rate an kardiovaskulärem Tod (12 Patienten [3,1 % ] in der DCB-Gruppe gegenüber 5 Patienten [1,3 % ] in der DES-Gruppe [HR: 2,33; 95 % CI: 0,82–6,61; p=0,113]) war ebenfalls vergleichbar in beiden Gruppen. Auch weitere Subgruppenanalysen bezüglich eines Myokardinfarktes (1,6 % versus 3,5 % ; HR: 0,46; 95 % CI: 0,17–1,20; p=0,112) und Revaskularisation in derselben Koronararterie (3,4 % versus 4,5 % ; HR: 0,75: 95 % CI: 0,36–1,55; p=0,438) zeigten keine signifikanten Unterschiede. Auch Subgruppenanalysen im Hinblick auf Geschlecht, verwendeten Stenttyp, Stentlänge, Alter, Diabetes, Niereninsuffizienz, akutes Koronarsyndrom bei Präsentation versus stabile koronare Herzkrankheit (KHK) oder koronare Ein- versus Mehrgefässerkrankung brachten keine signifikanten Unterschiede zutage (Abb. 3). Insgesamt zeigte die Studie BASKET-SMALL 2 als grosse multizentrische Interventionsstudie damit deutlich die Nichtunterlegenheit von DCB gegenüber DES in nativen Koronararterien mit kleinem Durchmesser.<sup>6</sup> Zwölf Monate nach der initialen Behandlung war bezüglich der Häufigkeit des primären Studienendpunktes kein relevanter Unterschied zwischen Ballonund Stentbehandlung auszumachen, womit die vor Beginn der Studie festgelegten Kriterien für den Nachweis der Nichtunterlegenheit erfüllt waren.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Leading Opinions_Innere_1806_Weblinks_s54_abb1.jpg" alt="" width="1421" height="857" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Leading Opinions_Innere_1806_Weblinks_s54_abb2.jpg" alt="" width="1418" height="1362" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Leading Opinions_Innere_1806_Weblinks_s54_abb3.jpg" alt="" width="1601" height="1224" /></p> <h2>DCB: gute Alternative für kleine Koronargefässe</h2> <p>Das Mittel der Wahl zur Offenhaltung von zuvor stenosierten Koronargefässen waren bisher die DES, wobei in kleinen Koronararterien die damit erzielten Ergebnisse nicht so gut sind wie in grösseren Gefässen. Da mit zunehmender Häufigkeit von Diabetes mellitus auch die Stenosen in kleinen Herzkranzgefässen immer häufiger vorkommen, besteht die Notwendigkeit zur Entwicklung einer neuen Methode. Die DCB als Weiterentwicklung des herkömmlichen Ballonkatheters sind auf der Oberfläche mit einem antiproliferativen Wirkstoff beschichtet, der am Ort der Stenose direkt in die Gefässwand abgegeben wird. Während die DCB bislang nur zur Behandlung von koronaren In-Stent-Restenosen benutzt wurden, können durch die nun vorliegenden Daten die DCB künftig auch in der Behandlung von Koronarstenosen in kleinen, nativen Koronargefässen als Alternative zur Stentimplantation in Betracht gezogen werden.<sup>8</sup> Dafür zwingend erforderlich ist aber eine adäquate Läsionspräparation durch Prädilatation, um schon vor der Behandlung mit DCB ein optimales angiografisches Ergebnis zu erzielen. Damit eine adäquate Aufnahme der pharmakologisch aktiven Substanz gewährleistet ist, muss ein möglichst reibungsfreier Kontakt des Ballons zur Gefässwand möglich sein, sodass der Wirkstoff zum grösstmöglichen Prozentsatz an die Gefässwand abgegeben werden kann. Gerade bei stark verkalkten Gefässen ist die Läsionspräparation besonders herausfordernd, aber immens wichtig für den Behandlungserfolg. Ein wichtiges Argument für die DCB ist, dass das Gefäss die Möglichkeit zur Eigenregeneration erhält. Das «Remodelling» der Gefässe aus eigener Kraft kann sogar die Durchblutung des Herzmuskels verbessern. Ein zusätzlicher Vorteil der DCB gegenüber den DES ist, dass bei stabiler KHK die Dauer der dualen Thrombozytenaggregationshemmung auf 4 Wochen verkürzt werden kann.<sup>1, 9</sup></p> <div id="fazit"> <h2>Fazit</h2> Zusammengefasst hat die Studie BASKET-SMALL 2 gezeigt, dass eine stentfreie Behandlung von nativen Koronararterien mit kleinem Durchmesser mittels DCB eine sichere und effektive Methode darstellt, wobei die DCB in Bezug auf die Rate von unerwünschten kardiovaskulären Ereignissen innerhalb eines Jahres mit DES vergleichbar sind. Die Langzeitdaten der Studie BASKET-SMALL 2 werden mit Spannung erwartet, da bisherige Studien jeweils einen erheblichen Vorteil der DCB gegenüber den DES gezeigt haben.</div></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Windecker S et al.: 2014 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization: The Task Force on myocardial revascularization of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Developed with the special contribution of the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI). Eur Heart J 2014; 35: 2541-619 <strong>2</strong> Schunkert H et al.: Implications of small reference vessel diameter in patients undergoing percutaneous coronary revascularization. J Am Coll Cardiol 1999; 34: 40-8 <strong>3</strong> Alfonso F, Scheller B: State of the art: balloon catheter technologies - drug-coated balloon. EuroIntervention 2017; 13: 680-95 <strong>4</strong> Cortese B et al.: Paclitaxelcoated balloon versus drug-eluting stent during PCI of small coronary vessels, a prospective randomised clinical trial. The PICCOLETO study. Heart 2010; 96: 1291-6 <strong>5</strong> Latib A et al.: A randomized multicenter study comparing a paclitaxel drug-eluting balloon with a paclitaxel-eluting stent in small coronary vessels: the BELLO (Balloon Elution and Late Loss Optimization) study. J Am Coll 2012; 60: 2473- 80 <strong>6</strong> Jeger RV et al.: Drug-coated balloons for small coronary artery disease (BASKET-SMALL 2): an open-label randomised non-inferiority trial. Lancet 2018; 392: 849- 56 <strong>7</strong> Gilgen N et al.: Drug-coated balloons for de novo lesions in small coronary arteries: rationale and design of BASKET-SMALL 2. Clin Cardiol 2018; 41: 569-75 <strong>8</strong> Ho HH, Ong PJL: BASKET-SMALL 2: advancing DCB beyond instent restenosis. Lancet 2018; 392: 802-4 <strong>9</strong> Neumann F-J et al.: 2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. Eur Heart J 2018 [epub ahead of print]</p>
</div>
</p>