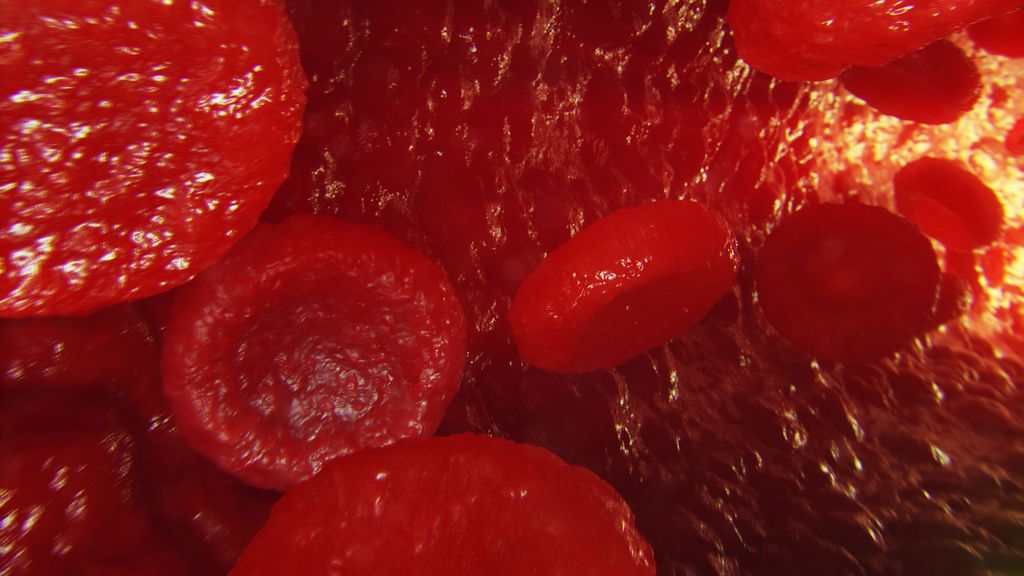
©
Getty Images/iStockphoto
(Leistungs-)Sport mit kardialen Devices?
Jatros
Autor:
Dr. David Niederseer, PhD, BSc
Universitäres Herzzentrum Zürich, Klinik für<br> Kardiologie, Universitätsspital Zürich<br> E-Mail: david.niederseer@usz.ch
30
Min. Lesezeit
23.02.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Durch die Verbesserung der Funktionalität und Ausweitung der Indikationsstellung der kardialen Devices – Herzschrittmacher, implantierbarer Cardioverter-Defibrillator (ICD) oder kardiale Resynchronisationstherapie (CRT) – ist die Zahl der kardialen Deviceträger in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Betreuende Ärzte werden häufig mit folgender Frage konfrontiert: Darf ich das machen? Spätestens seit dem medienwirksamen Wiedereinstieg in den Wettkampfsport von Athleten mit kardialen Devices, wie z.B. Daniel Engelbrecht, stellt sich aber nicht nur die Frage nach dem Alltagssport mit kardialen Devices, sondern auch jene nach dem Leistungssport. In Bezug auf (Leistungs-)Sport soll im Folgenden eine Hilfestellung zur Beantwortung dieser Fragen gegeben werden.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Anzahl und Anspruch von kardialen Deviceträgern steigt durch Ausweitung der Indikationen und verbesserte Funktionalität der Devices.</li> <li>Sport kann in den allermeisten Fällen von Schrittmacher- und ICD-Patienten sicher und freudvoll durchgeführt werden.</li> <li>Eine genaue individuelle Beratung unter Berücksichtigung der Grunderkrankung und der sportartspezifischen Charakteristika sollte erfolgen.</li> <li>Registerdaten legen nahe, dass in der Vergangenheit die eher restriktive Haltung in Bezug auf Sport mit Devices eher überzogen war und dass – unter Einhaltung gewisser Grundsätze – der Großteil der Sportarten und – in noch engeren Grenzen – auch Leistungssport für Deviceträger möglich zu sein scheinen.</li> </ul> </div> <p>Insbesondere von jüngeren Patienten werden betreuende Ärzte immer wieder gefragt, welche sportliche Aktivität in welcher Intensität (noch) erlaubt ist. Die aktuellen Leitlinien geben für individuelle Anfragen von Patienten nur unzureichende Informationen. Die European Society of Preventive Cardiology veröffentlichte 2006 Leitlinien für die Sportausübung von Schrittmacher-/ICD-Patienten, die zusammengefasst folgende Empfehlungen vorschlägt:</p> <ul> <li>Grunderkrankung beachten,</li> <li>Frequenzregulation beachten (Tachykardien),</li> <li>niedrige bis moderate Intensität,</li> <li>extreme Armbewegung meiden,</li> <li>auf elektromagnetische Interferenzen achten (Zeitnahme, elektronische Sensoren),</li> <li>6 Wochen nach Implantation kein Sport.<sup>1, 2</sup></li> </ul> <p>Auch die AHA/ACC veröffentlichte 2015 Empfehlungen für die Sportausübung von Schrittmacher-/ICD-Patienten, die zusammengefasst lauten wie folgt:</p> <ul> <li>Indikationsstellung wie beim Nichtathleten,</li> <li>nur Sportarten mit niedriger statischer und dynamischer Intensität (Kegeln, Golf, Billiard etc.), aber nur bei asymptomatischen Patienten,</li> <li>eventuell höhere statische und/oder dynamische Intensitäten (z.B. Tennis, Fußball, Basketball, Schwimmen), aber nur bei asymptomatischen Patienten, nach genauer Abwägung eventueller adäquater/inadäquater Schocks und potenzieller Deviceschädigung durch den Sport;</li> <li>Wunsch des Athleten, Sport fortzusetzen, soll nicht zur ICD-Implantation motivieren.<sup>3</sup></li> </ul> <p>Diese Empfehlungen mögen einen groben Überblick über die Richtung eines Rates an einen betroffenen Patienten geben, für individuelle Anfragen gehen sie aber zu wenig weit. Ausgangspunkt für jede individualisierte Sportberatung von kardialen Deviceträgern sind die Grunderkrankung und die Art des Devices.</p> <h2>Sport mit Herzschrittmacher</h2> <p>Die Grunderkrankung, infolge derer der Herzschrittmacher überhaupt implantiert worden ist, spielt hier eine entscheidende Rolle. So ist es naheliegend, dass je nach Grunderkrankung Sport und insbesondere Leistungssport völlig unterschiedlich bewertet werden. Bei Patienten mit koronarer Herzerkrankung (KHK, ca. 30 % der Patienten) und/oder einer eingeschränkten linksventrikulären Auswurffraktion (ca. 30 % der Patienten) gilt es im Rahmen einer entsprechenden Abklärung sicherzustellen, dass die maximale Schrittmacherfrequenz nicht zu (ischämischen) Beschwerden oder gar zu einer potenziellen Schädigung des Patienten führt. Von Koronar- und Herzinsuffizienzpatienten sind die ca. 40 % der schrittmacherversorgten Patienten zu unterscheiden, die ein strukturell normales Herz haben. Hohe Herzfrequenzen sind per se nicht mit gutem Grund zu verbieten, wenngleich auch hier eine entsprechende kardiologische Abklärung vor hochintensiven Belastungen erfolgen sollte. Zu berücksichtigen ist auch, dass die Indikationen für eine Schrittmacherversorgung vor allem höhergradige atrioventrikuläre (AV) Blockierungen, Sick-Sinus-Syndrom und bradykardes Vorhofflimmern umfassen, neben weniger häufigen Indikationen wie vasovagalem Syndrom, faszikulären Leitungsstörungen, symptomatischem AVBlock I, um nur einige zu nennen. Diese Befunde sind zumeist in höherem Lebensalter gegeben, sodass es nicht verwunderlich ist, dass das Durchschnittsalter eines herzschrittmacherversorgten Patienten um die 75 Jahre liegt.<sup>4</sup> In diesem Alterssegment stehen körperliche Alltagsaktivität und niedrigintensiver Freizeitsport im Vordergrund, nur wenige Patienten werden an Wettkämpfen teilnehmen wollen. Aber auch Tätigkeiten, die in diesem Alterssegment durchgeführt werden, können zu Sondenbrüchen führen bzw. eine traumatische Beschädigung des Schrittmachers verursachen, man denke z.B. an Schneeschaufeln, durch das es zu einem Sondenbruch infolge mechanischer Belastung zwischen Clavicula und erster Rippe kommen kann. Auch kann es durch ein Oversensing von Myopotenzialen zu einer Schrittmacherdysfunktion kommen. Schließlich ist die chronotrope Inkompetenz beim schrittmacherabhängigen Patienten ein Problem. Wenngleich die Mehrzahl der Schrittmacherpatienten einem älteren Patientenkollektiv zuzuordnen ist, sind vereinzelt auch Fallberichte über (jüngere) Leistungssportler mit Herzschrittmacher publiziert. 5 Kindermann und Fröhlig empfehlen eine Checkliste für Schrittmacherpatienten und Sport (Tab. 1).<sup>6</sup></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Kardio_1701_Weblinks_s22_tab1.jpg" alt="" width="1417" height="1553" /></p> <h2>Sport mit CRT</h2> <p>Diese per definitionem herzinsuffizienten Patienten können im Rahmen ihrer Grunderkrankung Sport betreiben. Je nach Gesamtsituation bzw. der Implantation mit oder ohne eine Defibrillationsfunktion gelten sinngemäß die Empfehlungen wie unter „Sport mit Schrittmacher/ ICD“ dargelegt.</p> <h2>Sport mit ICD</h2> <p>Die Indikation für ICDs unterscheidet sich naturgemäß von jener eines Schrittmachers. Im Vergleich zu Schrittmacherpatienten sind ICD-Träger jünger (im Mittel 66 Jahre) und häufiger männlichen Geschlechts (78 % ). Häufig liegt eine strukturelle Herzerkrankung, meist eine KHK (62 % , Myokardinfarkt bei 37 % ) oder eine dilatative Kardiomyopathie (39 % , vor dem DANISH Trial<sup>7</sup>) vor. Ein Drittel aller ICD-Patienten weist eine schwere linksventrikuläre Dysfunktion mit einer Ejektionsfraktion <30 % auf. Jeweils ca. 2 % aller ICD-Implantationen entfallen auf die hypertrophe Kardiomyopathie und die arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie (ARVC). Die ICD-Implantation erfolgt in diesen Fällen wegen einer primären Arrhythmie. Dazu gehören neben dem idiopathischen primären Kammerflimmern die genetisch bedingten Ionenkanalerkrankungen (Long-QT-Syndrom, Brugada-Syndrom, katecholaminerge polymorphe Kammertachykardie, CPVT). Etwa 20 % aller ICD-Patienten weisen keine relevante linksventrikuläre Dysfunktion (Ejektionsfraktion >50 % ) und keine Herzinsuffizienzsymptomatik (NYHAStadium I) auf.<sup>8, 9</sup><br /> Verglichen mit Schrittmacherpatienten stellt die Sportberatung beim ICD-Patienten sicherlich die größere Herausforderung für den betreuenden Arzt dar und umfasst neben grundsätzlichen Überlegungen sowie Überlegungen zur Grunderkrankung und der Indikation der ICDVersorgung auch die Berücksichtigung der Bewegungsform, der Umgebung und spezifischen Belastungen einer gewünschten Sportart.<br /> Zunächst sollten aber einige grundsätzliche Überlegungen bei der Beratung bedacht werden. So ist die sympathische Aktivierung bzw. der erhöhte Plasma-Katecholaminspiegel durch intensive körperliche Aktivität potenziell proarrhythmisch; auch die sportbedingte Laktatazidose, Elektrolytverschiebungen oder Volumendepletion können kardiale Ionenkanäle beeinflussen und zur Zunahme von frühen oder späten Nachdepolarisationen und somit zu einer getriggerten Aktivität führen. Die ICD-Therapie unter metabolischen Bedingungen während intensiver Belastung ist möglicherweise nicht so gut wie in Ruhe, wie einige experimentelle Untersuchungen nahelegen.<sup>10</sup> Zudem kann eine Kaliumkonzentrationserhöhung während körperlicher Aktivität zu einer Zunahme der T-Wellen-Amplitude führen, was ein T-Wellen-Oversensing bedingen kann. In Bezug auf die Programmierung sollte ein Überlappen der programmierten Grenzen für die verschiedenen Zonen vermieden werden, beispielsweise durch Erreichen einer Therapiezone durch eine belastungsinduzierte Sinustachykardie. Insbesondere das Zwerchfell, aber auch die Brustmuskulatur ist häufig verantwortlich für Fehldetektion von Myopotenzialen, was im schlimmsten Fall zu inadäquaten Schocks führen kann. Auch gilt es zu berücksichtigen, dass ganz grundsätzlich ein erhöhtes Risiko für plötzlichen Herztod bei sportlicher Aktivität (ca. 2,5-fach) besteht und man im individuellen Fall eine Nutzen-Risiko-Abwägung durchführen sollte. Bei einigen Sportarten können Arrhythmien oder ICD-Schocks situativ gefährlich für Athlet und ggf. Zuschauer sein, man denke an Motorsport, Tauchen, Klettern oder Flugsport. Zudem wird neben der rhythmologischen Komponente eventuell durch Sport auch die Grunderkrankung negativ beeinflusst, wie dies wahrscheinlich bei der ARVC der Fall ist. Schließlich kann durch sportspezifische Belastungen wie starke Bewegungen, elektromagnetische Interferenzen oder große Krafteinwirkungen direkt oder über Elektrodendysfunktion indirekt das Risiko für inadäquate Schockabgaben erhöht werden.<sup>11</sup><br /><br /> Selbstverständlich spielt auch bei der Beratung von ICD-Trägern die Grunderkrankung eine entscheidende Rolle für die individuellen Sportempfehlungen. Exemplarisch seien einige Erkrankungen herausgegriffen. Bei der hypertrophen (obstruktiven) Kardiomyopathie (H[O]CM) wird der Score der Europäischen Kardiologischen Gesellschaft (ESC) zur Berechnung des Risikos des plötzlichen Herztodes empfohlen, sodass nur bei hohem Risiko (=6 % 5-Jahres-Risiko) für einen plötzlichen Herztod eine ICD-Implantation empfohlen wird und bei 4–6 % 5-Jahres- Risiko eine ICD-Implantation erwogen werden kann.<sup>12</sup> Somit richtet sich die Sportempfehlung für diese Patienten dann bei niedrigem Risiko ausschließlich nach der Grunderkrankung. Bei der ARVC stellt sich die Frage nach der Ausprägung der Grunderkrankung, eine linksventrikuläre Mitbeteiligung wird anders zu managen sein als eine auf ein kleines Areal isolierte rechtsventrikuläre Erkrankung. Auch die unterschiedlichen Long-QT-Syndrome sind je nach erkranktem Ionenkanal bei unterschiedlichen Tätigkeiten unterschiedlich anfällig für plötzlichen Herztod (z.B. LQTS Typ 1: im Wasser, bei Belastung; LQTS Typ 3: in Ruhe, v.a. während der Nacht). Bei der CPVT ist der Auslöser der polymorphen ventrikulären Tachykardie die Belastung per se, sodass beim ICD die Therapiezonen genau an die individuellen Gegebenheiten und Anforderungen angepasst werden und auch regelmäßig überprüft werden sollten. Als letztes Beispiel sei das Brugada-Syndrom angeführt, hier stellen Medikamente und spezifische Trigger, wie z.B. Fieber, ein größeres Problem als starke körperliche Belastungen dar, was sich auch in einer Häufung von plötzlichem Herztod im Schlaf und nicht während der körperlichen Aktivität widerspiegelt. Diese exemplarisch angeführten krankheitsspezifischen Aspekte sind bei der Sportberatung von ICD-Trägern zu berücksichtigen.<br /><br /> Anschließend sollten die Bewegungsformen der gewünschten Sportart im Hinblick auf ihre Tauglichkeit für Deviceträger analysiert werden. Bei asymmetrischer Belastung an oberer Extremität, wie beispielsweise beim Tennisspiel und anderen Schlägersportarten, Speerwerfen, Bogenschießen, Golf, Billard, Wurfsportarten, Baseball, Handball etc., sollte an der kontralateralen Seite implantiert werden. Sportarten mit Elevation/Zugbelastung beider Arme wie Gewichtheben, ButterflyÜbungen an Fitnessgeräten, Delphinschwimmen, Rudern, Hammerwerfen, Volleyball, Windsurfen etc. sollten gänzlich vermieden werden.<br /><br /> Auch sollte die mechanische sportartspezifische Belastung der gewünschten Sportart beachtet werden. So sind Kampfsportarten, Kontaktsportarten, die meisten Ballsportarten, Hochgeschwindigkeitssport, z.B. Skiabfahrtslauf, Schießsport, Baseball etc., nur in Ausnahmefällen für Deviceträger möglich. Hier gibt es jedoch neue Protektoren wie PaceGuard<sup>®</sup> oder Evoshield<sup>®</sup>, die zumindest einen gewissen Schutz vor mechanischer Belastung bei diesen Sportarten bieten.<br /> Zuletzt gilt es noch die Umgebung, in der der Sport betrieben wird, zu berücksichtigen. Beim Tauchen besteht für Schrittmacherträger eine relative, für ICDTräger eine absolute Kontraindikation. Voraussetzung für Tauchen mit Herzschrittmacher sind eine stabile Grunderkrankung und VO<sub>2</sub>peak >45ml/min/kg. Zu beachten sind mögliche Irritationen des Aktivitätssensors mit inadäquaten Frequenzanstiegen sowie ein durch die Druckerhöhung bedingtes Eindringen von Flüssigkeit in das Device (gerätespezifische Werte). Hier werden grundsätzlich die Konsultation eines Tauchmediziners sowie die Abklärung mit der Herstellerfirma empfohlen, ggf. auch vor der Implantation. Bei Sport in der Höhe gilt es zu beachten, dass ab einer Höhe von ca. 7.000m die Gefahr des Unterdrucks besteht, darunter gibt es devicespezifisch im Regelfall keine Limitationen. Zu berücksichtigen gilt es jedoch mögliche Limitierungen der Grunderkrankung, die oftmals mit bis 2.000/2.500m angegeben werden. Beim Wassersport spielen der Bewusstseinsverlust und die Gefahr des Ertrinkens auch bei erfolgreicher Schockabgabe eine zentrale Rolle, ebenso sollte beim Motorsport/ Extremsport die Gefahr des Bewusstseinsverlustes und die konsekutive Gefahr von Unfall/Absturz auch für Zuschauer bzw. andere Verkehrsteilnehmer berücksichtigt werden.<br /> Einige Überlegungen vor Implantation sowie Überlegungen zur Programmierung sind in Tabelle 2 zusammengefasst.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Kardio_1701_Weblinks_s22_tab2.jpg" alt="" width="1417" height="1814" /></p> <h2>Aktuelle Publikationen</h2> <p>Abschließend soll noch über zwei relevante Veröffentlichungen zu diesem Thema berichtet werden. Zum einen wurde von Lampert et al das bisher größte Register von ICD-Trägern zum Thema Sport veröffentlicht.<sup>13</sup> Insgesamt wurden Daten von 372 Patienten ausgewertet, zwischen 10 und 60 Jahren alt, 33 % davon weiblich, 16 % waren im Leistungssport, 12 % im Hochrisikosport aktiv. Die Diagnosen waren auf folgende aufgeteilt: H(O)CM, ARVC, Long-QT-Syndrom, KHK, idiopathische ventrikuläre Tachykardie, dilatative Kardiomyopathie, kongenitale Herzerkrankungen, Brugada-Syndrom, CPVT, valvuläre Herzerkrankung und linksventrikuläre Noncompaction-Kardiomyopathie. Es wurde über eine Follow-up-Zeit von 21 bis 46 Monaten kein Todesfall, keine externe Reanimation bzw. keine schockbedingte Verletzung beobachtet. Jedoch kam es zu 13 definitiven Sondendysfunktionen und 21 bewegungsassoziierten, teilweise auch inadäquaten Schockabgaben. Nach adäquater oder inadäquater Schockabgabe beendeten 30 % der Patienten die sportliche Aktivität, am häufigsten waren sportinduzierte Schockabgaben bei ARVC und idiopathischer ventrikulärer Tachykardie anzutreffen.<br /><br /> Eine zweite Untersuchung von Lampert et al berichtet über eine Befragung von 614 US-amerikanischen Ärzten (alle Mitglieder der Heart Rhythm Society) zum Thema. Hier zeigte sich eine große Diskrepanz zwischen den empfohlenen und den von den Patienten tatsächlich durchgeführten sportspezifischen Verhaltensformen. So wurden die Empfehlungen wie „Nur Golf oder Kegeln“, „Kein intensiver Sport“, „Kein Kontaktsport“, „Kein Wettkampfsport“ oder „Kein verletzungsanfälliger Sport“ nur spärlich umgesetzt, bei nur moderaten „adverse events“.<sup>14</sup></p> <div id="fazit"> <h2>Fazit</h2> Die Sportberatung von Schrittmacher- und ICD-Patienten ist eine Herausforderung für den betreuenden Arzt. Neben einer detaillierten Anamnese über die Art der geplanten sportlichen Tätigkeiten mit entsprechenden zu empfehlenden Restriktionen kann durch entsprechende Überlegungen zur Implantation und zur Programmierung der Devices dem Patienten trotz Devices eine sichere und freudvolle sportliche Aktivität ermöglicht werden. Dies gilt vor allem für den Freizeitsport, aber zunehmend – wenngleich mit gewissen Limitationen – auch für den Leistungssport. Jedenfalls ist ein grundsätzliches Sportverbot für Deviceträger in den allermeisten Fällen nicht mehr indiziert.</div></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Pelliccia A et al: Recommendations for participation in competitive sport and leisure-time physical activity in individuals with cardiomyopathies, myocarditis and pericarditis. European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation 2006; 13: 876-85 <strong>2</strong> Heidbüchel H et al: Recommendations for participation in leisure-time physical activity and competitive sports of patients with arrhythmias and potentially arrhythmogenic conditions. Part II: Ventricular arrhythmias, channelopathies and implantable defibrillators. European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation 2006; 13: 676-86 <strong>3</strong> Zipes DP et al: Eligibility and disqualification recommendations for competitive athletes with cardiovascular abnormalities: Task Force 9: Arrhythmias and conduction defects. A scientific statement from the American Heart Association and American College of Cardiology 2015; 66: 2412-23 <strong>4</strong> Markewitz A. [Annual report 2013 of the German Cardiac Pacemaker and Defibrillator Register, Part 1--Pacemaker. Pacemaker and AQUA Institute for Applied Quality Improvement and Research in Health Care GmbH workgroup]. Herzschrittmacherther Elektrophysiol 2015; 26: 374-98 <strong>5</strong> Surmely JF et al: For gold, heart rate matters. J Heart Lung Transplant 2005; 24: 1171-3 <strong>6</strong> Kindermann M, Fröhlig G: Sporttauglichkeit bei bradykarden Herzrhythmusstörungen und Herzschrittmacherträgern. Journal für Kardiologie – Austrian Journal of Cardiology 2008; 15: 35-340 <strong>7</strong> Køber L et al: Defibrillator implantation in patients with nonischemic systolic heart failure. New England Journal of Medicine 2016; 375: 1221-30 <strong>8</strong> Kindermann M: Kardiale Device-Therapie und Sport. Was darf der Patient mit Herzschrittmacher/ Defibrillator? Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin 2010; 61(10): 241-2 <strong>9</strong> Markewitz A: Annual report 2013 of the German cardiac pacemaker and defibrillator register. Part 2: Implantable cardioverter-defibrillators. Herzschrittmachertherapie + Elektrophysiologie 2015; 26: 399-423 <strong>10</strong> Paterson DJ: Antiarrhythmic mechanisms during exercise. J Appl Physiol (1985) 1996; 80: 1853-62 <strong>11</strong> Laszlo R et al: Leistungssporttauglichkeit nach ICD-Implantation. Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin 2016; 67: 231-36 <strong>12</strong> Elliott PM et al: 2014 ESC Guidelines on diagnosis and management of hypertrophic cardiomyopathy. The Task Force for the Diagnosis and Management of Hypertrophic Cardiomyopathy of the European Society of Cardiology (ESC) 2014. Eur Heart J 2014; 35(39): 2733- 79 <strong>13</strong> Lampert R et al: Safety of sports for athletes with implantable cardioverter-defibrillators: results of a prospective, multinational registry. Circulation 2013; 127: 2021-30 <strong>14</strong> Lampert R et al: Safety of sports participation in patients with implantable cardioverter defibrillators: a survey of heart rhythm society members. J Cardiovasc Electrophysiol 2006; 17: 11-5</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport
Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...
ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen
Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...
Inclisiran bei Patienten mit Statinintoleranz wirksam und sicher
Eine Analyse statinintoleranter Patienten aus dem Phase III Studienprogramm ORION zeigt, dass Inclisiran die LDL-Cholesterinspiegel kardiovaskulärer Hochrisikopatienten, die kein Statin ...


