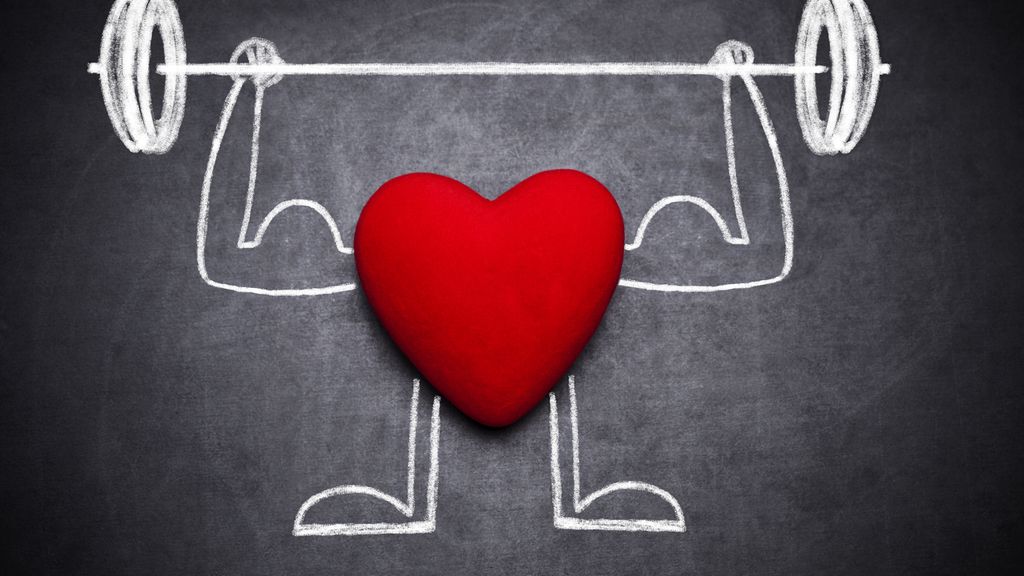
©
Getty Images/iStockphoto
Kardiale Maßnahmen zur Schlaganfallprävention
Jatros
Autor:
Prim. Priv.-Doz. Dr. Franz Xaver Roithinger
Abteilungsvorstand II. Interne Abteilung, Landesklinikum Wiener Neustadt<br> E-Mail: franzxaver.roithinger@wienerneustadt.lknoe.at
30
Min. Lesezeit
07.09.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Mit dem Älterwerden der Bevölkerung und den Fortschritten im Bereich der interventionellen Herzinfarkttherapie wird der Schlaganfall als vaskuläre Bedrohung im 21. Jahrhundert immer bedeutsamer. Rund ein Viertel aller Schlaganfälle hat eine kardioembolische Ursache und damit eine schlechtere Prognose als Schlaganfälle anderer Ätiologie. Auch bei kryptogenen Schlaganfällen könnte ein relevanter Anteil eine kardiovaskuläre Ursache haben. Daher bedarf es für eine effektive Schlaganfallprävention einer engen Zusammenarbeit von Neurologen und Kardiologen. Im Folgenden soll zusammengefasst werden, was der Kardiologe zur Schlaganfallprävention beitragen kann (Tab. 1).</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Lebensstiländerung und eine medikamentöse Primärprävention können das kardiovaskuläre Risiko und damit auch das Schlaganfallrisiko reduzieren.</li> <li>Schlaganfallprävention bei Vorhofflimmern ist heute im Falle der meisten Patienten eine Domäne der NOAK.</li> <li>Eine Rhythmuskontrolle mittels Katheterablation ist vorerst als rein symptomatische Therapie anzusehen – Studienergebnisse werden frühestens für 2018 erwartet.</li> <li>Ein Herzohrverschluss ist derzeit nur bei Hochrisikopatienten indiziert.</li> <li>Asymptomatische Patienten mit kurzen, unbemerkten Vorhofflimmerepisoden haben ein mehr als doppelt so hohes Schlaganfallrisiko als Patienten ohne Vorhofflimmern. Durch Detektion dieser Episoden und ihre Therapie könnten vermutlich sehr viele Menschenleben gerettet werden.</li> </ul> </div> <h2>Allgemeine Maßnahmen</h2> <p>Hypertonie, Diabetes mellitus, Hypercholesterinämie, Adipositas, Nikotinabusus und Bewegungsmangel haben eines gemeinsam: Sie sind mit einem erhöhten Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall vergesellschaftet. Mit diesen Risikosituationen sind in erster Linie der Allgemeinmediziner, der Internist oder der Kardiologe – und nicht der Neurologe – konfrontiert. So schwierig es ist, einen beschwerdefreien Patienten von einer Lebensstiländerung zu überzeugen und eine medikamentöse Primärprävention zu initiieren, so effektiv können alleine damit das kardiovaskuläre Risiko und dadurch auch das Schlaganfallrisiko gesenkt werden (Tab. 2).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Kardio_1703_Weblinks_kardio_1703_s19_tab1.jpg" alt="" width="686" height="860" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Kardio_1703_Weblinks_kardio_1703_s19_tab2.jpg" alt="" width="1419" height="611" /></p> <h2>Vorhofflimmern: orale Antikoagulation</h2> <p>Der Zusammenhang zwischen Vorhofflimmern und embolischem Schlaganfall ist gut untersucht, die Empfehlungen der Fachgesellschaften sind klar: Ab einem CHA<sub>2</sub>DS<sub>2</sub>VASc-Score von 2 ist eine lebenslange orale Antikoagulation zwingend indiziert (Klasse-IA-Indikation), bei einem CHA<sub>2</sub>DS<sub>2</sub>VASc-Score von 1 soll eine Antikoagulation erwogen werden (Klasse-IIa- Indikation). Beim nicht valvulären Vorhofflimmern (keine wirksame Mitralstenose, keine mechanische Klappe) ist eindeutig den NOAK (früher: neue orale Antikoagulanzien, jetzt, da sie nicht mehr neu sind: nicht Vitamin-K-abhängige orale Antikoagulanzien) der Vorzug vor Vitamin-KAntagonisten zu geben, wobei natürlich die Kontraindikationen berücksichtigt werden müssen (vorwiegend renale Insuffizienz). Allen Medikamenten (Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban und Edoxaban in der Reihenfolge der Zulassung) ist gemeinsam: Sie wurden in großen randomisierten Studien getestet, keines der Medikamente ist schlechter als Marcoumar<sup>®</sup>, keines verursacht mehr Blutungen (und wenn Blutungen auftreten, ist die Prognose besser als unter Marcoumar<sup>®</sup>), alle führen zu signifikant weniger intrazerebralen Blutungen, die Verträglichkeit ist gut, die Interaktionen sind geringer als unter Marcoumar<sup>®</sup>. Auch die ersten Langzeitstudien bestätigen die Effizienz und Sicherheit der NOAK. Im Gegensatz zu den Vitamin-KAntagonisten ist für Dabigatran ein Antidot verfügbar, für die Faktor-Xa-Inhibitoren wird es demnächst erwartet.</p> <h2>Katheterablation (Pulmonalvenenisolation)</h2> <p>Die Katheterablation zur kurativen Therapie von Vorhofflimmern ist wohl die wesentliche Innovation in der invasiven Elektrophysiologie der letzten 20 Jahre. Michel Haïssaguerre und seine Mitarbeiter in Bordeaux, Frankreich, fanden 1996 heraus, dass paroxysmales Vorhofflimmern durch eine fokale Ablation dann erfolgreich mit Hochfrequenzstromablation behandelt werden kann, wenn ein linksatrialer fokaler Trigger im Bereich der Rückwand des linken Vorhofes eliminiert werden kann. Die Erkenntnis, welch große Bedeutung die Rückwand des linken Vorhofs und vor allem die Mündung der vier Lungenvenen ebendort für die Initiierung und Aufrechterhaltung von Vorhofflimmern haben, prägt bis heute alle unsere Bemühungen um die kurative Therapie (Abb. 1).<br /> In der Folge entwickelten viele Zentren auf der Welt Strategien und Techniken, die auf den Erkenntnissen der Forscher aus Bordeaux aufbauten. Die derzeit etablierte und in den Richtlinien empfohlene Strategie ist die empirische Isolation aller vier Lungenvenen: entweder mit konventionellem Röntgen unter Zuhilfenahme eines zirkulären „Lasso-Katheters“, oder mit Unterstützung durch ein dreidimensionales Mapping-System. Anfänglich wurden hauptsächlich Patienten mit paroxysmalem Vorhofflimmern behandelt, entsprechend gut waren mit einer Heilungsrate von 70 % schon zu Beginn des neuen Jahrtausends die Erfolgsaussichten. Trotz der Verbesserung der Technik und aggressiverer, teils auch fraglicher Therapiestrategien (lange Läsionen, Eliminieren fragmentierter Signale und Suche nach Rotoren) konnten aufgrund der Inklusion von Patienten, die von der Krankheit schwerer betroffen waren, in den letzten 10 Jahren die Ergebnisse nicht mehr wesentlich verbessert werden.<br /> Bei allem Enthusiasmus für die kurative Therapie des Vorhofflimmerns und bei aller Hoffnung, dass das Wiederherstellen des Sinusrhythmus auch das Schlaganfallrisiko senkt und vielleicht eine Antikoagulation unnötig macht: Die Rhythmuskontrolle mittels Ablation muss vorerst als rein symptomatische Therapie angesehen werden, da es noch keine Daten gibt, die beweisen, dass die Ablation die Prognose von Vorhofflimmerpatienten verbessert. Auf diese Daten werden wir auch noch eine Weile warten müssen – die Ergebnisse der CABANA-Studie werden frühestens 2018 publiziert werden.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Kardio_1703_Weblinks_kardio_1703_s20_abb1.jpg" alt="" width="1417" height="1254" /></p> <h2>Herzohrverschluss</h2> <p>Wenn das linke Herzohr der Nidus für einen Thrombus ist (wie im transösophagealen Echo häufig nachweisbar), müsste die Resektion des Herzohrs oder der Verschluss desselben eine effektive Prophylaxe eines embolischen Insults darstellen, ohne dass eine Antikoagulation notwendig ist. Tatsächlich werden seit Jahren verschiedene Systeme untersucht; die PROTECTAF- Studie konnte bei mehr als 700 Patienten nicht nur die Gleichwertigkeit des Herzohrverschlusses im Vergleich zur Behandlung mit Vitamin-K-Antagonisten zeigen, sondern sogar eine signifikante Überlegenheit. Die Daten konnten in diesem Jahr anhand eines Registers mit mehr als 1000 Patienten bestätigt werden. Da der Herzohrverschluss noch nicht im Vergleich zu NOAK getestet worden ist, in relevanter Weise Ressourcen bindet und kostenintensiv ist, wird die Methode derzeit hauptsächlich bei Hochrisikopatienten eingesetzt (hohes Schlaganfallrisiko, hohes Blutungsrisiko oder manifeste Blutungen unter Antikoagulation).</p> <h2>Fahnden nach asymptomatischem Vorhofflimmern</h2> <p>Schon vor fünf Jahren konnte eine Schrittmacher-Register-Studie zeigen, dass asymptomatische Patienten mit kurzen (<6 Minuten), unbemerkten Vorhofflimmerepisoden ein mehr als doppelt so hohes Schlaganfallrisiko haben als Patienten ohne diese kurzen Episoden. Darauf basiert auch die Empfehlung der European Society of Cardiology, Patienten ab dem 65. Lebensjahr in Hinsicht auf asymptomatisches Vorhofflimmern zu untersuchen. Untermauert wurde die Notwendigkeit eines solchen Screenings durch eine rezente Studie: Bei 30 % eines Kollektivs von Hochrisikopatienten ohne jegliche Palpitation konnte durch Implantation eines kleinen kardialen Monitors (Loop-Recorder, Abb. 2) nach 18 Monaten asymptomatisches Vorhofflimmern detektiert werden. Wohl auch auf diesen Daten beruht eine gemeinsame internationale Anstrengung, strukturiert vorzugehen, weil durch Detektion des asymptomatischen Vorhofflimmerns und entsprechende darauf folgende Maßnahmen (vor allem Antikoagulation) vermutlich sehr viele Menschenleben gerettet werden können.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Kardio_1703_Weblinks_kardio_1703_s20_abb2.jpg" alt="" width="685" height="703" /></p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>beim Verfasser</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport
Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...
ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen
Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...
Inclisiran bei Patienten mit Statinintoleranz wirksam und sicher
Eine Analyse statinintoleranter Patienten aus dem Phase III Studienprogramm ORION zeigt, dass Inclisiran die LDL-Cholesterinspiegel kardiovaskulärer Hochrisikopatienten, die kein Statin ...


