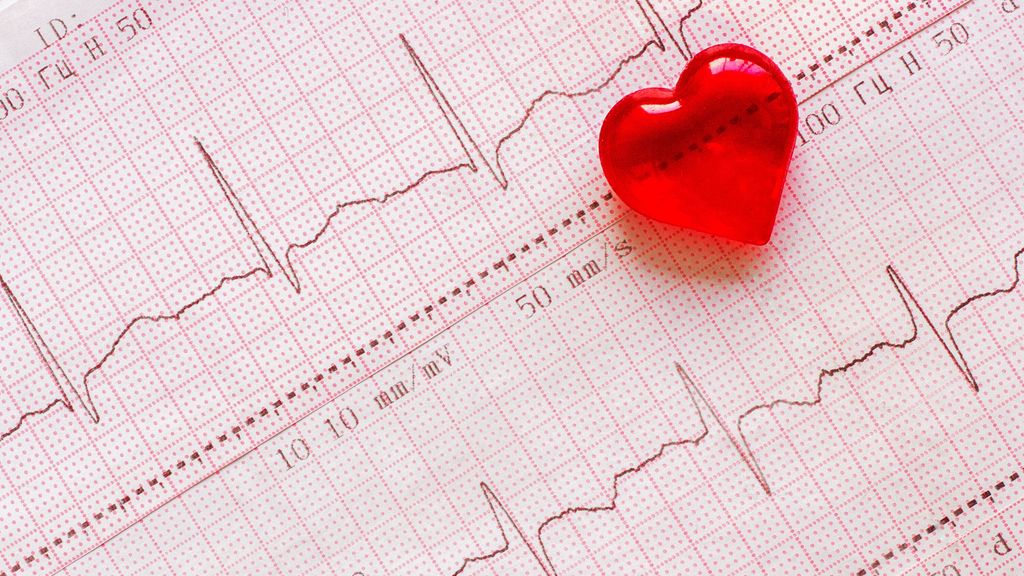
©
Getty Images/iStockphoto
Hypertoniemanagement im Jahr 2019
Jatros
Autor:
Prim. Priv.-Doz. Dr. Christoph Brenner, FESC
Department Kardiologie<br> Reha Zentrum Münster<br> E-Mail: mail@med.cbrenner.net
30
Min. Lesezeit
05.09.2019
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Im Jahr 2018 hat die Europäische Gesellschaft für Kardiologie (ESC) die Leitlinien zur Therapie der arteriellen Hypertonie aktualisiert. Während die Stadieneinteilung unverändert belassen wurde (die arterielle Hypertonie Grad I beginnt nach wie vor bei RR-Werten von 140/90 mmHg), wurden die Zielwerte antihypertensiv behandelter Patienten deutlich präzisiert.1 Ferner stärkt die aktuelle Datenlage die ambulante RR-Messung (24h-Blutdruckmessung) sowie die automatisierte Patientenselbstmessung in ihrer Wertigkeit bei Diagnostik und Therapie des Bluthochdrucks.</p>
<hr />
<p class="article-content"><h2>RR-Zielkorridore</h2> <p>Im Gegensatz zur vorangegangenen Leitlinienversion der ESC aus dem Jahr 2013 haben sich die Autoren der aktuellen Leitlinien zur Therapie der arteriellen Hypertonie auf Blutdruck-Zielkorridore geeinigt und akzeptieren damit weitestgehend das Konzept eines J-förmigen Kurvenverlaufs im Verhältnis zwischen Blutdruck und Rate an kardiovaskulären Ereignissen. Im Gegensatz zur Hypercholesterinämie, bei deren Behandlung heute mehr denn je das Konzept „the lower the better“ gilt, werden bei der arteriellen Hypertonie Blutdruckuntergrenzen anerkannt, die im Regelfall nicht unterschritten werden sollten (Tab. 1). Während der diastolische Blutdruck generell bei Werten zwischen 70 und 79 mmHg liegen sollte, empfehlen die ESC-Leitlinien für den systolischen Blutdruck einen Bereich zwischen 120 und 130 mmHg, bei einem Alter ab 65 Jahren oder bei Vorliegen einer chronischen Nierenerkrankung (CKD, GFR < 60 ml/min) Werte zwischen 130 und 140 mmHg.</p> <h2>Diskrepanz zwischen systolischen und diastolischen RR-Werten</h2> <p>So einfach sich die Zielwertkorridore anhören, so schwierig ist deren Umsetzung in der Praxis. Im CLARIFY-Register (32 703 Patienten mit stabiler KHK) hat sich gezeigt, dass sich nur bei etwa der Hälfte aller Patienten systolischer und diastolischer Wert konkordant zueinander verhielten, also beide Werte im Zielbereich, zu hoch oder zu niedrig waren. In etwa 40 % der Fälle war einer der Werte im Zielbereich, der andere zu hoch oder zu niedrig und in 5–10 % der Fälle (komplette Diskrepanz) war einer der Werte zu hoch, der andere zu niedrig.<sup>2</sup> Unklar bleibt, wie in diesen Fällen zu verfahren ist, wissenschaftliche Daten hierzu existieren bis heute nicht.<sup>3</sup> Bis eine Klärung erfolgt, wäre eine praktikable Lösung für den klinischen Alltag, die arteriellen Mitteldrücke anhand der gemessenen Werte abzuschätzen und diese in einen sinnvollen Bereich, orientiert an den Leitlinienempfehlungen, zu überführen.</p> <h2>Goldstandard ist die ambulante RR-Messung; gute Alternative eine automatische Praxismessung</h2> <p>Der Goldstandard der Blutdruckmessung ist heute die ambulante 24h-Langzeit-RR-Messung. Neben unverfälschten RRWerten liefert sie eine gute Übersicht über den Blutdruckverlauf während der alltäglichen Aktivitäten und als einzige Messmethode auch während der Schlafenszeit. Da diese Untersuchungsmethode einen beträchtlichen Ressourcenaufwand mit sich bringt und nicht in unbegrenztem Ausmaß auch für wiederholte Messungen zur Verfügung steht, können aufgrund der heute vorliegenden Datenlage auch alternative Messmethoden verwendet werden. Hinsichtlich der tagsüber gemessenen RR-Werte bieten nämlich die häusliche Selbstmessung durch die Patienten ebenso wie die automatische Blutdruckmessung in der Arztpraxis vergleichbare Messergebnisse. Wichtig ist dabei, dass die Messungen tatsächlich in Abwesenheit des Praxispersonals (Mehrfachmessungen, z. B. in einem ruhigen, separaten Raum) mit einem automatischen Gerät allein durch den Patienten durchgeführt werden. In einer Anfang des Jahres veröffentlichten Übersichtsarbeit konnte klar gezeigt werden, dass die Anwesenheit von Praxispersonal während der Blutdruckmessungen zu einem Anstieg sowohl der systolischen als auch der diastolischen RR-Werte führt (Abb. 1).<sup>4</sup></p> <h2>Dipping</h2> <p>Im Hygia-Project (15 647 Hypertonie- Patienten, 48h-Langzeit-RR-Messung) konnte bestätigt werden, dass sich bei zunehmenden RR-Werten tagsüber von systolisch 120 mmHg auf 140 mmHg die Rate an kardiovaskulären Ereignissen in etwa verdoppelt. Viel stärker war jedoch die Korrelation zu den Schlafenszeiten. Bei nächtlichen systolischen RR-Werten von 125 mmHg im Vergleich zu 100 mmHg versechsfachte sich das kardiovaskuläre Risiko, im Umkehrschluss konnte ein physiologischer nächtlicher Blutdruckabfall (Dipping) um bis zu 16 % das Herz-Kreislauf-Risiko um mehr als zwei Drittel reduzieren. Insofern könnte auch die abendliche Gabe zumindest eines der Blutdruckpräparate (medikamentös induziertes Dipping) ebenfalls einen protektiven Effekt auf das Herz-Kreislauf-System haben. <br />Interessanterweise zeigte sich allerdings keine Korrelation der durch Praxispersonal bestimmten RR-Werte mit dem kardiovaskulären Risiko.<sup>5</sup> Diese Arbeit bestätigt damit einmal mehr die geringe Relevanz der durch ärztliches oder Assistenzpersonal erhobenen RR-Werte und unterstreicht die Wichtigkeit automatisierter Blutdruckmessungen bzw. Selbstmessungen durch die Patienten.</p> <h2>Therapie</h2> <p>Zur medikamentösen Therapie der isolierten arteriellen Hypertonie kommen in erster Linie RAAS-Blocker in Kombination mit Diuretika oder Kalziumkanalblockern zum Einsatz. Dabei empfehlen die aktuellen Leitlinien bereits initial die Kombination von zwei der genannten Wirkstoffe (in niedriger Dosierung) sowie deren Einnahme in Form einer Polypille. Beide Maßnahmen dienen der Maximierung der blutdrucksenkenden Effekte bei Minimierung des Nebenwirkungsprofils sowie optimaler langfristiger Therapieadhärenz. <br />Hinsichtlich der bevorzugten Präparatewahl stellen RAAS-Blocker auch unabhängig von der Grunderkrankung eine gute Basis dar (Tab. 2). Während nach akutem Myokardinfarkt bzw. bei systolischer Herzinsuffizienz Betablocker und Mineralkortikoidantagonisten zum Einsatz kommen sollten, kann bei Diabetes mellitus und Niereninsuffizienz auf Kalziumkanalblocker und Diuretika zurückgegriffen werden. Ab einer GFR unter 30 ml/min sollten dabei Schleifendiuretika verwendet werden, da Thiazide bzw. Thiazid-ähnliche Diuretika hier ihre Wirkung verlieren.</p> <div id="fazit"> <h2>Fazit</h2> <p>Die aktuell verfügbaren Antihypertensiva ermöglichen uns heute eine effektive und gut verträgliche Einstellung hypertensiver Blutdruckwerte.</p> <h2>PRAXISTIPP</h2> <p>Die medikamentöse Erstlinientherapie der arteriellen Hypertonie sollte im Regelfall als Kombinationstherapie (zwei verschiedene Wirkstoffe) erfolgen. Durch die Verwendung von Polypillen (mehrere Wirkstoffe in einer Tablette) kann dabei eine langfristig optimale Therapieadhärenz erreicht werden.</p> </div></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Williams B et al.: 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J 2018; 39(33): 3021-104 <strong>2</strong> Sorbets E et al.: Rationale, design, and baseline characteristics of the CLARIFY registry of outpatients with stable coronary artery disease. Clin Cardiol 2017; 40(10): 797-806 <strong>3</strong> Vidal-Petiot E et al.: The 2018 ESC-ESH guidelines for the management of arterial hypertension leave clinicians facing a dilemma in half of the patients. Eur Heart J 2018; 39(45): 4040-1 <strong>4</strong> Pappaccogli M et al: Comparison of automated office blood pressure with office and out-off-office measurement techniques. Hypertension 2019; 73(2): 481-90 <strong>5</strong> Hermida RC et al.: Asleep blood pressure: significant prognostic marker of vascular risk and therapeutic target for prevention. Eur Heart J 2018; 39(47): 4159-71</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport
Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...
ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen
Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...
Inclisiran bei Patienten mit Statinintoleranz wirksam und sicher
Eine Analyse statinintoleranter Patienten aus dem Phase III Studienprogramm ORION zeigt, dass Inclisiran die LDL-Cholesterinspiegel kardiovaskulärer Hochrisikopatienten, die kein Statin ...


