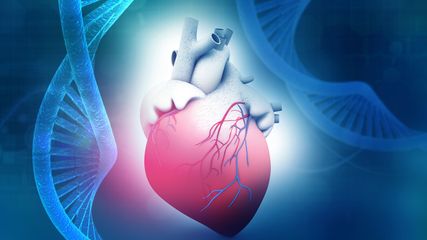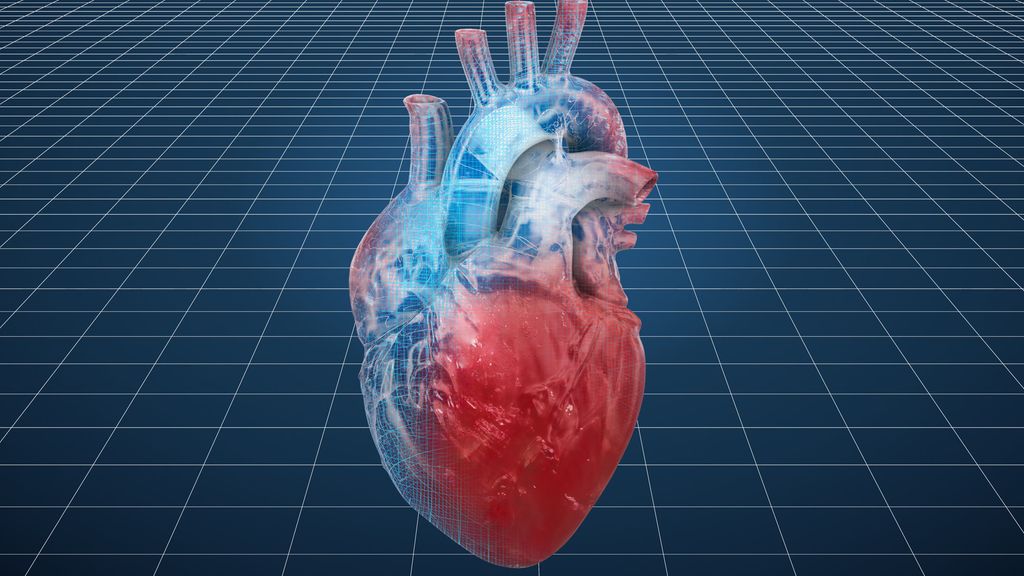
©
Getty Images/iStockphoto
Herzinsuffizienz – aus der Forschung für die Praxis
Leading Opinions
30
Min. Lesezeit
01.09.2016
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Herzinsuffizienz ist die Epidemie unserer Zeit. Die Prognose ist zum Teil vergleichbar mit der einer malignen Erkrankung. Erfreulicherweise gab es sowohl bei der medikamentösen als auch bei der interventionellen Therapie in den letzten Jahren grosse Fortschritte, die auch in die aktualisierte ESC-Leitlinie zur Herzinsuffizienz einflossen, die am Heart Failure Congress 2016 in Florenz präsentiert wurden. Mehr über die neuen Guidelines erfahren Sie im Artikel von Dr. med. Deddo Mörtl auf S. 63 und im Interview mit Prof. Dr. med. Christian Müller auf S. 66. Aber auch abseits der neuen Guideline gab es Spannendes.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Leading Opinions_Innere_1604_Weblinks_Seite59.jpg" alt="" width="" height="" /></p> <h2>Diastolische Herzinsuffizienz: ein schwieriges Krankheitsbild</h2> <p>Prof. Dr. med. Burkert Pieske, Berlin, hielt einen interessanten Vortrag zur diastolischen Herzinsuffizienz. Bei einer Auswurffraktion von <40 % spricht man von einer systolischen Herzinsuffizienz (Heart Failure with reduced Ejection Fraction: HFrEF), bei einer Auswurffraktion von ≥50 % von einer diastolischen Herzinsuffizienz (Heart Failure with preserved Ejection Fraction: HFpEF), wenn zusätzlich die natriuretischen Peptide erhöht sind und echokardiografische Hinweise für eine diastolische Funktionsstörung vorliegen. Für Patienten mit einer EF zwischen 40 und 49 % hat man jetzt eine neue Klassifizierung eingeführt. Man spricht von einer mittleren Form der Herzinsuffizienz (Heart Failure mid-range Ejection Fraction: HFmrEF), wenn zusätzlich wie bei der HFpEF die natriuretischen Peptide erhöht sind und echokardiografisch eine strukturelle oder funktionelle Störung des linken Ventrikels vorliegt. Letztere Form soll bei ca. 10–20 % aller herzinsuffizienten Patienten vorliegen und mit einer ungünstigen Prognose assoziiert sein. Ob solche Patienten wie bei ­einer HFrEF oder bei einer HFpEF ­behandelt werden sollten, ist bislang unsicher.</p> <p>Jeder zweite herzinsuffiziente Patient hat eine dia­stolische Herzinsuffizienz, deren Pro­gnose genauso ernst ist wie die der systolischen. Nach neueren Erkenntnissen handelt es sich bei der diastolischen Herzinsuffizienz um ein sehr heterogenes Krankheitsbild, welches einer differenzierten Therapie bedarf und bei dessen Pathogenese der endothelialen Dysfunktion im Rahmen des metabolischen Syndroms eine wichtige Bedeutung zukommen dürfte. Im Unterschied zur systolischen Herzinsuffizienz steht jedoch bisher keine medikamentöse Therapie zur Verfügung, die die Prognose verbessert. In den entsprechenden Studien (CHARM-Preserved, I-Preserve, PEP-CHF, TOPCAT) konnte weder mit einem ACE-Hemmer bzw. AT1-Blocker noch mit Spironolacton ein prognostischer Benefit erzielt werden. Das Problem dieser Studien war, dass die Entscheidungskriterien für das Vorliegen einer diastolischen Herzinsuffizienz sehr unterschiedlich gehandhabt wurden. So zeigte in der TOPCAT-Studie fast die Hälfte der Patienten eine normale diastolische Funktion und/oder eine normale Vorhofgrösse und es fand sich bei jedem Zweiten kein Hinweis für ein strukturelles linksventrikuläres Remodeling. Doch gerade die linksventrikuläre Hypertrophie, die Dilatation des linken Vorhofs und die diastolische Dysfunktion sind entscheidende Prädiktoren für eine schlechte Prognose.</p> <p>Bisher gelten als diagnostische Kriterien für das Vorliegen einer diastolischen Herzinsuffizienz neben einer EF >50 % und regulären Dimensionen des linken Ventrikels der Nachweis einer diastolischen Funktionsstörung mit abnormer Füllung bzw. gestörter Relaxation bzw. vermehrter Steifigkeit. Echokardio­grafisch sollten eine leichte linksventrikuläre Hypertrophie und ein vergrössertes linksatriales Volumen vorliegen. Für den Nachweis einer diastolischen Dysfunktion wird der E/E’-Quo- tient herangezogen, wobei ein Wert über 15 als pathologisch und ein Wert unter 8 als normal gilt. Doch die Aussagekraft etablierter Echoindizes ist ebenso wie die der Biomarker limitiert. Das NT-proBNP ist oft nur grenzwertig erhöht und unspezifisch, sodass ein Normwert die Erkrankung nicht mit letzter Sicherheit ausschliesst.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Leading Opinions_Innere_1604_Weblinks_Seite60.jpg" alt="" width="404" height="641" /></p> <p>Ein wichtiger diagnostischer Baustein ist die genaue funktionelle Beurteilung der systolischen Myokardfunktion sowohl in Vorhöfen als auch Ventrikeln. So findet sich bei jedem vierten Patienten trotz normaler Grösse des linken Vorhofs ein reduzierter Strain, was von prognostischer Relevanz ist. Darüber hinaus besteht nicht nur eine diastolische, sondern auch eine systolische Dysfunktion des linken Ventrikels, und zwar in Form eines reduzierten Strains. Eine normale Auswurffraktion bedeutet also noch lange nicht, dass die systolische Funktion nicht gestört ist. In entsprechenden Studien konnte man in der Tat zeigen, dass bei Patienten mit einer diastolischen Herzinsuffizienz häufig der longitudinale und der zirkumferentiale systolische Strain im linken Ventrikel reduziert sind. Und eine solche systolische Dysfunktion könnte auch ein Marker für das Ansprechen auf eine bestimmte Therapie sein.</p> <div id="fazit"> <h2>Fazit</h2> <p>Die Diagnosestellung bei der diastolischen Herzinsuffizienz ist nicht immer einfach, denn etablierte Echoindizes und Biomarker haben Limitationen. Deshalb sollten zusätzliche Parameter, genauer gesagt die systolische Funktion des linken und rechten Ventrikels und des linken Vorhofs i.S. einer Abnahme des Strains berücksichtigt werden.</p> </div> <h2>Rechtsherzversagen bei LVAD-Patienten</h2> <p>Prof. Dr. med. Frank Enseleit, Zürich, infor­mierte über das Rechtsherzversagen bei LVAD-Patienten. Die Einführung der linksventrikulären Assist-Devices (LVAD) hat die Behandlungsmöglichkeiten bei Patienten mit einer terminalen Herzinsuffizienz wesentlich verbessert. Die Zahl der Patienten mit einem solchen System ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Eine der gefürchtetsten Komplikationen bei LVAD-Patienten ist das Rechtsherzversagen. Es stellt nach wie vor ein ungelöstes Problem dar. Durch das Rechtsherzversagen werden die Morbidität und Mortalität erhöht, d.h. durch eine Verhinderung des Rechtsherzversagens kann die 1-Jahres-Überlebensrate deutlich verbessert werden. Bei pulsatilen Systemen ist die Gefahr eines Rechtsherzversagens höher als bei Systemen mit einem kontinuierlichen Flow. Definiert ist das Rechtsherzversagen durch einen Anstieg des zentralvenösen Drucks auf über 20mmHg und ein Absinken des Cardiac-Index auf <2,0l/min/m2. Bildgebende Verfahren werden bisher bei der Definition nicht berücksichtigt, da in der frühen postoperativen Phase der rechte Ventrikel oft nicht mit ausreichender Qualität dargestellt werden kann. <br />Physiologischerweise führt die LVAD-Implantation zu einer Entlastung des linken Ventrikels und damit auch zu ­einer Abnahme des kapillären Verschlussdrucks und auch der rechtsventrikulären Nachlast. Gleichzeitig nimmt der venöse Rückstrom zum rechten Ventrikel zu und somit die rechtsventrikuläre Vorlast. Während ein gesundes rechtes Herz diese hämodynamischen Veränderungen gut toleriert, kann sich bei LVAD-Patienten ein Rechtsherzversagen entwickeln, denn bei solchen Patienten ist oft die Kontraktilität bereits präoperativ gestört und auch die rechtsventrikuläre Nachlast ist durch eine ­bereits entstandene pulmonale Hyper­tonie erhöht.</p> <p>Auch wenn sich ein Rechtsherzversagen im Einzelfall nicht zuverlässig voraussagen lässt, so gibt es doch eine ­Reihe von Prädiktoren. Dazu gehören weibliches Geschlecht, ein präoperatives Kreislaufversagen, das Vorliegen einer Endorgandysfunktion, einer pulmonalen Hypertonie bzw. einer rechtsventrikulären Dysfunktion. Ein besonders hohes Risiko besteht bei Patienten in einem schlechten Allgemeinzustand und mit vorübergehend eingeschränkter linksventrikulärer Funktion. Dazu kommen peri- und postoperative Faktoren wie rechtsventrikuläre Ischämie, Luft- bzw. Lungenembolie, eine systemische Inflammation und die mechanische Kompression der Pulmonalarterie bei der Operation. Insgesamt ist es bisher aber nicht gelungen, einen zuverlässigen Risikoscore zu entwickeln. Doch rechtsventrikuläre Strainanalysen könnten eine Möglichkeit sein, Risikopatienten vor der LVAD-Implantation zu identifizieren.<br />Entwickelt sich intra- oder postoperativ ein Rechtsherzversagen, empfiehlt sich die Gabe von inhalativen pulmonalen Vasodilatatoren evtl. in Kombination mit inotropen Substanzen. Wichtig ist es, das LVAD-System so einzustellen, dass eine optimale Vorlast erreicht wird. Bei Vorhofflimmern sollte die Kardioversion angestrebt werden und eine Azidose sollte vermieden werden. Wenn dies nicht zu einer Stabilisierung führt, muss zusätzlich ein rechtsventrikuläres Device implantiert werden.</p> <div id="fazit"> <h2>Fazit</h2> <p>Das Rechtsherzversagen ist eine der gefürchtetsten Komplikationen bei einer LVAD-Implantation, weil es die Prognose deutlich verschlechtert.</p> </div> <h2>MicroRNAs: ein neuer diagnostischer und therapeutischer Ansatz</h2> <p>Dr. Ward A. Heggermont, Leuven, erhielt für seine Arbeit über die Bedeutung von MicroRNAs, über die wir im Folgenden berichten, den „Young ­Investigator Award“ für Grundlagenforschung. Lange Zeit galten sie als Zellmüll. Die Rede ist von den kurzen Ribonukleinsäureketten im Zellkern, auch MicroRNAs genannt. Sie wurden erstmals 1993 von einem amerikanischen Biologen in den Zellen des Fadenwurms beschrieben. Sie enthalten selbst keine Erbinformationen für Proteine, kodieren also nicht, regulieren jedoch die Proteinsynthese, indem sie ein Netzwerk von Genen steuern. Somit beeinflussen sie die Entwicklung, Vermehrung und Funktion von Zellen. Art und Menge der MicroRNAs sind bei vielen Krankheiten verändert, z.B. bei der Herzinsuffizienz. Deshalb haben diese nicht kodierenden RNAs das besondere Interesse der kardiologischen Forschung gefunden und intensive Forschungsaktivitäten auf diesem Gebiet in Gang gesetzt. Man weiss heute, dass MicroRNAs eine entscheidende Rolle bei der Pathogenese der Herzinsuffizienz spielen, also Einfluss nehmen auf den strukturellen Umbau des Herzens. In experimentellen Untersuchungen zeigte sich, dass bei einer Herzinsuffizienz bestimmte MicroRNAs in den Fibroblasten vermindert sind, was mit einer vermehrten Expression des Transforming Growth Factor (TGF) beta 1 und auch des TGF-beta-1-Rezeptors einhergeht. Andere MicroRNAs regulieren die Kollagensynthese und wirken so direkt profibrotisch.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Leading Opinions_Innere_1604_Weblinks_Seite61.jpg" alt="" width="432" height="593" /></p> <p>Da MicroRNAs in verschiedene Remodeling-Vorgänge eingreifen, bieten sie sich insbesondere beim Myokardinfarkt und der Herzinsuffizienz, evtl. auch beim Vorhofflimmern, als interessantes vielversprechendes therapeutisches Target an. Eine gezielte Manipulation ihrer Funktion ist mithilfe spezifischer MicroRNA-Antagonisten möglich. Solche komplementärsträngigen Antagonisten binden sich spezifisch an die MicroRNAs und schalten sie somit aus. Dadurch können fibrotische Prozesse gehemmt und so dem strukturellen Remodeling entgegengewirkt werden. Aber auch als Biomarker könnten ­MicroRNAs zukünftig im klinischen Alltag Bedeutung erlangen, denn mithilfe der Bestimmung von MicroRNAs lässt sich der strukturelle Umbau qualitativ und auch quantitativ nachweisen, d.h., das Ausmass der Umbauvorgänge kann bei einzelnen Patienten erfasst werden, was wiederum Auswirkungen auf das therapeutische Management haben dürfte. Der Einsatz der Micro­RNAs im Rahmen der Diagnostik und Therapie der Herzinsuffizienz ist zurzeit sicherlich noch eine Vision. Aber Visionen von heute sind bekanntlich die Realitäten von morgen.</p> <div id="fazit"> <h2>Fazit</h2> <p>MicroRNAs sind in den letzten Jahren in den Mittelpunkt der kardiovaskulären Forschung gerückt, denn vieles spricht dafür, dass sie in verschiedene Remodeling-Vorgänge eingreifen und deshalb bei der Behandlung der Herzinsuffizienz ein interessantes therapeutisches Target darstellen könnten.</p> </div> <h2>Kardiogener Schock: Die Mortalität ist gesunken</h2> <p>Prof. Dr. med. Stefan Windecker, Bern, befasste sich in diesem Jahr mit dem kardiogenen Schock. In Registerstudien konnte gezeigt werden, dass die Mortalität des kardiogenen Schocks in den letzten Jahren von 80 % auf 50 % zurückgegangen ist und dies dank der Zunahme der frühen Revaskularisation. Bisher gibt es allerdings wenig Evidenz dafür, dass neben der frühen Revaskularisation irgendein anderes Verfahren die Sterblichkeit der Patienten mit kardiogenem Schock reduzieren könnte. Auch sind die Empfehlungen zur sofortigen Durchführung einer Multivessel-PCI sehr zurückhaltend (Klasse IIa, Level B), doch im Einzelfall sollte eine Mehrgefäss-PCI durchaus diskutiert werden. Die IABP-SHOCK-II-Studie ergab auch keinen Vorteil für die intraaortale Ballonpumpe beim kardiogenen Schock, sodass die Empfehlung für die Verwendung einer solchen herabgestuft wurde (von Klasse 1/Level C auf Klasse III/Level A). Nach der Veröffentlichung dieser Studie wurden mehr Assist-­Devices implantiert. Allerdings konnte bisher in keiner randomisierten Studie ein Zusatznutzen durch solche Devices belegt werden.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Leading Opinions_Innere_1604_Weblinks_Seite62.jpg" alt="" width="439" height="726" /></p> <div id="fazit"> <h2>Fazit</h2> <p>Die frühzeitige Revaskularisation ist die prognostisch entscheidende Massnahme beim kardiogenen Schock.</p> </div> <h2>Kurz und knapp</h2> <ul> <li>Im Rahmen der ATMOSPHERE-Studie wurde bei 7 016 Patienten mit einer systolischen Herzinsuffizienz der Renininhibitor Aliskiren mit einem ACE-Hemmer und der Kombination beider Substanzen verglichen. Dabei ergab sich kein Vorteil für Aliskiren, auch nicht bei Diabetikern. Doch unter der Aliskiren-Monotherapie traten seltener symptomatische Hypotonien auf. Somit ist Aliskiren eine gleichwertige Alternative für Patienten, die den ACE-Hemmer nicht tolerieren (L. Køber, Kopenhagen).</li> <li>Im Rahmen der ExTraMATCH-II-Metaanalyse von 4 043 herzinsuffizienten Patienten konnte gezeigt werden, dass diese von einem regelmässigen Belastungstraining prognostisch profitieren. Ausserdem verbessert sich die Lebensqualität. Dies gilt für alle Patienten unabhängig vom Schweregrad der Herzinsuffizienz, Alter und Geschlecht. Die Gesamtmortalität war um 18 % und die Notwendigkeit für eine stationäre Behandlung wegen Verschlechterung der Herzinsuffizienz um 11 % niedriger (R. Taylor, Exeter).</li> <li>Eine Studie bei 20 000 herzinsuffizienten Patienten über 60 Jahre ergab, dass eine Grippeschutzimpfung das Risiko für eine Demenz senkt, nämlich um 35 % . Bei Patienten, die mehr als drei Impfungen erhalten hatten, war das Risiko sogar um 55 % niedriger. Der Benefit nahm mit dem Alter der Patienten zu. Man muss annehmen, dass eine Influenzainfektion gerade bei einer Herzinsuffizienz die ­hämodynamische Situation und somit die zerebrale Zirkulation weiter verschlechtert (Ju-Chi Liu, Taipeh).</li> <li>In einer anderen Studie bei 60 000 Patienten konnte durch die Grippeschutzimpfung auch die Häufigkeit einer stationären Behandlung signifikant um 30 % gesenkt werden. Auch die Notwendigkeit für einen stationären Aufenthalt wegen eines respiratorischen Infekts nahm um 16 % ab (K. Rahimi, Oxford).</li> </ul></p>
Das könnte Sie auch interessieren:
ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport
Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...
ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen
Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...
Inclisiran bei Patienten mit Statinintoleranz wirksam und sicher
Eine Analyse statinintoleranter Patienten aus dem Phase III Studienprogramm ORION zeigt, dass Inclisiran die LDL-Cholesterinspiegel kardiovaskulärer Hochrisikopatienten, die kein Statin ...