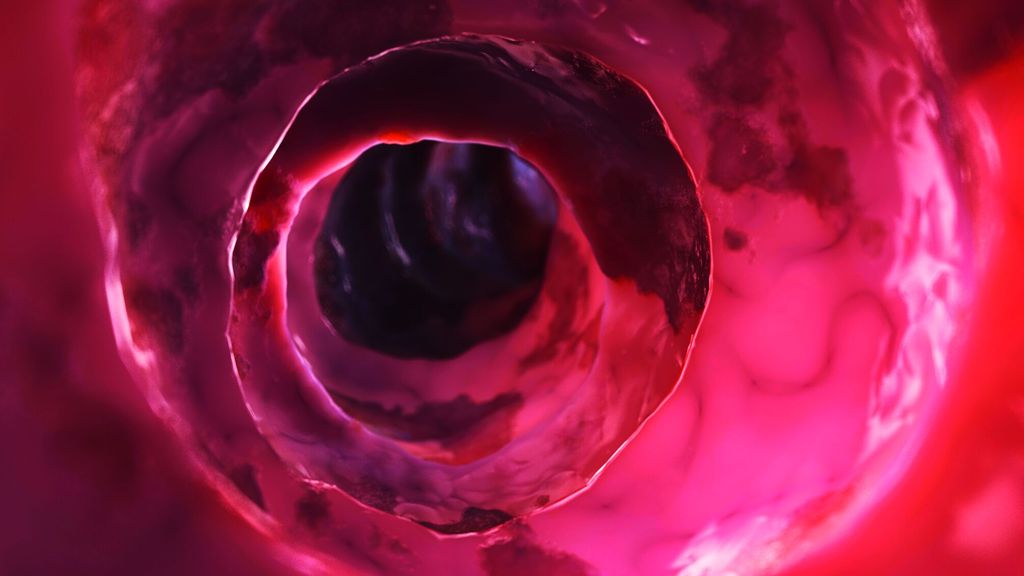
©
Getty Images/iStockphoto
Henne oder Ei?
Jatros
Autor:
Dr. Silvia Charwat-Resl
Innere Medizin II, Kardiologie, Intensivmedizin, Klinikum Wels-Grieskirchen<br> E-Mail: silvia.charwat-resl@klinikum-wegr.at
30
Min. Lesezeit
27.10.2016
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die Befundkombination aus eingeschränkter Linksventrikelfunktion und stark verkalkter Aortenklappe bedarf einer umfassenden Abklärung, da die richtige Interpretation weitreichende Konsequenzen für die Therapiemöglichkeiten hat und die Prognose des Patienten je nach zugrunde liegender Erkrankung sehr unterschiedlich ist.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Wir berichten über einen 50-jährigen Patienten, der seit Monaten unter zunehmender Belastungsdyspnoe (NYHA-Stadium III) litt und schließlich wegen Ruhedyspnoe hospitalisiert wurde. Es waren keine relevanten Erkrankungen vorbekannt, der Patient verneinte Angina-pectoris-Symptomatik und Synkopen. <br />Im Rahmen der initialen transthorakalen Echokardiografie fiel eine stark verkalkte, vermutlich trikuspide, sich kaum öffnende Aortenklappe bei Dilatation und konzentrischer Hypertrophie (Septumdicke 13mm) des linken Ventrikels mit global hochgradig eingeschränkter Linksventrikelfunktion mit einer Auswurffraktion um 20 % nach biplaner Simpson-Methode auf. Die über der Aortenklappe im CW- („continuous wave“)-Doppler maximal gemessene Flussgeschwindigkeit betrug 3,4m/s bei einem mittleren Gradienten von 30mmHg, es errechnete sich in der Kontinuitätsgleichung eine Klappenöffnungsfläche von 0,8cm<sup>2</sup>. Zusätzlich bestanden eine geringe Aortenklappeninsuffizienz und eine Ektasie der Aortenwurzel auf 45mm im Durchmesser. Somit bestand insgesamt das Bild einer hochgradigen Aortenklappenstenose mit niedrigem Gradienten („low-flow, low-gradient aortic stenosis“). <br />Im Rahmen der weiteren Abklärung wurde ein Links- und Rechtsherzkatheter durchgeführt. Es zeigte sich eine milde Koronarsklerose bei linksdominantem Koronarsystem. Das Levogramm bestätigte die linksventrikuläre Dilatation und die schwere diffuse Kontraktilitätsstörung. Der invasiv über der Aortenklappe vermessene mittlere Gradient betrug 16mmHg, es ließ sich nach der Gorlin-Formel bei einem Herzzeitvolumen von 2,48l/min eine Klappenöffnungsfläche von 0,62cm<sup>2</sup> berechnen. Die Rechtsherzkatheteruntersuchung ergab folgende Werte: rechter Ventrikel 48/4/18mmHg, rechtes Atrium 25/23/ 18mmHg, mittlerer pulmonalkapillärer Verschlussdruck 32mmHg, pulmonalarterieller Druck 56/29/40mmHg und somit eine sekundäre pulmonalarterielle Hypertension. <br />Zur weiteren Differenzierung und Abschätzung der kontraktilen Reserve wurde eine Dobutaminstressechokardiografie durchgeführt (Abb. 1). In dieser ergab sich weder eine Zunahme des Gradienten über der Aortenklappe noch des Schlagvolumens trotz Belastung bis auf 20µg/kg/min. Insgesamt konnte also keine relevante kontraktile Reserve nachgewiesen werden. Die Bestimmung des Kalziumscores ergab einen Wert von >5.000 Agatston als Hinweis auf eine schwere primäre Aortenklappenerkrankung.</p> <p>Somit lag bei dem Patienten die seltene Kombination einer schweren Aortenklappenstenose bei fehlender kontraktiler Reserve vor, eine Konstellation, die ein extrem hohes Risiko für ein perioperatives Myokardversagen aufweist, bei erfolgreicher Operation aber eine gute Langzeitprognose hat. Daher wurde der Patient an der Herzchirurgie der Medizinischen Universität Wien vorgestellt, um bei perioperativem myokardialem Versagen die Möglichkeit einer LVAD-Therapie („left ventricular assist device“) oder ultimativ auch Herztransplantation zu haben.</p> <p>Nach präoperativer Optimierung inklusive Levosimendan-Therapie konnte in weiterer Folge der mechanische Aortenklappenersatz erfreulicherweise komplikationslos durchgeführt werden. Im Verlauf des nächsten Monats kam es zu einer deutlichen Besserung der klinischen Symptomatik, einer Normalisierung des Gradienten über der Prothese, einer Verbesserung der Linksventrikelfunktion auf 30–35 % und einer Regredienz des mittleren pulmonalen Druckes auf ca. 30mmHg in der Echokardiografie. Nach 6 Monaten konnte sich der Patient wieder gut belasten (NYHA-Stadium I), es kam zu einer nahezu vollständigen Normalisierung der Linksventrikelfunktion bei weiterhin unauffälligem Befund an der Aortenklappenprothese und die diuretische Therapie konnte ausgeschlichen werden.</p> <h2>Diskussion</h2> <p>Als präferierte Untersuchungsmethode zur Evaluierung der Aortenklappenstenose wird die Echokardiografie beschrieben. Eine Stenose wird entsprechend den aktuellen Empfehlungen der ESC (Europäische Gesellschaft für Kardiologie) als schwer eingeschätzt, wenn die Aortenklappen­öffnungsfläche unter 1cm<sup>2</sup> liegt. Da die Planimetrie insbesondere bei stark verkalkten Klappen nur sehr unzuverlässige Messwerte liefert, soll die Abschätzung der Öffnungsfläche durch Bestimmung des transvalvulären Gradienten bevorzugt werden. Bei einer Flussgeschwindigkeit über 4m/s oder einem mittleren Gradienten über 40mmHg ist in aller Regel von einer hochgradigen Aortenklappenstenose auszugehen (Tab. 1). <img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Kardio_1604_Weblinks_seite40_1.jpg" alt="" width="" height="" /></p> <p>Ein spezielles Problem ist die Einschätzung des Schweregrades einer Aortenklappenstenose bei verkalkter Klappe und einem mittleren Gradienten zwischen 30 und 40mmHg. Hier soll in erster Linie versucht werden, durch Optimierung des Anlotungswinkels der Klappe in verschiedenen Schnitten (5-Kammer-Blick, 3-Kammer-Blick, rechts parasternaler Schnitt, suprasternaler Schnitt) der wahren maximalen Flussgeschwindigkeit nahezukommen, um eine schwere Aortenklappenstenose zu bestätigen. Da die Flussgeschwindigkeit/der mittlere Gradient über einer Klappe aber vom Schlagvolumen abhängig ist, kann es bei eingeschränkter Linksventrikelfunktion zu niedrigen Gradienten trotz hochgradiger Klappenstenose kommen, wie es in diesem Fall gezeigt worden ist. International wird von „Low-flow-low-gradient“-Aortenklappenstenose gesprochen. <br />In diesem Fall wird zur weiteren Differenzierung eine Stressechokardiografie empfohlen. Ein Anstieg des Gradienten bei Weiterbestehen einer errechneten Aortenklappenöffnungsfläche <1cm<sup>2</sup> spricht dabei dafür, dass es sich wirklich um eine schwere Aortenklappenstenose („true severe aortic stenosis“) handelt. Weitere Faktoren, die dafür sprechen, dass es sich tatsächlich um eine hochgradige Aortenklappenstenose handelt, sind eine schwerstverkalkte Klappe, Voruntersuchungen mit einem höheren Gradienten und ein spätes Flussmaximum. <br />Demgegenüber legt eine Zunahme des Schlagvolumens bei Konstanz des Druckgradienten unter Belastungsbedingungen ein primär myokardiales Problem nahe, wodurch sich die Klappe nicht so weit öffnet, wie sie könnte („pseudosevere aortic stenosis“). Außerdem spricht bei Patienten mit „Low-flow-low-gradient“-Aortenklappenstenose eine vorhandene kontraktile Reserve für eine eher günstige Prognose, während Patienten mit fehlender kontraktiler Reserve ein Höchstrisikokollektiv darstellen. Einer perioperativen Mortalität von 22 % mit einem konsekutiven 5-Jahres-Überleben von 65 % steht bei konservativem Vorgehen ein 5-Jahres-Überleben von 11 % gegenüber. <br />Besonders schwierig ist die Klärung der Kausalität bei einer Befundkonstellation wie im oben geschilderten Fall, in dem es im Rahmen der Dobutaminstressechokardiografie weder zu einer Zunahme des Schlagvolumens (fehlende kontraktile Reserve) noch zu einer Zunahme des Druckgradienten über der Aortenklappe kam. Die extrem verkalkte Klappe (Agatston-Score von über 5.000 Einheiten an der Klappe) und milde Koronarpathologie sprachen schließlich für eine primäre Klappenpathologie mit sekundärer Kardiomyopathie durch die chronische massive Nachlasterhöhung.</p> <p>Von den gerade genannten Entitäten muss die „Paradoxical low-flow“-Aortenklappenstenose unterschieden werden. Ein kleiner, steifer oder stark hypertrophierter linker Ventrikel kann trotz guter linksventrikulärer Pumpfunktion zu einem niedrigen Schlagvolumen und damit zu einem niedrigen Gradienten führen, obwohl eine hochgradige Aorten­klap­pen­stenose vorliegt. <img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Kardio_1604_Weblinks_seite40_2.jpg" alt="" width="" height="" /></p> <h2>Zusammenfassung</h2> <p>Nicht immer ist es einfach, die Kausalität zwischen valvulären und myokardialen Pathologien auf den ersten Blick zu erkennen. In dem hier dargestellten Fall hätte auch die linksventrikuläre Funktionseinschränkung (hervorgerufen zum Beispiel durch Ischämie, Fibrosierung, primäre Kardiomyopathie, …) das primäre Problem des Patienten sein können und die Aortenklappe zwar verkalkt, aber in ihrer Öffnung nur leicht- bis mittelgradig beeinträchtigt gewesen sein können. Auch diese Kon­stellation hätte die in der initialen Echokardiografie gemessenen Flussgeschwindigkeiten und Druckgradienten erklärt. Erschwerend kam hinzu, dass die Gabe von Dobutamin weder zu einer Zunahme des Druckgradienten noch des Schlagvolumens führte. Die weitgehend blande Koronarmorphologie und die starke Verkalkung der Klappe sprachen jedoch für die Aortenklappenstenose als primäre Pathologie. Bestätigt wurde dies durch den weiteren Verlauf und die fast vollständige Erholung der Linksventrikelfunktion nach Sanierung des Aortenklappenvitiums.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>bei der Verfasserin</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport
Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...
ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen
Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...
Inclisiran bei Patienten mit Statinintoleranz wirksam und sicher
Eine Analyse statinintoleranter Patienten aus dem Phase III Studienprogramm ORION zeigt, dass Inclisiran die LDL-Cholesterinspiegel kardiovaskulärer Hochrisikopatienten, die kein Statin ...


