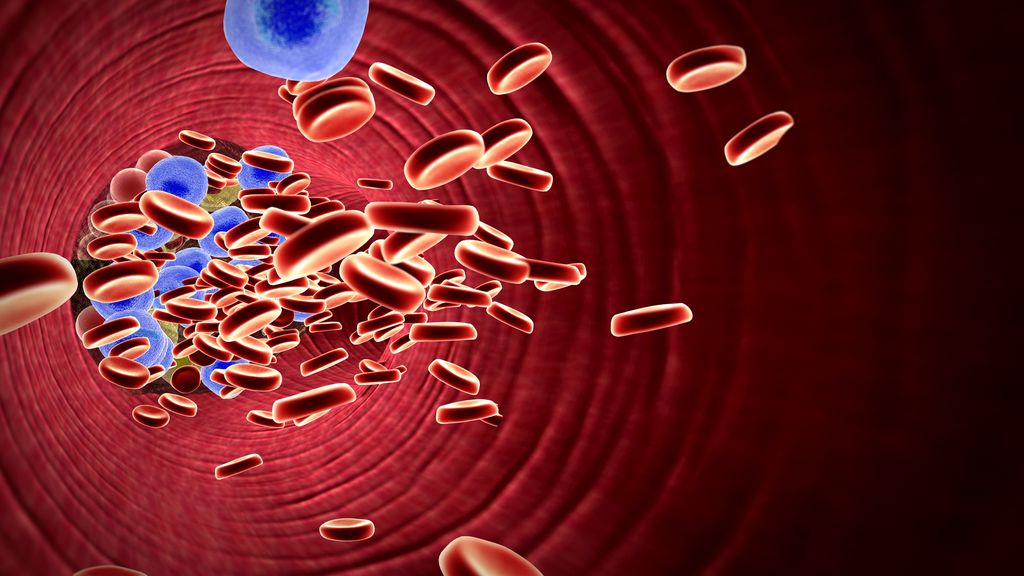
©
Getty Images/iStockphoto
Fettstoffwechsel und kardiovaskuläre Erkrankungen bei Diabetes
Jatros
30
Min. Lesezeit
07.11.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Diabetes, Fettstoffwechselstörungen und kardiovaskuläre Krankheiten hängen nicht nur eng zusammen und beeinflussen sich gegenseitig. Sie gehören auch zu den häufigsten Krankheiten in den Industrieländern. Das am LKH Feldkirch angesiedelte Forschungsinstitut VIVIT (Vorarlberg Institute for Vascular Investigation and Treatment) hat sich der angewandten Erforschung dieser Krankheiten verschrieben. Prof. Heinz Drexel, Leiter des VIVIT, berichtet von den Schwerpunkten der Arbeit und neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p><strong>Welches sind die Schwerpunkte Ihrer Abteilung in der Diabetesforschung?<br /><br /> H. Drexel:</strong> Wir haben mehrere Schwerpunkte. Einer davon ist die Lipidforschung mit der Untersuchung von Fettstoffwechselstörungen bei Diabetespatienten. Dies ist sozusagen die Spitze des Eisbergs der Risikofaktorenforschung. In diesem Zusammenhang untersuchen wir auch die neuesten Risikofaktoren, die weltweit publiziert werden. Der zweite Schwerpunkt sind arterielle Erkrankungen unserer Patienten, also der Bereich der Arteriosklerose bei Diabetes. Wir haben dazu große Kohortenstudien mit Patienten, die an koronarer Herzkrankheit, peripherer Verschlusskrankheit, akutem Koronarsyndrom oder Herzinsuffizienz leiden, initiiert.<br /><br /><strong> Welche aktuellen Erkenntnisse gibt es zu Dyslipidämien?<br /><br /> H. Drexel:</strong> Hier gibt es neue Studien zum HDL und LDL. Das HDL wurde schon seit Ende der 1980er-Jahre bis etwa 2010 intensiv erforscht, da man herausgefunden hatte, dass ein niedriger HDL-Spiegel mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko assoziiert ist. Wir haben in unseren Kohortenstudien ebenfalls festgestellt, dass bei Diabetes ein niedriges HDL-Cholesterin bedeutsamer für das kardiovaskuläre Risiko ist als ein hohes LDL-Cholesterin.<br /> Inzwischen betrachtet man HDL eher als einen Risikomarker und weniger als Risikofaktor, denn weitere Studien haben gezeigt, dass man durch eine Steigerung des HDL-Spiegels die Prognose der Patienten nicht verbessern konnte. Dann kam die Ära der Mendel’schen Randomisierung. Das ist eine Methode der Epidemiologie und Biostatistik, mit welcher der Einfluss veränderlicher Risikofaktoren bestimmt werden kann. Mit diesem Verfahren konnte gezeigt werden, dass LDLCholesterin ein starker kausaler Risikofaktor für Arteriosklerose ist: Patienten, die lebenslang einen hohen LDL-Spiegel haben, bekommen früher als andere eine Arteriosklerose. Man ist deshalb davon ausgegangen, dass für HDL-Cholesterin ein umgekehrter Zusammenhang besteht. Dies konnte jedoch nicht bestätigt werden. Im Gegenteil: Schon im vergangenen Jahr kam eine dänische Studie zu dem Ergebnis, dass bei Menschen, die von Geburt an einen sehr hohen HDLWert haben, das kardiovaskuläre Risiko ebenfalls erhöht ist. Und ganz aktuell wurde bei der ESC-Jahrestagung eine Studie vorgestellt, die auch zu dem Schluss kam, dass ein sehr hoher HDLSpiegel mehr schadet als nützt. Der Hintergrund ist, dass bei niedrigem HDL der Cholesterintransport aus den Gefäßen zur Leber eingeschränkt ist. Bei sehr hohem HDL wird zwar Cholesterin aus den Gefäßen aufgenommen, es kann aber in der Leber nicht in gleichem Maß aufgenommen werden und zirkuliert daher weiter im Blutkreislauf, was schädlich ist. Dies ist allerdings nur bei etwa einem Prozent der Bevölkerung der Fall, also eher eine Ausnahme.<br /><br /> <strong>Und welche neuen Erkenntnisse gibt es zum LDL-Cholesterin?<br /><br /> H. Drexel:</strong> Beim LDL ist durch die Mendel’sche Randomisierung tatsächlich die Kausalität bewiesen, dass es Arteriosklerose verursacht. Daher lautet die Devise mittlerweile „so niedrig wie möglich“. Für Patienten mit Herz- und Gefäßkrankheiten wurde in den derzeit aktuellen Leitlinien ein Zielwert von maximal 70mg/dl definiert. Die Leitlinien werden aber gerade überarbeitet. Dann wird der Zielwert wahrscheinlich noch weiter gesenkt werden. Es gibt inzwischen sehr wirksame Therapien, mit denen man eine starke LDL-Senkung erreichen kann, etwa die PCSK9-Hemmer. Wir konnten als eines der Zentren, die an der weltweiten ODYSSEY-Outcomes- Studie beteiligt waren, zeigen, dass diese Medikamente die Prognose der Patienten entscheidend verbessern. Manche Forscher fragen sich mittlerweile, ob der Körper das LDL überhaupt benötigt, denn dieser hat auch andere Transportsysteme für Cholesterin zur Verfügung.<br /><br /> <strong>Was kann in der Prävention von kardiovaskulären Ereignissen bei Diabetikern verbessert werden?<br /><br /> H. Drexel:</strong> Hier spielt neben der Therapie der Fettstoffwechselstörungen und des Bluthochdrucks vor allem die optimale Einstellung des Blutzuckers mit Medikamenten eine große Rolle. In diesem Bereich wurden in den vergangenen Jahren erhebliche Fortschritte erzielt. So verbessern die SGLT2-Hemmer und die GLP-1-Agonisten im Gegensatz zu den älteren Wirkstoffen die Prognose hinsichtlich kardiovaskulärer Krankheiten deutlich.<br /><br /><strong> Seit einiger Zeit gewinnen neben den Resultaten von RCTs sogenannte Real- World-Daten an Bedeutung. Warum sind sie wichtig?<br /><br /> H. Drexel:</strong> Alle unsere Kohortenstudien sind im Grunde Real-World-Untersuchungen. Daneben sind wir natürlich auch an randomisierten Studien beteiligt, zuletzt zum Beispiel an der ODYSSEY-Outcomes- Studie. Die randomisierten klinischen Studien sind unverzichtbar zum Beweis der Wirksamkeit eines Medikaments. Mit den Kohortenstudien wird untersucht, ob das in den randomisierten Studien gefundene Ergebnis auch in der „wahren Welt“ zu reproduzieren ist. Man kann zum Beispiel Patienten, die unterschiedliche Diabetesmedikamente bekommen, miteinander vergleichen. Das Problem dabei ist, dass die Selektion der Medikamente subjektiv ist, je nachdem, welche Therapie dem behandelnden Arzt am geeignetsten erscheint.<br /><br /><strong> Sie haben die Teilnahme an internationalen Studien erwähnt. Haben Sie aktuell auch eigene Studien aufgelegt?<br /><br /> H. Drexel:</strong> Ja, wir haben einige Studien begonnen bzw. geplant. Derzeit konzentrieren wir uns sehr stark auf die Langzeitergebnisse von Studien, die vor etwa 18 Jahren angefangen haben. Wir wollen sehen, ob auf lange Sicht Indikatoren bestehen, die das Überleben der Patienten verbessern. Dazu zählen beispielsweise bestimmte Hormone aus dem Fettgewebe, wie auch das Fettgewebe generell ein Fokus unserer Arbeit ist. Außerdem untersuchen wir die Zusammenhänge von Stoffwechsel und Herzinsuffizienz sowie die Arteriosklerose der peripheren Gefäße. Darüber hinaus interessieren uns die Unterschiede von Männern und Frauen bei diesen Krankheiten.<br /><br /> <strong>Benötigen Sie für diese Studien noch Zuweisungen?<br /><br /> H. Drexel:</strong> Ja, absolut! Uns interessieren Patienten mit Herzkrankheiten, zum Beispiel mit koronarer Herzkrankheit oder Herzinsuffizienz, und mit Störungen der Blutfette, unabhängig davon, ob sie Diabetes haben oder nicht. Für weitere Informationen hinsichtlich der Einund Ausschlusskriterien sowie des Studiendesigns stehe ich gerne zur Verfügung.<br /><br /><strong> Wo liegen die Herausforderungen im Bereich Diabetesforschung speziell in Ihrem Institut? Was wünschen Sie sich für die Zukunft Ihrer Forschung?<br /><br /> H. Drexel:</strong> Wir würden uns genug finanzielle Mittel wünschen, damit wir alle unsere Ideen und Forschungsvorhaben auch umsetzen können.<br /><br /> <strong>Vielen Dank für das Gespräch!</strong></p></p>
Das könnte Sie auch interessieren:
ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport
Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...
ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen
Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...
Inclisiran bei Patienten mit Statinintoleranz wirksam und sicher
Eine Analyse statinintoleranter Patienten aus dem Phase III Studienprogramm ORION zeigt, dass Inclisiran die LDL-Cholesterinspiegel kardiovaskulärer Hochrisikopatienten, die kein Statin ...


