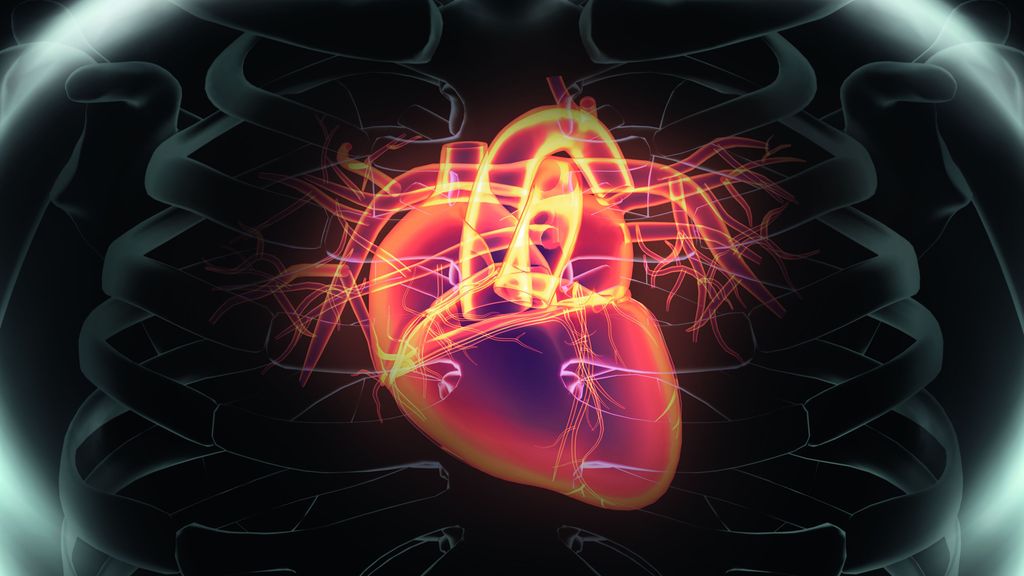
©
Getty Images/iStockphoto
Ein Drittel aller Todesfälle infolge Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Leading Opinions
30
Min. Lesezeit
31.08.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die Guidelines-Session an der SGK-Jahresversammlung diente vor allem dazu, wichtige Aspekte der kardiovaskulären Prävention und des Managements bei Vorhofflimmern zu repetieren. Ein grosser Teil aller Todesfälle ist durch kardiovaskuläre Erkrankungen verursacht. In der Herzinfarktbehandlung sind in den letzten 20 Jahren jedoch grosse Fortschritte gemacht worden, wie die Daten des «AMIS Plus»-Registers zeigen.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Annähernd 56 000 Patienten sind seit 1997 in AMIS Plus, «Swiss registry of acute coronary syndrome», das grösste Herzinfarktregister, eingeschlossen worden. Zu mehr als 10 000 von ihnen existieren Daten mit einem Follow-up von einem Jahr.<br /> Die reichhaltige Datensammlung zeigt die Trends der letzten 20 Jahre in der Diagnostik und Behandlung von Patienten mit akutem Koronarsyndrom (ACS) und liefert Informationen zum Outcome ein Jahr danach. An einer Veranstaltung zum 20-jährigen Jubiläum von AMIS Plus, im Rahmen der SGK-Jahrestagung, informierte Dr. med. Dragana Radovanovic, Leiterin des Datenzentrums, über einige wichtige Ergebnisse des Registers. So zeigen die retrospektiven Daten, dass das Durchschnittsalter für einen Nicht-ST-Hebungsinfarkt (NSTEMI) oder ST-Hebungsinfarkt (STEMI) seit 1997 bei Frauen mit 72,2 bzw. 71,3 Jahren und bei Männern mit 65,6 bzw. 62,8 Jahren nahezu unverändert geblieben ist. Eine Veränderung zeichnet sich dagegen bei den kardiovaskulären (CV) Risikofaktoren ab: Während die Prävalenz von Hypertonie und Hypercholesterinämie insgesamt hoch ist, hat die Bedeutung des Tabakkonsums als Risikofaktor für eine CV Erkrankung bei den Frauen in den letzten Jahren zugenommen.<br /> Grosse Veränderungen hat es seit dem Beginn der Datensammlung bei der ACSBehandlung gegeben. Wurden 1997 gerade mal 10 % der STEMI-Patienten mit einer primären Reperfusionstherapie mittels perkutaner Koronarintervention (PCI) behandelt, sind es heute mehr als 90 % . Die angestrebte «door-to-ballon time» von weniger als 90 Minuten wird heute bei ca. 75 % der Patienten erreicht. Dagegen vergeht mit ca. 180 Minuten noch immer zu viel Zeit, bis die Betroffenen nach dem Auftreten der Symptome medizinische Hilfe erhalten. Durch das verbesserte ACSManagement traten während des Spitalaufenthalts weniger häufig schwere Komplikationen wie beispielsweise ein kardiogener Schock auf. Darüber hinaus konnte die Mortalitätsrate über den gesamten Beobachtungszeitraum hinweg um jährlich 5 % reduziert werden. Wie die Daten zeigen, sterben auch heute noch mehr Frauen als Männer an den Folgen eines Herzinfarkts. Die Behandlungsunterschiede zwischen Frauen und Männern werden dagegen zunehmend kleiner.<sup>1</sup></p> <h2>Kardiovaskuläre Prävention und Behandlung der Dyslipidämien</h2> <p>Den aktuellen Daten des European Heart Network zufolge sind ein Drittel der Todesfälle in der Schweiz auf CV Erkrankungen zurückzuführen.<sup>2</sup> «Diese treten als Folge eines Zusammenspiels multipler und miteinander interagierender Risikofaktoren auf», erklärte Dr. med. Pedro- Manuel Marques-Vidal von der Klinik für Innere Medizin am Universitätsspital in Lausanne. Das Screening auf Risikofaktoren, inkl. Lipidprofils, ist bei Männern über 40 und bei Frauen über 50 Jahren empfohlen. Zur Einschätzung des CV Risikos empfiehlt die ESC das SCORE-System zur Berechnung des 10-Jahres-Risikos für tödliche atherosklerotische Ereignisse.<sup>3</sup> «Bei Personen mit Diabetes mellitus (DM), Nierenerkrankungen und kardiovaskulären Erkrankungen erübrigt sich die Risikoeinschätzung », sagte Marques-Vidal. Diese gehören zur Gruppe der Hochrisikopatienten, die behandelt werden müssen.<br /> Um das Risiko für CV Erkrankungen zu reduzieren, sollten möglichst viele Risikofaktoren gleichzeitig beeinflusst werden. Einer der Hauptrisikofaktoren ist die Hypercholesterinämie (HC). Die Behandlung der HC richtet sich nach dem CV Risiko und dem LDL-C-Wert und reicht von alleinigen Lifestyleänderungen bis zur Kombination mit einer medikamentösen Therapie. Mittel der ersten Wahl zur Behandlung der HC sind Statine. Werden die LDL-C-Zielwerte (Tab. 1) mit Statinen nicht erreicht oder besteht eine Unverträglichkeit gegenüber den Substanzen, wird die Behandlung mit dem Cholesterin- Resorptionshemmer Ezetimib (Ezetrol<sup>®</sup>) oder Nicht-Statinen empfohlen. «Als die aktuellen Guidelines geschrieben wurden, lagen noch keine Ergebnisse von randomisierten, kontrollierten Studien (RCT) mit PCSK-9-Inhibitoren vor», sagte Marques- Vidal. In den Guidelines wird aber bereits darauf hingewiesen, dass eine Therapie mit den neuen Substanzen bei Hochrisikopatienten erwogen werden kann, wenn die LDL-C-Zielwerte mit den herkömmlichen Therapien nicht erreicht werden.<br /> Bevor eine medikamentöse Behandlung der HC begonnen wird, sollten die Lipide zweimal im Abstand von mindestens acht Wochen bestimmt werden. Davon ausgenommen sind Patienten mit einem hohen Risiko, bei denen direkt mit der Therapie begonnen werden kann. Bis der LDL-C-Zielwert erreicht ist, sollte der Lipidstatus alle zwei Monate kontrolliert werden. Danach ist die jährliche Kontrolle ausreichend.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Leading Opinions_Innere_1704_Weblinks_s42.jpg" alt="" width="1435" height="545" /></p> <h2>Behandlung von Patienten mit Vorhofflimmern</h2> <p>Die ESC empfiehlt, bei über 65-jährigen Patienten ein opportunistisches und bei über 75-jährigen ein systematisches Screening auf Vorhofflimmern (VHF) durchzuführen. Die Suche nach einem VHF wird auch bei Patienten nach TIA oder Schlaganfall empfohlen und sollte Teil der regelmässigen Kontrolle bei Personen mit einem Schrittmacher oder ICD sein.<sup>4</sup> «Bevor eine spezifische Behandlung begonnen wird, sollte unbedingt eine objektive Dokumentation des VHF mittels EKG oder Holter-EKG erfolgen», rät Dr. med. Stefano Benussi vom Universitären Herzzentrum in Zürich. Das integrierte VHF-Management umfasst fünf Punkte (Abb. 1). Im Fokus der akuten Versorgung steht die Frequenz- und Rhythmuskontrolle zur Verbesserung der hämodynamischen Stabilität. Mit der Umstellung der Lebensgewohnheiten soll das CV Risiko reduziert werden. «Neuere Studien zeigen, dass Massnahmen wie eine Gewichtsreduktion oder die Behandlung einer Schlafapnoe den Herzrhythmus positiv beeinflussen können», so Benussi. Von prognostischer Bedeutung ist vor allem die orale Antikoagulation (OAK) zur Schlaganfallprophylaxe. Die langfristige Frequenzkontrolle führt zu einer Verbesserung der Symptome und zu einem gewissen Grad auch der linksventrikulären Auswurffraktion (LVEF) und steht in der Behandlungsabfolge immer vor der Rhythmuskontrolle.<br /> Der Entscheid zur OAK wird anhand des CHA<sub>2</sub>DS<sub>2</sub>VASc-Scores gestellt. Die ESC empfiehlt, zur OAK bei VHF bevorzugt direkte orale Antikoagulanzien (DOAK) einzusetzen. Die Behandlung mit Vitamin-K-Antagonisten (VKA) ist indiziert bei Patienten mit mechanischen Herzklappen oder moderater bis schwerer Mitralstenose. Ist eine Behandlung mit OAK nicht möglich, sollte der Verschluss des linken Vorhofohrs («Left atrial appendage [LAA]»-Verschluss) erwogen werden. Mithilfe des HAS-BLED-Scores können die modifizierbaren Risikofaktoren für eine Blutungskomplikation unter OAK optimiert werden.<br /> «Jede Intervention zur Verbesserung von Rhythmus und Frequenz bei Patienten mit VHF sollte sich am modifizierten EHRA-Score ausrichten, mit dem die funktionelle Performance der Betroffenen erfasst werden kann», so Benussi. Das Ziel der elektrischen oder medikamentösen Kardioversion ist eine Herzfrequenz (HF) unter 110/min. Die Wahl der Medikamente ist abhängig von der LVEF. Wie bei der Frequenzkontrolle auch ist der Nutzen der Rhythmuskontrolle vor allem eine Symptomverbesserung. «Bis jetzt gibt es keine Studien, die zeigen, dass die Prognose durch eine Rhythmuskontrolle mit moderaten Ablationsstrategien verbessert werden kann», so der Herzchirurg. Für die medikamentöse Rhythmuskontrolle steht eine Vielzahl von Medikamenten zur Verfügung. Aufgrund der zum Teil ernsthaften unerwünschten Wirkungen empfiehlt der Spezialist, sich bei der Wahl am individuellen Patientenrisiko zu orientieren. Bei Patienten mit refraktärem, symptomatischem VHF und medikamentösem Therapieversagen ist die Katheterablation die erste Wahl. «Die Häufigkeit signifikanter Komplikationen liegt bei dieser Behandlung bei 5–6 % ; die Patienten sollten darüber informiert werden», so Benussi. Zwei wichtige Neuigkeiten in den ESC-Guidelines, die dem Spezialisten besonders am Herzen liegen, sind die Empfehlungen zur operativen VHF-Behandlung sowie die Betonung eines integrierten Ansatzes bei der Versorgung von Patienten mit VHF.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Leading Opinions_Innere_1704_Weblinks_s42-2.jpg" alt="" width="1419" height="929" /></p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für
Kardiologie (SGK), 7.–9. Juni 2017, Baden
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Radovanovic D et al.: Temporal trends in treatment of ST-elevation myocardial infarction among men and women in Switzerland between 1997 and 2011. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care 2012; 1: 183-91 <strong>2</strong> www.ehnheart.org <strong>3</strong> Catapano AL et al.: 2016 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: The Task Force for the Management of Dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS) developed with the special contribution of the European Assocciation for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Atherosclerosis 2016; 253: 281-344 <strong>4</strong> Kirchhof P et al.: 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J 2016; 37: 2893-962</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport
Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...
ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen
Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...
Inclisiran bei Patienten mit Statinintoleranz wirksam und sicher
Eine Analyse statinintoleranter Patienten aus dem Phase III Studienprogramm ORION zeigt, dass Inclisiran die LDL-Cholesterinspiegel kardiovaskulärer Hochrisikopatienten, die kein Statin ...


