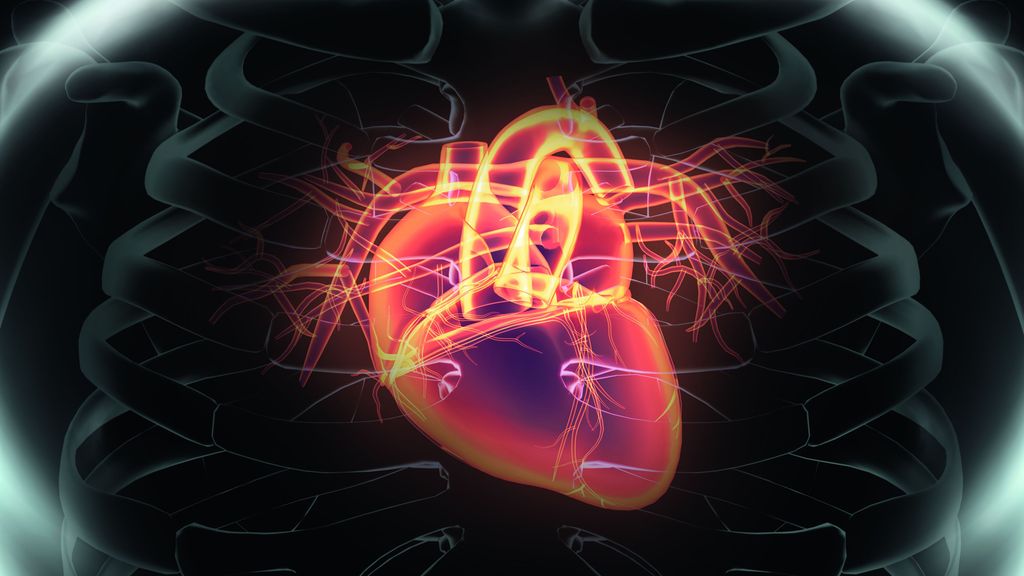
©
Getty Images/iStockphoto
Die stationäre kardiologische Rehabilitation in Österreich
Jatros
Autor:
Prim. Priv.-Doz. Mag. Dr. Thomas Berger
SKA-RZ Saalfelden<br> Ludwig Boltzmann Cluster für Arthritis und Rehabilitation<br> E-Mail: kardio.freistadt@gmail.com
30
Min. Lesezeit
31.05.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">In den letzten Jahren war eine Zunahme der Aufwendungen für Rehabilitation und Gesundheitsvorsorge zu verzeichnen, die jedoch auf eine qualitative Leistungsverbesserung zurückzuführen ist. Dennoch sollte in Zukunft auch die „awareness“ für primäre und sekundäre Präventionsmaßnahmen gefördert werden.</p>
<hr />
<p class="article-content"><h2>Definition</h2> <p>Laut Definition der Weltgesundheitsorganisation versteht man unter Rehabilitation die Summe aller Maßnahmen, die erforderlich sind, um den bestmöglichen körperlichen, geistigen und sozialen Zustand der Patienten sicherzustellen, damit sie aus eigener Kraft wieder einen möglichst normalen Platz in der Gesellschaft einnehmen und ein aktives Leben führen können.</p> <p>Hauptelemente in der stationären Rehabilitation sind dabei die Optimierung der medikamentösen Therapie entsprechend den aktuellen Leitlinien, die Durchführung einer strukturierten medizinischen Trainingstherapie, die Teilnahme an Schulungen über die jeweilige Erkrankung und deren Risikofaktoren, diätologische Beratungen sowie die Möglichkeit einer psychologischen Betreuung (Tab. 1).<br /> Die Qualifikation für eine Rehabilitation ist abhängig von einer entsprechenden medizinischen Indikation (Rehabilitationsbedürftigkeit), der Rehabilitationsfähigkeit und eines entsprechenden Rehabilitationspotenzials.</p> <h2>Struktur</h2> <p>Die Kompetenzen für die Durchführung rehabilitativer Maßnahmen sind entsprechend den jeweiligen Sozialversicherungsträgern in Österreich relativ klar geregelt. Es gibt prinzipiell drei Versicherungsträger, die in Abhängigkeit von der jeweiligen Ursache (z.B. Arbeitsunfall, Berufskrankheit) oder vom Versicherungsstatus (Erwerbstätigkeit, Ruhestand) für die Leistungserbringung verantwortlich sind.<br /> In Österreich besteht grundsätzlich ein Anspruch (und kein Recht) auf rehabilitative Maßnahmen (§ 300–307c ASVG). Dieser Anspruch ist als Sachleistung beziehbar, d.h., es kann die Durchführung einer stationären Rehabilitation erfolgen (nicht jedoch die Ausbezahlung einer Geldleistung). Zusätzlich ist gegebenenfalls vom Rehabilitanden eine Zuzahlung in Abhängigkeit des Einkommens zu leisten. Die rehabilitativen Maßnahmen sind direkt vom Versicherten beim jeweiligen Versicherungsträger zu beantragen. Nach Prüfung des Antrages erfolgt eine Entscheidung bezüglich Bewilligung bzw. Ablehnung mittels Bescheid (Abb. 1). Eine stationäre kardiologische Rehabilitation ist je nach Versicherungsträger in einer der 13 Rehabilitationseinrichtungen möglich (Tab. 2).<br /> Generell wird die Rehabilitation in mehrere Phasen unterteilt (Tab. 3). Die stationäre kardiologische Rehabilitation entspricht in der Regel der Phase 2 im Phasenmodell. Im Gegensatz zu den meisten anderen europäischen Ländern gibt es in Österreich die Möglichkeit, die Rehabilitation entweder stationär oder je nach Angebot auch wohnortnahe in einer ambulanten kardiologischen Rehabilitationseinrichtung zu absolvieren.</p> <h2>Wirtschaftliche Aspekte</h2> <p>Das Ziel der medizinischen Rehabilitation ist bei berufstätigen Personen eine möglichst rasche Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess, bei bereits im Ruhestand befindlichen Personen eine Reduktion des Pflegebedarfs bzw. die Erhaltung der Selbstständigkeit. So konnte durch die Intensivierung des kardiologischen Rehabilitationsangebots die Anzahl der Neuzugänge zur Berufsunfähigkeits-/Invaliditätspension aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Beobachtungszeitraum von 2004 bis 2013 deutlich reduziert werden.<br /> Insgesamt ist in den letzten Jahren eine Zunahme der Aufwendungen für Rehabilitation und Gesundheitsvorsorge zu beobachten. Allerdings kann hier eine qualitative Leistungsverbesserung, aufgrund der Zunahme der medizinischen Rehabilitationsaufenthalte im Vergleich zu den Kuraufenthalten, festgestellt werden. Zudem sind aktuell auch Programme für eine weitere qualitative Verbesserung der bestehenden Kurprogramme („Gesundheitsvorsorge aktiv“) geplant bzw. in Umsetzung.<br /> In einer Untersuchung der Prognos AG konnte z.B. gezeigt werden, dass pro investiertem Euro über Umwegrentabilität ein volkswirtschaftlicher Nutzen von fünf Euro entsteht. Zudem rechtfertigt sich eine stationäre Rehabilitation laut volkswirtschaftlichen Berechnungen, sobald es z.B. gelingt, den Eintritt einer Arbeitsunfähigkeit für sechs Monate hintanzuhalten. Dies ist eines der Argumente für das rezente Programm der Rehabilitation vor krankheitsbedingter Frühpension („Rehageld“).</p> <h2>Wissenschaftliche Evidenz</h2> <p>Mittlerweile gibt es eine breite wissenschaftliche Evidenz hinsichtlich der Wirksamkeit der kardiologischen Rehabilitation auf Basis mehrerer Metaanalysen. Diese zeigten durchgehend einen positiven Effekt in Bezug auf die kardiovaskuläre Mortalität. In einer 2016 publizierten Cochrane- Metaanalyse von 47 randomisierten Studien (insgesamt 10 764 Patienten) konnte eine relative Reduktion des Risikos von 26 % hinsichtlich der kardiovaskulären Sterblichkeit nachgewiesen werden. Rezent wurde in einer großen Studie (Daten von 35 919 Patienten aus einer Versicherungsdatenbank) in den Niederlanden ein deutlicher Überlebensvorteil für Patienten, die sich einem kardiologischen Rehabilitationsprogramm unterzogen hatten, nachgewiesen (Abb. 2).</p> <h2>Herausforderungen</h2> <p>Aufgrund der aktuellen demografischen Entwicklungen ist auch in Zukunft mit keinem Rückgang des Rehabilitationsbedarfs infolge von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu rechnen. Gerade deshalb sind neben der Sekundärprävention auch die Erfassung von Patienten mit einem ausgeprägten kardiovaskulären Risiko und vor allem die Einleitung primärpräventiver Maßnahmen essenziell. So werden in den aktuellen Leitlinien der europäischen kardiologischen Gesellschaft auch Präventionsmaßnahmen auf sozialmedizinischer Ebene gefordert. In diesen Empfehlungen werden z.B. Kennzeichnungspflichten, Steuern und Verbote gesundheitsgefährdender Lebens-/Genussmittel auf (inter)- nationaler Ebene gefordert und es werden auch entsprechende konkrete Maßnahmen (z.B. eingeschränkte Verkaufszeiten für Alkohol/Tabak etc.) angeführt. Darüber hinaus werden gesundheitsbildende Maßnahmen in den Schulen, wie strukturierter Schulsport in ausreichendem Ausmaß (mind. 3h/Woche) oder Unterricht über gesunde Ernährung, gefordert.<br /> Für die Zukunft ist eine Erhöhung der „awareness“ sowohl der Patienten als auch der Ärzteschaft für primär- und sekundärpräventive Maßnahmen (Lebensstilmodifikation, Zielwerteinstellung etc.), gerade auch in Anbetracht der guten Evidenzlage, zu fordern.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Kardio_1702_Weblinks_ka1702-seite79_tab1+2+3+abb1+2.jpg" alt="" width="2150" height="1885" /></p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>beim Verfasser</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport
Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...
ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen
Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...
Inclisiran bei Patienten mit Statinintoleranz wirksam und sicher
Eine Analyse statinintoleranter Patienten aus dem Phase III Studienprogramm ORION zeigt, dass Inclisiran die LDL-Cholesterinspiegel kardiovaskulärer Hochrisikopatienten, die kein Statin ...


