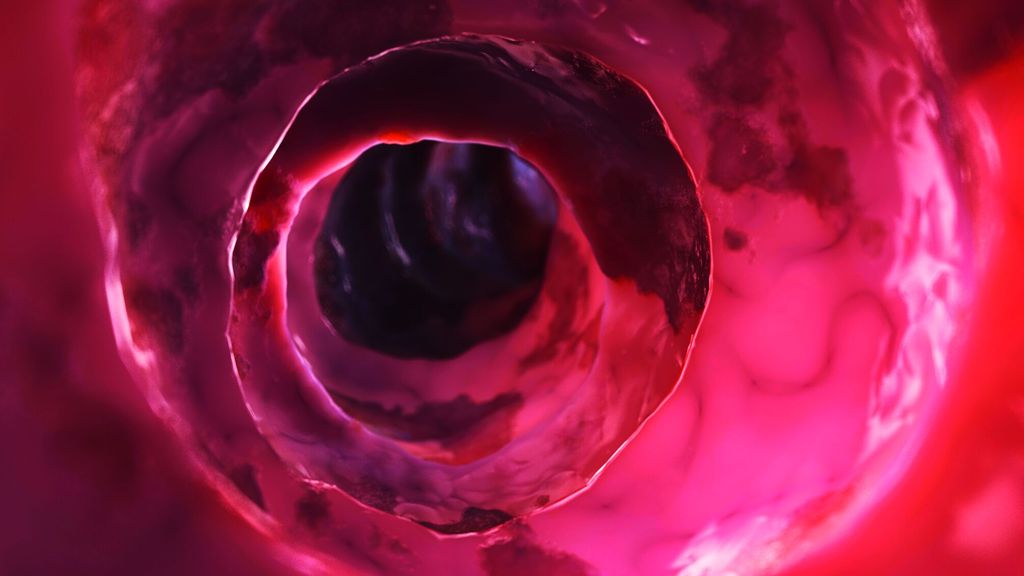
©
Getty Images/iStockphoto
Baroreflex-Aktivitätstherapie bringt funktionelle Verbesserung bei HI-Patienten
Jatros
Autor:
Dr. Thomas Sturmberger
Interne 2<br> Kardiologie, Angiologie & Interne Intensivmedizin<br> Ordensklinikum Linz<br> E-Mail: thomas.sturmberger@ordensklinikum.at
30
Min. Lesezeit
28.02.2019
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Herzinsuffizienzpatienten sind in ihrer Leistungsfähigkeit und Lebensqualität nachhaltig eingeschränkt. Trotz etablierter Standardtherapie und Umstellung auf ARNI verbleibt ein Teil der Patienten aus unterschiedlichen Gründen im NYHA-Stadium III. Für diese Patienten ist einer ersten Studie zufolge eine Baroreflex- Aktivitätstherapie eine mögliche Option.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Die Europäischen Guidelines für die Behandlung der Herzinsuffizienz mit eingeschränkter Linksventrikelfunktion geben einen sehr strukturierten Entscheidungsbaum mit Therapieempfehlungen wieder. Sollten Patienten unter Einnahme der Basismedikamente ACE-Hemmer oder Angiotensinrezeptorblocker, Betablocker und Mineralokortikoidantagonisten weiterhin symptomatisch sein, können zusätzliche Maßnahmen wie Umstellung auf Angiotensinrezeptorblocker-Neprilysininhibitoren, Ivabradin oder Resynchronisationstherapie geprüft werden. Trotz dieser etablierten Therapiemöglichkeiten verbleiben etwa 25–35 % im NYHA-Stadium III, wobei wiederum ein großer Anteil dieser Patienten für weitere Therapieoptionen wie Assist-Device oder Herztransplantation nicht infrage kommt.</p> <h2>Baroreflex-Aktivitätstherapie</h2> <p>Die Baroreflex-Aktivitätstherapie (BAT) ist ein innovatives gerätebasiertes Therapieverfahren, welches bei Herzinsuffizienz eine gute Ergänzung zur medikamentösen Therapie sein könnte. Bei Herzinsuffizienz besteht bekanntlich eine Überaktivität des Sympathikotonus, bei gleichzeitig reduzierter Aktivität des Parasympathikus. Dadurch wird die Progression der Herzinsuffizienz begünstigt.<br /> Die BAT soll, wie im Fall prognostisch erfolgreicher medikamentöser Therapien, die mit der Herzinsuffizienz einhergehenden neurohumoralen Veränderungen günstig beeinflussen. Beim BAT-Verfahren werden über eine Sonde am Karotissinus die Barorezeptoren kontinuierlich über elektrische Impulse stimuliert. Dadurch werden afferente und efferente Bahnen des vegetativen Nervensystems so beeinflusst, dass eine Dämpfung des Sympathikotonus und eine Aktivierung des Parasympathikus resultieren.</p> <h2>Technische Prozedur</h2> <p>Vor Implantation eines Systems zur Baroreflexstimulation (BarostimNeo der Firma CVRx; Abb. 1) müssen zunächst höhergradige Stenosen im Bereich der A. carotis communis oder A. carotis interna ausgeschlossen werden. Das BAT-System wird in einer minimal invasiven Prozedur in der Regel durch einen Gefäßchirurgen innerhalb von rund 1,5 Stunden implantiert, wobei im Gegensatz zu Schrittmacherimplantationen keine Röntgendurchleuchtung erforderlich ist. Nach Freilegung der A. carotis communis wird die Karotisbifurkation so weit freipräpariert, dass man die Elektrode problemlos auf den Abgang der A. carotis interna platzieren kann (Abb. 2, 3). Dann testet der Chirurg das System, indem er die Elektrode mit der Stimulationsfläche auf die Region an der A. carotis interna legt, an der das Glomus caroticum vermutet wird. Bei optimaler Position fallen binnen weniger Sekunden sowohl die Herzfrequenz als auch der Blutdruck ab, wobei es nach Beendigung der Stimulation zu einem raschen Wiederanstieg der beiden Parameter kommt. Nach Festnähen der Elektrode an der Arterienoberfläche und subkutaner Tunnelung in die Aggregattasche, welche im Bereich des rechten Brustmuskels präpariert wird, erfolgt ähnlich einer Schrittmacherimplantation die Elektrodenfixierung an das Gerät.<br /> Postoperativ bleibt das System vorerst inaktiviert, um eine Einheilungsphase zu gewährleisten. Nach etwa 2–3 Wochen erfolgt die Aktivierung ähnlich einer ICDEinstellung via Telemetrie. Beginnend mit einer niedrigen Aktivität steigert man dabei unter Kontrolle der Herzfrequenz und des Blutdruckverhaltens die Impulshöhe und -breite. Zu beachten ist, dass höhere Energieabgaben ein Missempfinden im Sinne von Dysästhesien im Hals bis hin zu Heiserkeit auslösen können.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Kardio_1901_Weblinks_jatros_kardio_1901_s39_abb1-3.jpg" alt="" width="2150" height="1605" /></p> <h2>Erste positive Studienresultate</h2> <p>Eine kleine „Single center“-Studie konnte an Patienten mit einer LVEF < 40 % und einem NYHA-Stadium III neben der sicheren Implantation eine klinische Verbesserung, objektiviert durch 6-Minuten-Gehtest, NYHA-Stadium und QoL-Score, zeigen.<br /> In die randomisierte, kontrollierte Barostim- Hope4HF-Studie wurden 146 Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz mit einer LVEF < 35 % und einem NYHA-Stadium III eingeschlossen. Sowohl in der Kontrollgruppe (n=70) als auch in der BATGruppe (n=76) erhielten die Patienten eine leitliniengerechte Medikation. Die Patienten der BAT-Gruppe wurden zusätzlich mit einem implantierbaren Impulsgeber zur Barorezeptorstimulation versorgt (BarostimNeo des US-Herstellers CVRx, Minneapolis). Die meisten Teilnehmer (93 %) waren zuvor auch schon Träger diverser kardialer Implantate (CRT, ICD). Primärer Sicherheitsendpunkt waren geräte- oder prozedurbezogene neurologische oder kardiovaskuläre Komplikationen. Bei 97,2 % aller Teilnehmer ist keine entsprechende Komplikation aufgetreten. Die Effektivität der BAT wurde anhand der Veränderung der NYHA-Klasse, der Lebensqualität und der Belastungsbreite beurteilt. Eine klinische Verbesserung der NYHA-Klasse wurde signifikant häufiger in der BAT-Gruppe als in der Kontrollgruppe beobachtet (55 vs. 24 %, p=0,002). Auch bezüglich der Verbesserung der Lebensqualität (Minnesota QoL Score) schnitt die BAT-Gruppe signifikant besser ab als die Kontrollgruppe (–17,4 vs. 2,1 Scorepunkte, p < 0,001). Durch die BAT konnten auch die Biomarker (NT-proBNP) signifikant gesenkt werden (p=0,02). Die Zunahme der Gehstrecke beim 6-Minuten-Gehtest war ebenso signifikant stärker (59,6 m vs. 1,5 m, p=0,004). Interessanterweise wurden in der BATGruppe, deren Teilnehmer im Schnitt normotensive Blutdruckwerte hatten, keine Hypotensionen beobachtet. Vielmehr wurde in dieser Gruppe ein Anstieg des Blutdrucks festgestellt, möglicherweise als Ausdruck eines verbesserten Schlagvolumens aufgrund des reduzierten Gefäßwiderstandes.</p> <h2>Diskussion der Resultate</h2> <p>Einschränkend muss man natürlich auf die geringe Anzahl der Studienteilnehmer hinweisen. Des Weiteren können ein gewisser Placeboeffekt bei fehlender „Sham“- Kontrollgruppe und ein Bias bei fehlender Verblindung nicht ausgeschlossen werden. Die Ergebnisse einer multizentrischen Studie werden dieses Jahr erwartet. Weitere Studien sind auch erforderlich, um künftig den Stellenwert dieser Therapie einordnen zu können, denn derzeit wird in den ESCGuidelines erwähnt, dass zu wenig Daten vorliegen, welche den Einsatz dieser Methode, letztlich auch unter wirtschaftlichen Aspekten, unterstützen.</p> <h2>Fazit</h2> <p>Zusammenfassend hat die Barorezeptorstimulation bei symptomatischen, leitliniengerecht therapierten Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz mit reduzierter LVEF im NYHA-Stadium III günstige klinische Effekte und kann als sichere invasive Methode angesehen werden.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>beim Verfasser</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport
Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...
ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen
Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...
Inclisiran bei Patienten mit Statinintoleranz wirksam und sicher
Eine Analyse statinintoleranter Patienten aus dem Phase III Studienprogramm ORION zeigt, dass Inclisiran die LDL-Cholesterinspiegel kardiovaskulärer Hochrisikopatienten, die kein Statin ...


