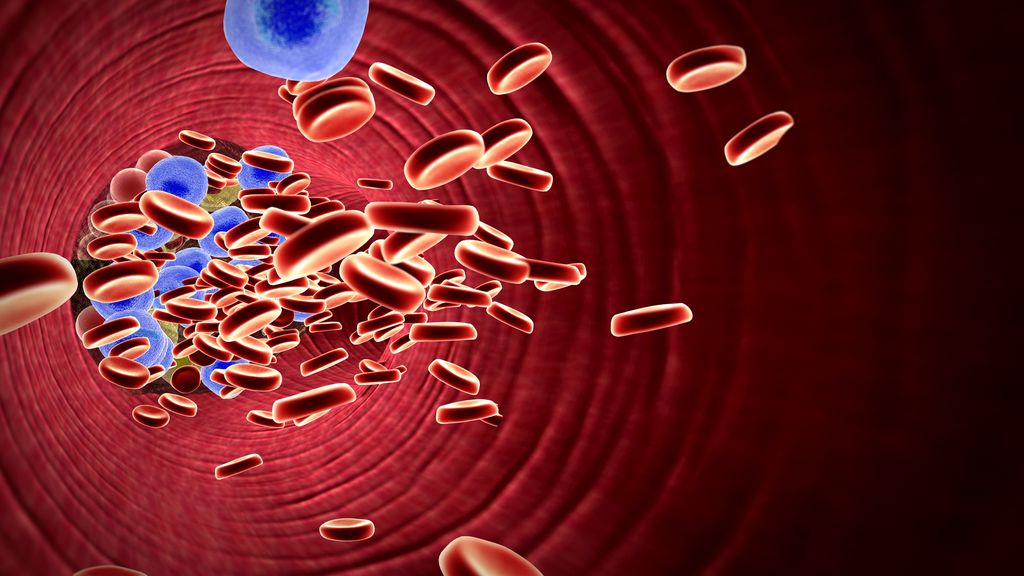<p class="article-intro">Die koronare Herzkrankheit (KHK) ist die häufigste Manifestation einer Herz-Kreislauf-Erkrankung (HKE) und für etwa die Hälfte aller Fälle von kardiovaskulärem Tod verantwortlich; sie ist mit einer erheblichen Einschränkung der Lebensqualität verbunden. Dabei könnten Morbidität und Mortalität durch adäquate Umsetzung der empfohlenen Präventionsmaßnahmen deutlich verringert werden.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Die koronare Herzkrankheit (KHK) ist für etwa die Hälfte aller kardiovaskulären Todesfälle verantwortlich und gehört damit zu den häufigsten Todesursachen.</li> <li>Schlaganfälle, Reinfarkte, Herzinsuffizienz und Blutungen stellen weitere wichtige Komplikationen der KHK dar und verursachen erhebliche Kosten.</li> <li>Nahezu 2,5-mal so viele Männer wie Frauen unter 65 Jahren sterben an KHK trotz vergleichbarer Sterblichkeit bei Betrachtung aller Altersgruppen.</li> <li>Speziell in den wohlhabenderen Regionen der Welt hat sich die altersangepasste KHK-Mortalitätsrate seit den 1980er-Jahren deutlich vermindert.</li> <li>Gründe dafür sind die besseren Behandlungsmöglichkeiten akuter Manifestationen, inklusive der Sekundärprävention durch Rehabilitation, und die Verminderung der Inzidenz durch Risikofaktorenmanagement.</li> </ul> </div> <p>Klinische Ausprägungen der KHK sind Angina pectoris, akutes Koronarsyndrom, Myokardinfarkt mit/ohne ST-Hebung (STEMI und NSTEMI) und die stumme Ischämie. Die Lebenszeitprävalenz wird mit 7 % der über 20-Jährigen in USStatistiken und mit 2 % der über 14-Jährigen in Österreich beziffert, ist bei Männern und Menschen mit geringerer Bildung höher und steigt mit dem Alter.<br /> Eine KHK verkürzt die Lebenserwartung und schränkt die Lebensqualität erheblich ein. Im Vergleich zu STEMI haben NSTEMI eine bessere Kurzzeitprognose. Die Langzeitprognose ist allerdings bei NSTEMI gleich oder schlechter, weil deren Ursache öfter komplexe Dreigefäßerkrankungen sind. Abgesehen von Todesfällen stellen Folgeerkrankungen wie Schlaganfall, Reinfarkte, Herzinsuffizienz und Blutungen wichtige Komplikationen dar. Letztendlich sind kardiovaskuläre Erkrankungen teuer: In Österreich wurden 2008 rund 13 % der im öffentlichen Gesundheitssystem getätigten Ausgaben (1,3 Mrd. Euro) für HKE aufgewendet, davon 64 % für ischämische Herzkrankheiten.</p> <h2>Definitionen</h2> <p>Unter dem Begriff Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden Gefäßerkrankungen subsummiert, meist atherosklerotischer Genese, die alle Körperregionen betreffen können: vor allem die Koronargefäße (ICD-10-Codes I20–I25), die Zerebralgefäße (cAVK, I60–I69), die Beinarterien (pAVK, I70–I78), aber auch arterielle Hypertonie (I10–I15), Herzinsuffizienz (I50) und andere seltenere Manifestationen.<br /> Unter koronarer Herzkrankheit (KHK) werden Angina pectoris (AP), akutes Koronarsyndrom (ACS), Myokardinfarkt (MCI) mit ST-Hebung (STEMI) oder ohne (NSTEMI) und die stumme Ischämie zusammengefasst.</p> <h2>Epidemiologische Datenquellen</h2> <p>Eine optimale Datenbasis existiert nicht. Informationen über Morbidität und Mortalität werden aus nationalen Befragungen, Diagnose- und Leistungsdokumentationen von Krankenanstalten, Krankheitsregistern, longitudinalen Beobachtungen von definierten Populationen (Framingham Heart Study, Sieben-Länder- Studie, MONICA Project der WHO etc.) und Todesursachenstatistiken generiert. Die so gewonnenen Daten werden von verschiedenen Organisationen (WHO, NIH, OECD, IHME etc.) überregional zusammengefasst und publiziert.</p> <p>In Österreich können Aussagen auf Basis der „Österreichischen Gesundheitsbefragung“ (ATHIS), anhand der Diagnosenund Leistungsdokumentation österreichischer Krankenanstalten (DLD) und auf Grundlage der österreichischen Todesursachenstatistik (TUS) gemacht werden. Diese Quellen werden jedoch für ein umfassendes Public-Health-Monitoring als nicht ausreichend angesehen.<sup>1</sup></p> <h2>Mortalität</h2> <p>HKE sind in Europa und weltweit nach wie vor die häufigste Todesursache. Laut Schätzungen wurden 2013 weltweit 17,3 Mio. Todesfälle (das sind 31,5 % aller Todesfälle) durch HKE verursacht, doppelt so viele wie durch Krebs.<sup>2</sup> In der WHORegion Europa, die 53 Staaten umfasst, darunter Russland und zentralasiatische Staaten, waren laut rezenter Statistik 45 % aller Todesfälle durch HKE verursacht, 1,8 Mio. davon durch KHK (Tab. 1).<sup>3</sup><br /> In Österreich waren 2011 rund 43 % aller dokumentierten Todesfälle auf HKE zurückzuführen, mit einer rund 1,6-fach höheren Sterblichkeit von Männern und einem deutlichen Ost-West-Gefälle.<sup>1</sup> Die Mortalitätsraten nehmen generell mit dem Alter zu, unterscheiden sich aber in verschiedenen Ländern wesentlich. So haben zum Beispiel 50- bis 54-jährige Männer in Belarus, Russland und der Ukraine ein höheres Risiko, an einer KHK zu sterben, als Franzosen der Altersgruppe 75–79 Jahre.<sup>4</sup></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Kardio_1702_Weblinks_ka1702-seite72_tab1.jpg" alt="" width="1419" height="814" /></p> <p><strong>Gender</strong><br />Der größte Geschlechtsunterschied besteht in der vorzeitigen Sterblichkeit infolge KHK. Fast 2,5-mal so viele Männer wie Frauen unter 65 Jahren sterben an KHK trotz vergleichbarer Sterblichkeit bei Betrachtung aller Altersgruppen (Tab. 1).</p> <p><strong>Mortalitätstrends</strong><br />Die Anzahl der kardiovaskulären Todesfälle ist in den letzten 23 Jahren absolut gesehen um 41 % gestiegen, obwohl im selben Zeitraum die altersspezifische Todesrate um 39 % abgenommen hat. Dies ist laut Schätzungen zu etwa 55 % auf die Alterung der Bevölkerung zurückzuführen und zu etwa 25 % auf das Bevölkerungswachstum, wobei der relative Anteil der Faktoren regional stark differiert.5 Lediglich in West- und Zentraleuropa, also auch in Österreich, ist die absolute Zahl der kardiovaskulären Todesfälle gesunken, was darauf hinweist, dass hier die Verbesserung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung die demografischen Veränderungen wettmachen konnte.</p> <p>Während weltweit etwa doppelt so viele Menschen an HKE sterben als an Krebs, war Frankreich das erste Land, in dem bereits 1988 weniger Menschen an HKE als an Krebs starben. Später folgten Spanien (1999), die Niederlande (2004), Belgien (2006), Slowenien (2007), „Israel – Männer“ und Portugal (2009), Dänemark und Luxemburg (2010), England (2011), Italien und „Israel – Frauen“ (2012), Norwegen (2013). In Österreich ist nach wie vor die Mortalität infolge von HKE höher.</p> <p>Der Rückgang der Mortalität wird einerseits durch geringere Sterblichkeit bei Akutevents infolge verbesserter Therapie erklärt, zu der auch die Rehabilitation gezählt wird, andererseits durch eine Senkung der Inzidenzrate infolge verbesserter Risikofaktorenkontrolle. Dabei spielen die Therapie der Hypercholesterinämie und der arteriellen Hypertonie eine Rolle, weiters Tabakgesetzgebung und Motivation zur körperlichen Aktivität. Einen negativen Einfluss hat die zunehmende Prävalenz von Übergewicht und Adipositas kombiniert mit jener von Prädiabetes und Diabetes.</p> <h2>Morbidität</h2> <p><strong>Prävalenz und Inzidenz</strong><br /> Gemäß dem „Heart Disease and Stroke Statistics – 2012 Update“ der American Heart Association liegt die Prävalenz der KHK in den USA unter den über 20-Jährigen bei 7 % (8,3 % bei Männern und 6,1 % bei Frauen), die Prävalenz von Myokardinfarkt unter den über 20-jährigen USBürgern bei 3,1 % (4,3 % bei Männern, 2,2 % bei Frauen).<sup>6</sup> In Europa liegen Daten der „European Social Survey 2014“ vor, in der 9,2 % aller Befragten angaben, in den letzten 12 Monaten Herz-Kreislauf-Probleme gehabt zu haben. Österreich liegt in dieser Befragung mit 10,4 % etwas über dem Durchschnitt, in Irland und Tschechien gaben weniger als 5 % aller Befragten Herz-Kreislauf-Probleme an.</p> <p>Schätzungen, die auf den Framingham- Daten basieren, besagen, dass etwa die Hälfte aller Männer und ein Drittel aller Frauen mittleren Alters in ihrem Leben eine Manifestation einer koronaren Herzkrankheit erleiden werden.<sup>7</sup></p> <p><strong>Prognose und Manifestation</strong><br />KHK und Myokardinfarkt verkürzen die Lebenserwartung deutlich. Aus Daten der Original-Framingham-Kohorte hat man berechnet, dass 60-jährige Männer und Frauen mit KHK eine um etwa 7 Jahre geringere Lebenserwartung als gesunde 60-Jährige haben. Ein akuter Myokardinfarkt kostet einem 60-jährigen Mann 9 Jahre, einer gleichaltrigen Frau gar 13 Jahre ihrer Lebenserwartung. Der Geschlechtsunterschied ergibt sich vor allem aus der höheren Lebenserwartung gesunder Frauen dieses Alters.<sup>8</sup></p> <h2>Myokardinfarkt</h2> <p><strong>Inzidenz</strong><br />Angaben über Inzidenzraten von Myokardinfarkten sind uneinheitlich und reichen von gleichbleibend bis abnehmend, wobei die fehlende Abnahme möglicherweise der verfeinerten Diagnostik geschuldet ist.<sup>9, 10</sup></p> <p>In Österreich zeigt sich seit 2007 ein leichter Abwärtstrend (jährlich durchschnittlich 2,6 % ) mit einer 2,5-fach höheren Inzidenz bei Männern.<sup>1</sup> Die Sterblichkeit hat hier im Zeitraum 2002–2011 jährlich um durchschnittlich 5,1 % abgenommen.</p> <p><strong>Patientencharakteristika</strong><br />US-Daten zeigen, dass sich die Patientencharakteristika von Myokardinfarktpatienten im Zeitraum 1999–2008 insofern deutlich verändert haben, als das Alter und der Frauenanteil höher, der Anteil der weißen Bevölkerung geringer, der Komorbiditätsanteil höher und die Anzahl vorangegangener Revaskularisationen ebenfalls höher ist. Der Anteil von STEMI an allen Myokardinfarkten ist zugunsten von NSTEMI gesunken.<sup>10</sup></p> <p><strong>Prognose</strong><br />STEMI haben eine höhere Kurzzeitmortalität, NSTEMI eine schlechtere Langzeitprognose, mit einer hohen Rehospitalisierungsrate, insbesondere bei Frauen. Die Rate der 30-Tages-Mortalität nach allen akuten Koronarsyndromen (ACS) inklusive instabiler AP liegt wahrscheinlich im 2- bis 3-Prozent-Bereich, bei STEMI zwischen 2,5 und 10 % . Komplikationen sind plötzlicher Herztod, akutes Herzversagen oder Schock, Reinfarkte oder Insulte. Etwa ein Viertel aller Fälle von plötzlichem Herztod nach akuten Myokardinfarkten ereignen sich in den ersten 3 Monaten, circa die Hälfte im ersten Jahr, das Risiko ist besonders hoch bei Patienten mit linksventrikulärer Auswurffraktion von unter 35 % .</p> <h2>Kosten</h2> <p>Die geschätzten Kosten der Behandlungen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden im EU-Durchschnitt – bei starken regionalen Unterschieden – mit 9 % der Gesundheitsausgaben beziffert.<sup>11</sup> Im Jahr 2008 lagen in Österreich die für den akutstationären Bereich aufgewendeten Ausgaben bei 13 % der für das Gesundheitssystem getätigten Ausgaben.<sup>1</sup></p> <h2>Prävention</h2> <p>Eine Guideline-konforme Umsetzung von Primär-, Sekundär- und Tertiärpräventionsmaßnahmen würde zur Verringerung von Morbidität und Mortalität führen. Die Präventionsmaßnahmen werden jedoch ungenügend berücksichtigt.<sup>12, 13</sup></p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Bundesministerium für Gesundheit (Hg.): Herz-Kreislauf- Erkrankungen in Österreich. Wien: 2014 <strong>2</strong> WHO: Global status report on noncommunicable diseases 2014. Genf: WHO Press, 2014 <strong>3</strong> Townsend N et al: Eur Heart J 2016; 37(42): 3232-45 <strong>4</strong> Nichols M et al: Eur Heart J 2014; 35: 2950-9 <strong>5</strong> Roth GA et al: N Engl J Med 2015; 372: 1333-41 <strong>6</strong> Roger VL et al: Circulation 2012; 125: e2-e220 <strong>7</strong> Lloyd- Jones DM et al: Lancet 1999; 353: 89 <strong>8</strong> Peeters A et al: Eur Heart J 2002; 23: 458-66 <strong>9</strong> Roger VL et al: Circulation 2010; 121: 863-9 <strong>10</strong> Yeh RW et al: N Engl J Med 2010; 362: 2155-65 <strong>11</strong> Susanne Løgstrup, European Heart Network, and Sophie O’Kelly, European Society of Cardiology (eds.): European Cardiovascular Disease Statistics 2012 edition. Brussels, Sophia Antipolis: 2012 <strong>12</strong> Kotseva K et al: Eur J Prev Cardiol 2016; 23: 636-48 <strong>13</strong> Piepoli MF et al: Eur Heart J 2016; 37(29): 2315-81</p>
</div>
</p>