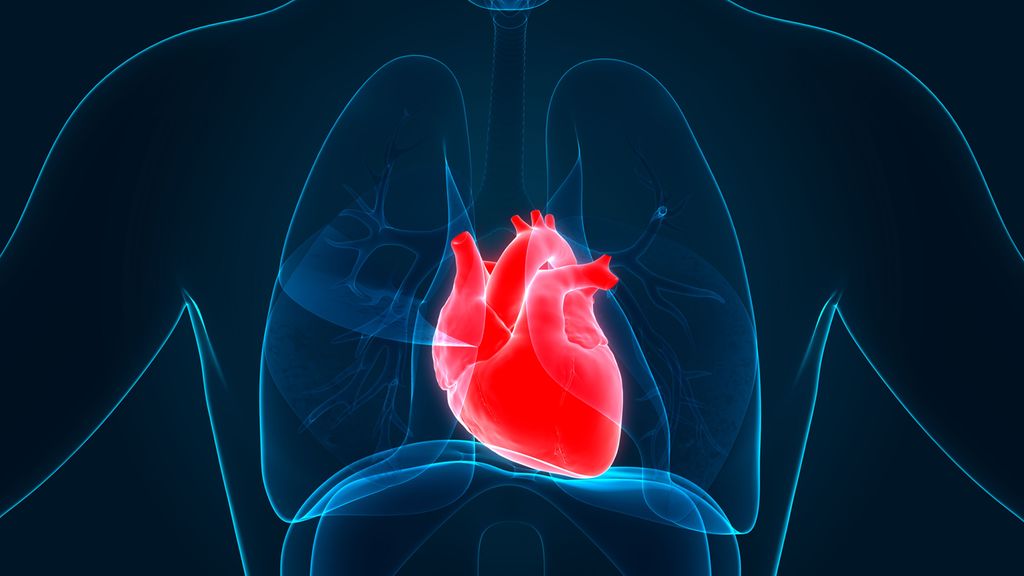
©
Getty Images/iStockphoto
Aktuelle Fragen der Antikoagulation
Jatros
30
Min. Lesezeit
24.05.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Im Rahmen der 62. Jahrestagung der Gesellschaft für Thrombose- und Hämostaseforschung (GTH) in Wien diskutierten Experten neue Erkenntnisse zu den spannenden Themen therapeutisches Drugmonitoring, Einsatz von DOAKs bei onkologischen Patienten sowie Möglichkeiten zur Antagonisierung der Wirkung von DOAKs.</p>
<hr />
<p class="article-content"><h2>DOAKs: intra- und interindividuelle Variabilität</h2> <p>Einer der großen Vorteile von direkten oralen Antikoagulanzien (DOAKs) ist, dass bei deren Einsatz kein routinemäßiges Monitoring erforderlich ist. Trotzdem kann ein Monitoring in bestimmten klinischen Situationen nützlich sein, um die DOAK-Konzentration oder den gerinnungshemmenden Effekt zu prüfen. Die vier in Österreich zugelassenen DOAKs – Apixaban, Dabigatran, Edoxaban und Rivaroxaban – weisen unterschiedliche Charakteristika auf, die bei der Wahl der Assays sowie der Interpretation der Ergebnisse zu berücksichtigen sind.<sup>1</sup><br /> Einer der Gründe für die Sinnhaftigkeit eines therapeutischen Drugmonitorings (TDM) ist die interindividuelle Variabilität der Medikamentenspiegel. So konnte etwa für Dabigatran an einer Population von 100 Patienten gezeigt werden, dass die Spitzenspiegel in einem Bereich zwischen ≤30 und 722ng/ml und die Talspiegel zwischen ≤30 und 510ng/ml liegen.2 Das entspricht einer interindividuellen Variabilität (geometrischer Variationskoeffizient; gCV) von 51–64 % . Auch für Rivaroxaban und Apixaban konnte eine 50- bis 60-fache interindividuelle Variabilität der Plasmakonzentrationen festgestellt werden.<sup>3</sup><br /> Für die intraindividuelle Variabilität der Medikamentenspiegel sind Faktoren wie Alter, Nierenfunktion, Medikamenteninteraktionen, Körpergewicht, Leberfunktionsstörungen oder genetische Disposition ausschlaggebend. „Da diese Faktoren teilweise veränderlich sind, können auch die Plasmakonzentrationen beim einzelnen Patienten im Laufe der Zeit variieren“, sagt Prof. Dr. Lorenzo Alberio, Laboratoires d’hématologie, Universität Lausanne, Schweiz. Für die Talspiegel von Dabigatran liegt der gCV bei einem Patienten im Laufe der Zeit daher zwischen 32 und 40 % .</p> <h2>DOAKs: Evaluierung der Wirkung</h2> <p>Dass sich die Variabilität der Plasmakonzentrationen klinisch manifestiert, konnte in einer Reihe von Studien gezeigt werden. So ergab eine Studie von Guillaume Paré et al., dass Patienten mit einem Polymorphismus im Carboxylesterase-Gen, der mit verringerten Dabigatran-Konzentrationen assoziiert ist, im Vergleich zu Wildtyp- Patienten ein signifikant geringeres Blutungsrisiko unter Dabigatran-Therapie haben.<sup>4</sup> Andererseits steigern höhere Talspiegel von Dabigatran das Blutungsrisiko, während niedrige Talspiegel das Risiko für ischämische Ereignisse erhöhen.<sup>5</sup> Ähnliches konnte auch für Rivaroxaban und Apixaban gezeigt werden.<sup>6</sup> „Es scheint für DOAKs einen idealen Bereich für die Plasmakonzentrationen zu geben, in dem sich die Risiken für Blutungen und für ischämische Ereignisse die Waage halten“, folgert Alberio aus diesen Daten.<br /> Zu Evaluierung des antikoagulativen Effekts von DOAKs eignen sich Marker wie die Prothrombin-Fragmente F1+F2, Thrombin- Antithrombin-Komplexe (TAT) sowie D-Dimere. In einer explorativen Studie wurde beispielsweise gezeigt, dass Rivaroxaban in der Lage ist, die Gerinnungsaktivierung nach perkutaner koronarer Intervention (PCI) und Stentimplantation effektiv zu unterdrücken.<sup>7</sup> „Mit diesen Markern sind wir in der Lage, die Thrombinbildung in vivo zu ermitteln. Studien, die deren Einsatz in der klinischen Routine erlauben, fehlen allerdings noch“, schließt Alberio.</p> <h2>DOAKs in der Onkologie</h2> <p>Tumorerkrankungen sind ein hoher Risikofaktor für venöse Thromboembolien (VTE)<sup>8</sup> und krebsassoziierte Thrombosen (CAT) führen zu einer signifikanten Erhöhung des Mortalitätsrisikos.<sup>9</sup> „Andererseits haben zehn Prozent der Patienten mit soliden Tumoren und ein noch höherer Anteil mit hämatologischen Malignitäten Blutungskomplikationen“, berichtet Prof. Dr. Anne Angelillo-Scherrer, Univ.-Klinik für Hämatologie, Inselspital Bern, Schweiz.<br /> Seit Jahrzehnten besteht die Standardtherapie von CAT aus Heparin gefolgt von einem Vitamin-K-Antagonisten (VKA). Die Rezidivraten bei Krebspatienten sind im Vergleich zu denen bei Patienten ohne Tumorerkrankung allerdings erhöht, was auf fluktuierende INR-Werte, therapiebedingte Unterbrechung der Antikoagulation und krebsassoziierte Hyperkoagulabilität zurückzuführen ist.<sup>10</sup><br /> In den letzten Jahren hat eine Reihe von internationalen Fachgesellschaften Guidelines zum Management von CAT publiziert. So wird laut aktuellen ESMOGuidelines eine Therapie mit niedermolekularem Heparin (LMWH) oder einem DOAK für 3 bis 6 Monate empfohlen.<sup>11</sup> Ist der Krebs nach 6 Monaten in kompletter Remission, kann die LMWH-Behandlung bzw. die Antikoagulation beendet werden (Abb. 1). Bei Fortsetzung der Tumortherapie wird auch die LMWH/DOAK-Behandlung fortgesetzt. Ist die Krebserkrankung stabil, sollte die VTE-Prophylaxe ebenso fortgesetzt werden, wobei die Entscheidung DOAK oder LMWH nach der Präferenz des Patienten erfolgen kann.<br /> Eine Netzwerk-Metaanalyse hat ergeben, dass DOAKs und LMWH hinsichtlich der VTE-Rezidivprophylaxe und des Risikos für schwere Blutungen vergleichbar sind.<sup>12</sup> Diesbezügliche Daten aus direkten Vergleichsstudien liegen für Rivaroxaban aus der SELECT-D-Studie<sup>13</sup> und für Edoxaban aus der Hokusai-VTE-Cancer-Studie<sup>14</sup> vor. SELECT-D ergab unter Rivaroxaban eine geringere VTE-Rezidivrate als unter Dalteparin (11 % vs. 4 % ), allerdings traten unter dem DOAK mehr Blutungen auf (5 % vs. 3 % ). In der Hokusai-VTE-Cancer- Studie zeigte sich, dass Edoxaban Dalteparin hinsichtlich des kombinierten primären Endpunktes aus VTE-Rezidiv und schwerer Blutung nicht unterlegen ist (12,8 % vs. 13,5 % ; HR: 0,97). Die Rezidivrate war im Edoxaban-Arm numerisch geringer (7,9 % vs. 11,3 % ; p=0,09), die Rate an schweren Blutungen allerdings signifikant höher (6,9 % vs. 4,0 % ; p=0,04), was im Wesentlichen auf gastrointestinale (GI) Blutungen bei Patienten mit GI Tumoren zurückzuführen ist. „Ich denke, dass DOAKs auch für Krebspatienten mit VTE eine gute Therapieoption sind. Sie müssen allerdings über das erhöhte Blutungsrisiko aufgeklärt werden“, sagt Angelillo- Scherrer.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Kardio_1802_Weblinks_s29_abb1.jpg" alt="" width="1417" height="1807" /></p> <h2>Antidote gegen DOAKs</h2> <p>„Im Vergleich zu Vitamin-K-Antagonisten sind DOAKs mit einem geringeren Risiko für intrakranielle Blutungen assoziiert, das Risiko für gastrointestinale Blutungen und schwere Menstruationsblutungen ist allerdings erhöht“, sagt Prof. Dr. Thomas Gary, Univ.-Klinik für Innere Medizin, Graz. DOAKs fluten rasch an und der maximale gerinnungshemmende Effekt wird rund 1 bis 3 Stunden nach Einnahme erreicht. Aufgrund ihrer kurzen Halbwertszeit ist nach 8 bis 12 Stunden mit einer Reduktion der Blutung zu rechnen. Da alle DOAKs bis zu einem gewissen Grad über die Niere ausgeschieden werden, ist bei akuten Nierenschäden mit einer Verzögerung der DOAK-Clearance zu rechnen.<sup>15</sup><br /> Es sind drei Substanzen, die die Wirkung von DOAKs antagonisieren, entwickelt worden. Idarucizumab, das die Antikoagulation unter Dabigatran aufhebt, ist bereits zugelassen; Andexanet, das die Wirkung von Faktor-Xa-Inhibitoren und Heparin stoppt, ist unter Evaluation, und Studien zu Ciraparantag, das die Gerinnungshemmung sämtlicher DOAKs und Heparine reversiert, sind im Laufen.<br /> Idarucizumab ist ein monoklonaler Fab-Antikörper, der eine 350-fach höhere Affinität für Dabigatran hat als für Thrombin.<sup>16</sup> Die REVERSE-AD-Studie hat gezeigt, dass Idarucizumab in einer Dosierung von 5g sowohl bei Patienten mit schweren Blutungen als auch bei Notwendigkeit eines Akuteingriffs die Dabigatraninduzierte Gerinnungshemmung innerhalb von Minuten aufhebt und dass es auch nach wiederholter Gabe sowie bei älteren bzw. niereninsuffizienten Patienten wirksam ist.<br /> Andexanet ist ein rekombinanter Faktor Xa, der eine vergleichbare Affinität für orale Faktor-Xa-Inhibitoren aufweist wie nativer Faktor Xa.<sup>17</sup> Für die Aufhebung der Wirkung von Apixaban wird ein 400mg-Bolus gefolgt von einer Infusion von 4mg/min über 120 Minuten benötigt. Für die Rivaroxaban-Antagonisierung ist die Dosierung doppelt so hoch.<sup>18</sup> In der ANNEXA-4-Studie wurde gezeigt, dass Andexanet die Anti-Faktor-Xa-Aktivität bei Patienten mit schweren Blutungen substanziell reduziert und bei 97 % zu einer effektiven Blutstillung führt.<sup>19</sup><br /> Ciraparantag ist ein kationisches Molekül, das sämtliche DOAKs und Heparin bindet. Eine Studie hat gezeigt, dass eine intravenös applizierte Dosis Ciraparantag (100–300mg) über 10 bis 30 Minuten die Wirkung von Edoxaban innerhalb von 10 Minuten aufhebt.<sup>20</sup><br /> Da Andexanet und Ciraparantag noch nicht zugelassen sind, ist für die Revidierung der Faktor-Xa-Wirkung eine Alternative nötig. Am häufigsten kommt laut Gary in dieser Situation Prothrombin-Komplex- Konzentrat (PCC) zum Einsatz. PCC hat sich bei schweren Blutungen unter Rivaroxaban oder Apixaban als effektiv und mit einem geringen VTE-Risiko assoziiert erwiesen.<sup>21</sup> Kann die Blutung mit PCC nicht zum Stillstand gebracht werden, stehen das aus menschlichem Plasma hergestellte Präparat Feiba und rekombinanter Faktor VIIa zur Verfügung.</p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: 62. Jahrestagung der Gesellschaft für Thrombose- und
Hämostaseforschung (GTH), 20.–23. Februar 2018, Wien
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Douxfils J et al.: J Thromb Haemost 2018; 16(2): 209-219 <strong>2</strong> Chan NC et al.: J Thromb Haemost 2015; 13(3): 353-9 <strong>3</strong> Gulilat M et al.: Can J Cardiol 2017; 33(8): 1036-1043 <strong>4</strong> Paré G et al.: Circulation 2013; 127(13): 1404-12 <strong>5</strong> Reilly PA et al.: J Am Coll Cardiol 2014; 63(4): 321-8 <strong>6</strong> Eikelboom JW et al.: JAMA Cardiol 2017; 2(5): 566-574 <strong>7</strong> Vranckx P et al.: Thromb Haemost 2015; 114(2): 258-67 <strong>8</strong> Chew HK et al.: Arch Intern Med 2006; 166(4): 458-64 <strong>9</strong> Timp JF et al.: Blood 2013; 122(10): 1712-23 <strong>10</strong> Lee AY, Levin MN: Circulation 2003; 107(23 Suppl 1): I17-21 <strong>11</strong> Ay C et al.: ESMO Open 2017; 2(2): e000188 <strong>12</strong> Posch F et al.: Thromb Res 2015; 136(3): 582-9 <strong>13</strong> Young A: www.clinicaltrialresults.org/Slides/ SELECT-D_Young.pdf. Letzter Aufruf 14.03.2018 <strong>14</strong> Raskob GE et al.: N Engl J Med 2018; 378(7): 615-624 <strong>15</strong> Weitz JI, Haranberg J: Thromb Haemost 2017; 117(7): 1283-8 <strong>16</strong> Glund S et al.: Thromb Haemost 2015; 113: 943-51 <strong>17</strong> Crowther M, Crowther MA: Arterioscler Thromb Vasc Biol 2015; 35(8): 1736-45 <strong>18</strong> Siegal DM et al.: N Engl J Med 2015; 373(25): 2413-24 <strong>19</strong> Connolly SJ et al.: N Engl J Med 2016; 375(12): 1131-41 <strong>20</strong> Ansell JE et al.: Thromb Haemost 2017; 117(2): 238-45 <strong>21</strong> Majeed A et al.: Blood 2017; 130(15): 1706-12</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport
Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...
ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen
Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...
Inclisiran bei Patienten mit Statinintoleranz wirksam und sicher
Eine Analyse statinintoleranter Patienten aus dem Phase III Studienprogramm ORION zeigt, dass Inclisiran die LDL-Cholesterinspiegel kardiovaskulärer Hochrisikopatienten, die kein Statin ...


