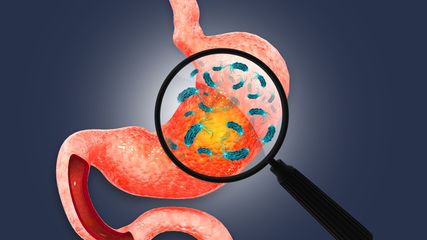Best of Digestive Disease Week (DDW)
Bericht:
Regina Scharf, MPH
Redaktorin
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Muss die Therapie mit Infliximab bei M. Crohn lebenslang fortgesetzt werden oder kann sie bei anhaltender kombinierter Remission gestoppt werden? Was bringt die mediterrane Ernährung bei diesen Patienten? Lassen sich psychische Komorbiditäten bei funktionellen Magen-Darm-Erkrankungen durch eine App verbessern? Die Antwort auf diese und andere Fragen fanden die Teilnehmer des SGG-Jahreskongresses in der «Best of DDW Session» und Sie, liebe Leserinnen und Leser, finden sie hier.
Im Unterschied zur Schweiz, wo präventive Massnahmen wie das Kolonkarzinom-Screening in kantonalen Händen liegen, existiert in den Niederlanden seit 2014 ein nationales Screening-Programm. Dieses basiert auf einem fäkalen immunchemischen Test (FIT) bei den 55- bis 75-Jährigen, der nach 2 Jahren wiederholt wird. Fallen beide Tests negativ aus, verlängert sich das Intervall bis zum nächsten Test auf 10 Jahre. Bei einem positiven Testergebnis wird der Patient zur Koloskopie überwiesen. Wie eine an der DDW präsentierte Untersuchung zeigte, verlief die Einführungsphase des Screening-Programms von 2014–2019 erfolgreich. Die Partizipationsrate der angeschriebenen 2 Millionen Patienten betrug 71%, davon wurden 4,3% aufgrund eines positiven FIT zur Koloskopie überwiesen. Pro 100000 Patienten wurden 13 fortgeschrittene Adenome oder Kolorektalkarzinome entdeckt. «Das ist ein gutes Ergebnis und zeigt, dass die Inzidenz von Kolorektalkarzinomen, insbesondere fortgeschrittenen Kolorektalkarzinomen, durch die frühzeitige Entdeckung und Entfernung sowie bessere Behandlungsoptionen reduziert werden kann», sagte Prof. Hashem El Serag von der Universität Houston, Texas.
Nutzen-Risiko-Verhältnis verschiebt sich mit dem Alter
Das 10-jährige Screening-Intervall nach einem wiederholt negativen FIT wurde von Koloskopiestudien übernommen. Dieser Zeitabstand könnte aber zu lang sein, wie eine weitere Studie aus den Niederlanden zeigte. So waren nach einem negativen FIT-Befund mehr Intervallkarzinome aufgetreten als nach einem negativen Koloskopiebefund. Mit dem Alter nimmt das Komplikationsrisiko einer Koloskopie zu und der Nutzen selbst dann ab, wenn ein pathologischer Befund vorliegt. Eine US-amerikanische Studie, die die Follow-up-Empfehlungen bei Patienten, die 65 Jahre oder älter waren, untersuchte, fand Hinweise für einen «overuse» von Koloskopien in dieser Population. So wurde 98% der 65–69-Jährigen und mehr als 25% der ≥85-Jährigen ohne signifikante Läsionen oder kleine Polypen empfohlen, mit den Kontrollen fortzufahren. Nur einem kleinen Teil der Patienten wurde explizit geraten, die Untersuchung zu stoppen. «Das ist die Kehrseite eines fehlenden nationalen Screening-Programms, wo die Leute machen können, was sie wollen», sagte der Spezialist.
M. Crohn: Infliximab bei anhaltender Remission stoppen?
Unkontrollierte oder retrospektive Studien zeigten, dass das Rezidivrisiko bei Patienten mit M. Crohn ein Jahr nach dem Absetzen von Infliximab 30–50% und nach 2 Jahren über 50% beträgt. Gute Chancen auf eine anhaltende Remission haben Patienten mit einer klinischen, biochemischen und endoskopischen Remission. Ob die Therapie mit Infliximab in dieser Patientenpopulation gestoppt werden kann, wurde in einer multizentrischen, randomisierten, placebokontrollierten Studie über 48 Wochen untersucht. Wie die Ergebnisse zeigten, erlitten von den Patienten, bei denen die Infliximab-Therapie unterbrochen und mit Placebo fortgeführt wurde, 49% ein Rezidiv. Von den Patienten, die weiterhin mit Infliximab behandelt wurden, blieben dagegen praktisch alle (96%) in Remission. Eine anhaltende kombinierte klinische und endoskopische Remission fand sich bei 87% der Patienten mit einer kontinuierlichen Infliximab-Therapie, im Vergleich zu 31% der vorübergehend mit Placebo behandelten Patienten. Diese Ergebnisse demonstrieren, dass ein Unterbruch der Infliximab-Therapie auch bei einer kombinierten klinischen, biochemischen und endoskopischen Remission ein ernst zu nehmendes Risiko für einen Rückfall darstellt», sagte El-Serag.
Mediterrane versus kohlehydratreiche Ernährung bei M. Crohn
Eine mediterrane Ernährung kann das Risiko für kardiovaskuläre Krankheiten und Krebserkrankungen positiv beeinflussen. Studien zeigen zudem eine niedrigere Inzidenz für M. Crohn bei Personen, die sich mediterran ernähren, und eine Abnahme der Symptome und verbesserte Lebensqualität bei den Betroffenen. Im Gegensatz dazu steht eine kohlehydratreiche Diät im Verdacht, das Risiko für das Auftreten eines M. Crohn und für einen schweren Krankheitsverlauf zu erhöhen. Die «diet to induce remission in Crohn’s disease study» (DINE-CD) verglich den Effekt einer mediterranen versus eine spezifische kohlehydratreiche Ernährung bei 194 Patienten mit M. Crohn. Wie die Ergebnisse sechs Wochen nach der Ernährungsumstellung zeigten, führten die beiden Diäten bei etwa der Hälfte der Patienten zu einer symptomatischen Remission. Beide Diäten wurden trotz des erhöhten Konsums von Früchten und Gemüse gut vertragen.
FGID: Lässt sich die psychische Gesundheit mit digitalen Hilfsmitteln verbessern?
Patienten mit funktionellen Magen-Darm-Erkrankungen («functional gastrointestinal disorders», FGID) weisen eine erhöhte Sensibilität gegenüber Stressoren auf und leiden oft konkomittierend an Erkrankungen wie Depressionen und Angststörungen. Eine kognitive Verhaltenstherapie kann die Stimmung der Betroffenen positiv beeinflussen, die Stressresilienz erhöhen und die Symptome der FGID verbessern. Die Integration in die Behandlungsabläufe erweist sich jedoch oft als schwierig. Für Abhilfe könnten neue digitale Technologien, wie die Applikation «RxWell», schaffen. Die App mit evidenzbasierten kognitiven Verhaltens- und Achtsamkeitstechniken wurde in mehreren klinischen Studien getestet und kann in Eigenregie («self-guided») oder unter Anleitung («coach-guided») eingesetzt werden. Eine Untersuchung bei Patienten mit FGID und moderater Depression oder Angststörung (Durchschnittsalter 43 Jahre, 75% Frauen) konnte zeigen, dass der Einsatz der App nach drei Monaten zu einer klinisch und statistisch signifikanten Reduktion der Symptome führte. Der grösste Benefit wurde erzielt, wenn die App Coach-gesteuert eingesetzt wurde.
Übergewicht, Probiotika und «upper respiratory tract infections»
Ältere Menschen und Patienten mit Übergewicht oder Adipositas haben ein erhöhtes Risiko für «upper respiratory tract infections» (URI). Als Ursache wird eine gestörte Interaktion zwischen Darmflora und Lunge (Darm-Lungen-Achse) vermutet. Das führte zu der Hypothese, dass sich die Häufigkeit von URI möglicherweise über die Modifikation des Darm-Mikrobioms reduzieren lässt. Tatsächlich konnten Studien eine inverse Beziehung zwischen der Einnahme von Probiotika (speziell Lactobacillus und Bifidobakterien-Stämme) und URI zeigen.1 Für die oben genannten Risikogruppen gibt es allerdings bislang nur wenige Daten. Die PROMAGEN-Studie, die ursprünglich den Effekt einer Lab4-Probiotikasupplementierung (Lactobacillus und Bifidobakterien, 50Mrd. CFU/d) auf das Körpergewicht bei Patienten im Alter zwischen 30 und 65 Jahren und einem BMI von 25–35kg/m2 untersuchen sollte, hatte ein negatives Ergebnis gezeigt. Eine aktuelle Analyse dieser Studie konnte aber zeigen, dass sich die Häufigkeit von URI im Vergleich zu Placebo durch die Probiotikaeinnahme um 30% reduzieren liess. Am effektivsten erwies sich die Supplementation bei Studienteilnehmern ≥45 Jahre und Personen mit einem BMI ≥30 kg/m2.2
Quelle:
Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Gastroenterologie, 9. und 10. September 2021, Interlaken
Literatur:
1 King S et al.: Effectiveness of probiotics on the duration of illness in healthy children and adults who develop common acute respiratory infectious conditions: a systematic review and meta-analysis. Br J Nutr 2014; 112: 41-54r 2 Mullish BH et al.: Probiotics reduce self-reported symptoms of upper respiratory tract infection in overweight and obese adults: should we be considering probiotics during viral pandemics? Gut-Microbes 2021; 13: 1-9
Das könnte Sie auch interessieren:
ECCO-Update 2025
Der Kongress der European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO) fand 2025 vom 19. bis 22. Februar in Berlin unter dem Motto «Nachhaltigkeit bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen ...
Vorsorgekoloskopie und Polypektomienachsorge
In ihrem Vortrag zum Darmkrebs-Screening in Österreich an der SGG-Jahrestagung 2024 ermöglichte Univ.-Prof. Dr. med. Monika Ferlitsch, Wien, einen Blick über den Tellerrand. Sie zeigte ...
Update im therapeutischen Management der Helicobacter-pylori-Infektion
Die H.-pylori-Infektion ist entscheidender Ausgangspunkt für die Entwicklung eines Magenkarzinoms. Diese Entwicklung kann durch eine frühzeitige Eradikation von H.pylori verhindert ...