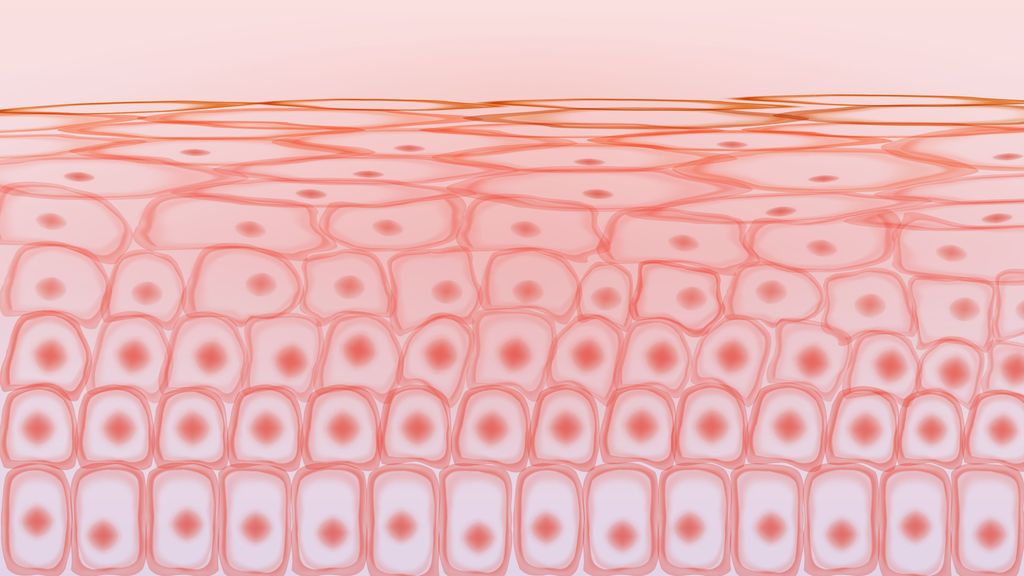
©
Getty Images
Standardisierte Beurteilung chronischer Wunden
Jatros
Autor:
Prim. Univ.-Prof. Dr. Robert Strohal
Abteilung für Dermatologie und Venerologie<br> Landeskrankenhaus Feldkirch<br> E-Mail: robert.strohal@lkhf.at
30
Min. Lesezeit
16.05.2019
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Chronisch schlecht heilende Wunden, besonders die als Ulcera cruris bekannten Unterschenkelgeschwüre, sind ein europaweites Problem. Die Behandlung erfordert jedenfalls eine standardisierte Begutachtung nach der A. B. C. D. E.-Regel. Zur Identifizierung einer geeigneten Lokaltherapie empfiehlt sich das M. O. I. S. T.-Konzept, welches im Gegensatz zum althergebrachten T. I. M. E.-Konzept proaktiv eine spezielle Intervention anbietet.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Niemals eine Lokaltherapie der Wunde anwenden ohne entsprechende kausale Basistherapie. Das gilt auch umgekehrt.</li> <li>Bei der Erstbegutachtung einer chronischen Wunde ist die A. B. C. D. E.-Regel der Begutachtung als zwingend anzusehen.</li> <li>Eine moderne Wundbehandlung besteht aus einer aktiven Lokaltherapie (seien es Verbände, Cremen, Sprays oder physikalische Maßnahmen), welche wundphasenadaptiert zum richtigen Zeitpunkt angewendet wird.</li> <li>Begutachtungskonzepte wie T. I. M. E. oder M. O. I. S. T. führen zu einer wundphasenadaptierten adäquaten Lokaltherapie. Das moderne proaktive M. O. I. S. T.-Konzept ist heutzutage dem T. I. M. E.-Konzept vorzuziehen.</li> </ul> </div> <p>Als chronische Wunden bezeichnen wir Wunden, welche trotz einer intensiven Behandlung über mindestens 6 Wochen nicht abheilen. In Österreich, wie insgesamt in ganz Europa, ist das Problem beeindruckend. In Österreich zählen wir 255 000 Patienten mit chronischen Wunden, was ungefähr 3 % der Bevölkerung entspricht. Mit 99 000 Fällen finden sich hier in Österreich, wie überall in Europa, dominant Ulcera cruris. Neben der Tatsache, dass die Patienten typischerweise eine sehr schlechte Lebensqualität haben, leiden sie auch unter dem chronischen Verlauf dieser Wunden, welche in 33 % weit länger als zusätzliche 8 Wochen bestehen. Dieses medizinische Problem ist auch äußerst kostenrelevant, da wir in Österreich von reinen Materialkosten, d. h. Kosten für Verbandsmaterialien, von 225,4 Millionen Euro ausgehen. Die große Notwendigkeit an Ausbildungen und Fortbildungen im medizinischen Bereich chronischer Wundversorgung zeigen Daten, denen zufolge 61 % der betroffenen Patienten nicht regelrecht mit modernen Verbandsstoffen und Therapiemöglichkeiten behandelt werden.</p> <h2>Das Prinzip des Managements chronischer Wunden</h2> <p>In früheren Jahren sehr beliebt war die Wundstadieneinteilung nach Wagner, modifiziert durch Reike 1993, welche Stadien von 0 bis V ausweist. Die ansteigenden Stadien sind vor allem durch einen zunehmenden Gewebeverlust mit entsprechender Nekrose charakterisiert. Unter den meisten deutschsprachigen Wundheilungsexperten besteht derzeit Einigkeit, dass so eine Wundstadieneinteilung zum regelrechten Management von chronischen Wunden, also vor allem Diagnostik und Therapie, nicht wirklich etwas beitragen kann. Aus diesem Grund wird diese Wundstadieneinteilung als obsolet angesehen.<br /> Die standardisierte Beurteilung chronischer Wunden ist aber die absolut notwendige Basis für jegliche regelrecht durchgeführte moderne Wundbehandlung. Dabei spielt vor allem die A. B. C. D. E-Regel der Begutachtung eine zentrale Rolle, da sie zu der essenziellen Basistherapie, also zu einer kausalen Therapie der Wunde, führt. Wenn es dann um die Abklärung der Lokaltherapie der Wunde geht, wird seit längerer Zeit das sogenannte T. I. M. E.-Konzept angewandt. In der vorliegenden Publikation empfehlen wir, dieses Konzept durch das wesentlich modernere M. O. I. S. T.-Konzept<sup>1</sup> zu ersetzen.</p> <h2>Die A. B. C. D. E.-Regel der Begutachtung</h2> <p><em>A – Anamnese:</em> Was eine Anamnese ist, braucht man normalerweise keinem in der Medizin tätigen Profi, sei es Arzt oder Pfleger, zu erklären. Leider wird aber dieser so wichtige Bereich der Aufarbeitung von Patienteninformationen bei chronischen Wunden oftmals nur abortiv durchgeführt bzw. nicht ernst genommen. Wesentlich sind dabei eine Erhebung der generellen Krankheitsanamnese, seit wann der Defekt aufgetreten ist (Trauma?) bzw. die Frage nach bisherigen Therapien. Wichtig ist für die Gesamteinschätzung auch die Abklärung einer möglichen Infektions- (Fieber?), Schmerz-, neurologischen bzw. angiologischen Symptomatik.<br /> <em>B – Bakterien:</em> Wesentlich ist auch die Frage nach relevanten Bakterien, d. h., ob Zeichen einer systemischen bzw. lokalen Infektion bestehen. Wir glauben (wobei es hierzu verschiedene Meinungen gibt), dass bei Erstbegutachtung immer ein semiquantitativer Abstrich genommen werden sollte, um ein regelrechtes Screening nach multiresistenten Keimen durchzuführen. Ansonsten liegt die Indikation für den mikrobiologischen Abstrich in der Systeminfektion und in der Gesamtverschlechterung des Zustandes der Wunde.<br /> <em>C – klinische Untersuchung:</em> Neben den Basisuntersuchungen (Palpation, Perkussion, Blutdruckmessung und Temperaturmessung) gehört zur klinischen Untersuchung die klassische generelle Inspektion (den Hautstatus nicht vergessen!), aber auch die Wundinspektion, welche Lokalisation, Größe und Tiefe der Wunde umfassen sollte. Dazu ist ein Foto der Wunde obligatorisch. In diesem Zusammenhang soll nochmals auf die große Bedeutung des Hautstatus hingewiesen werden, welcher selbst schon viel über die mögliche Genese des Ulcus aussagen kann (z. B. Corona phlebectatica als typisches Zeichen der chronisch-venösen Insuffizienz [CVI]).<br /> <em>D – Durchblutung:</em> Bei jedem Ulkus sind initial auch die angiologische Basisdiagnostik, bestehend aus Pulsstatus und vergleichender Blutdruckmessung, wie auch die weiterführende Abklärung mit Duplexsonografie zwingend. In entsprechend komplexen Fällen sollten auch eine Arterien- Doppler-Sonografie sowie eine Perfusionsindex- Messung durchgeführt werden.<br /> <em>E – Extras:</em> Abhängig von der klinischen Problematik des Patienten bedarf es auch zusätzlicher Untersuchungen mit z. B. einer Laboranalyse, bildgebenden Verfahren, neurologischen, histopathologischen (wichtig ist ein Tumorausschluss!) und allergologischen Abklärungen.</p> <h2>Der Weg zu einer adäquaten Lokaltherapie</h2> <p>Das Paradigma der modernen Wundbehandlung besteht nicht nur in der Verwendung moderner aktiver topischer Substanzen, sondern auch in deren wundphasengerechter Applikation. Dies bedeutet, dass, wie auch in der sonstigen Medizin, Therapiefehler stattfinden können, indem zum falschen Zeitpunkt der nicht adäquate Verband oder die nicht adäquate topische Therapie angewendet werden. Das Problem verschärft sich noch durch das riesige Angebot von Verbänden (vom Alginat zu Hydrokolloiden und antimikrobiellen Verbänden), Cremen und Gelen (vom Hydrogel zu Alginoenzymen und freien Radikalen) bis hin zu physikalischen Vorrichtungen wie z. B. dem Kaltplasma.<br /> Um nun die richtige Wundphase und das wesentliche Hindernis, warum die Wunde nicht heilt, erkennen zu können, bedarf es einer standardisierten Beurteilungsmethode. In den letzten 10 Jahren wurde hierzu das T. I. M. E.-Konzept als State of the Art anerkannt und entsprechend in der Routinebehandlung von chronischen Wunden verwendet. Wir aber propagieren den Ersatz des T. I. M. E.-Konzepts durch das modernere M. O. I. S. T.-Konzept, welches breiter aufgestellt ist und wesentliche Vorteile für das Management der chronischen Wunde bietet. Tabelle 1 bietet eine Übersicht.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Derma_1902_Weblinks_jatros_derma_1902_s52_tab1_strohal.jpg" alt="" width="350" height="564" /></p> <h2>Das T. I. M. E.-Konzept</h2> <p><em>T – „Tissue“ (Wundbett):</em> Dieser Punkt beschäftigt sich vor allem mit dem Thema des Wundgrunds. Dieser kann bland, aber auch blutig sein. Findet sich ein belegter Wundgrund, z. B. durch Fibrin, matschig abgestorbenes Gewebe, Biofilm oder sogar Nekrosen, so stellt dies eine Indikation für ein Debridement, also eine tiefe Wundreinigung, dar. Daneben sagt die Gewebeart des Wundgrunds aber auch etwas über die Heilungstendenz des Ulkus aus. Bekanntlich heilt ein Ulkus durch Ausbildung von Granulationsgewebe über Epithelgewebe bis zur Narbenbildung. <br /><em>I – Infektion:</em> Bei der Wundinfektion gilt es, die lokale Infektion von der systemischen Infektion zu unterscheiden. Typischerweise geht die systemische Infektion mit den Zeichen Dolor, Rubor, Calor und Ödem einher und ist im Labor mit einer Leukozytose bzw. einer Erhöhung der Akutphasenproteine assoziiert. Fieber kann vorhanden sein, muss aber nicht. Demgegenüber ist die kritisch kolonisierte und lokal infizierte Wunde zu definieren, die durch eine hohe Keimzahl (≥ 10<sup>6</sup> oder ++ positiv) mit aktivem Wachstum gekennzeichnet ist. Die Wunde selbst zeichnet sich durch ein vermehrtes Exsudat, hochrotes fragiles Granulationsgewebe und eine verzögerte Heilung aus. Typisch ist auch das plötzliche Auftreten von starken Schmerzen. Beide Formen der Infektion, systemisch wie lokal, sind unterschiedlich zu behandeln. Ein wesentlicher Grundsatz ist das Vermeiden systemischer Antibiotika bei lokal infizierten Wunden. <br /><em>M – „Moisture“ (Exsudat):</em> Nicht nur dass eine Wunde trocken oder durch Exsudat feucht sein kann, verschiedene Formen des Exsudats können auch auf unterschiedliche Wundursachen hindeuten, was eine wichtige Information für den behandelnden Arzt oder die Pflege darstellt. <br /><em>E – „Edge“ (Wundrand):</em> Bekannterweise heilt die Wunde durch Aussprießen von Gewebe vom Rand her. Instabile, zusammengebrochene, aber auch matschig mazerierte Ränder können diese Leistung unmöglich erbringen, weshalb es hier entsprechend therapeutisch entgegenzuwirken gilt.</p> <h2>Das M. O. I. S. T.-Konzept</h2> <p><em>M – „Moisture balance“ (Exsudatmanagement):</em> Wie der Name schon sagt, legt dieser Parameter eine aktive Intervention zur Herstellung eines optimalen Feuchtigkeitsmilieus nahe. So sollten bei trockenen Wunden z. B. Hydrogele verwendet werden, während bei feuchten Wunden z. B. Alginate oder Superabsorber (alles nur Beispiele einer sehr großen Produktpalette) Anwendung finden.<br /> <em>O – Management der Sauerstoffbalance:</em> Es ist eine Tatsache, dass in der Wunde oftmals der Sauerstoffgehalt vermindert ist, was als ein Faktor der Wundheilungsstörung angesehen wird. Hier ist es möglich, durch zyklisch hochkomprimierten Sauerstoff oder eine andauernde Zufuhr von nicht komprimiertem Sauerstoff entgegenzuwirken. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass es auch ein sauerstofftransportierendes Produkt für die Wunde gibt.<br /> <em>I – Infektionskontrolle:</em> Auch hier steht die Kontrolle der Problematik im Vordergrund, welcher mit antiseptischen Reinigungs- und Spüllösungen oft in Kombination mit antimikrobiellen Verbänden entgegengewirkt wird.<br /> <em>S – „Support“ (Unterstützung):</em> Wichtig sind auch unterstützende Maßnahmen zur Wundbehandlung. Ein Klassiker dabei ist die Kompression, welche beim venösen Ulkus (ohne arterielle Komponente) zwingend dazugehört. Leider wird sie oft vergessen, sodass die besten Lokaltherapien ohne Kompression beim venösen Ulkus ganz einfach nicht zur Heilung führen können.<br /> <em>T – Gewebsmanagement:</em> Wie schon gesagt, heilt die Wunde vor allem über die Randbereiche, wobei sich dann Gewebe über die Wundfläche zieht. Dies ist nicht möglich, wenn die Wunde durch nicht erwünschtes Fremdgewebe (z. B. Nekrosen) belegt ist. Hier gilt es, ein entsprechendes Débridement, also eine Tiefenreinigung der Wunde, durchzuführen. Das Angebot an Débridements ist breit. Für die Auswahl sei auf eine von mir als Autor angeführte Publikation der europäischen Wundheilungsgesellschaft EWMA verwiesen.<sup>2</sup></p> <h2>Zusammenfassung</h2> <p>Zum adäquaten Management von chronischen Wunden, das letztendlich zu einer erfolgreichen Abheilung führen soll, gehört zwingend die Anwendung der A. B. C. D. E.- Regel, welche zur kausalen Basistherapie der chronischen Wunde führt. Anschließend gilt es, zur Identifizierung der regelrechten wundphasenadaptierten Lokaltherapie das T. I. M. E.- oder M. O. I. S. T.-Konzept anzuwenden. Wir empfehlen den Ersatz des althergebrachten T. I. M. E.-Konzepts durch das M. O. I. S. T.-Konzept, da dieses nicht nur die Wundphase bzw. die Situation der Wunde beschreibt, sondern darüber hinaus auch proaktiv eine spezielle Intervention empfiehlt. Das macht das M. O. I. S. T.-Konzept unserer Meinung nach zur neuen State-of-the-Art-Beurteilung chronischer Wunden.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Dissemond J et al.: M. O. I. S. T. – ein Konzept für die Lokaltherapie chronischer Wunden. J Dtsch Dermatol Ges 2017; 15(4): 443-5 <strong>2</strong> Strohal R et al.: EWMA document: Debridement. An updated overview and clarification of the principle role of debridement. J Wound Care 2013; 22(1): 5</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Laserbehandlung von Basalzellkarzinomen
Die chirurgische Exzision ist nach wie vor Goldstandard bei der Behandlung des Basalzellkarzinoms (BCC). Bei Tumoren mit niedrigem Rezidivrisiko kann auch eine nichtinvasive ...
Praxiserfahrungsbericht mit Mikrowellentherapie
Vor nicht ganz zwei Jahren, in der Ausgabe 6/2023, berichteten wir erstmals über unsere Erfahrungen mit der Swift®-Mikrowellentherapie bei lange bestehenden und therapieresistenten ...
Die menschliche Haut in der modernen Kunst
Dr. Ralph Ubl, Professor für neuere Kunstgeschichte an der Universität Basel, stellte sich der schwierigen Herausforderung, einem Raum voller erwartungsvoller Dermatologen das Organ Haut ...


