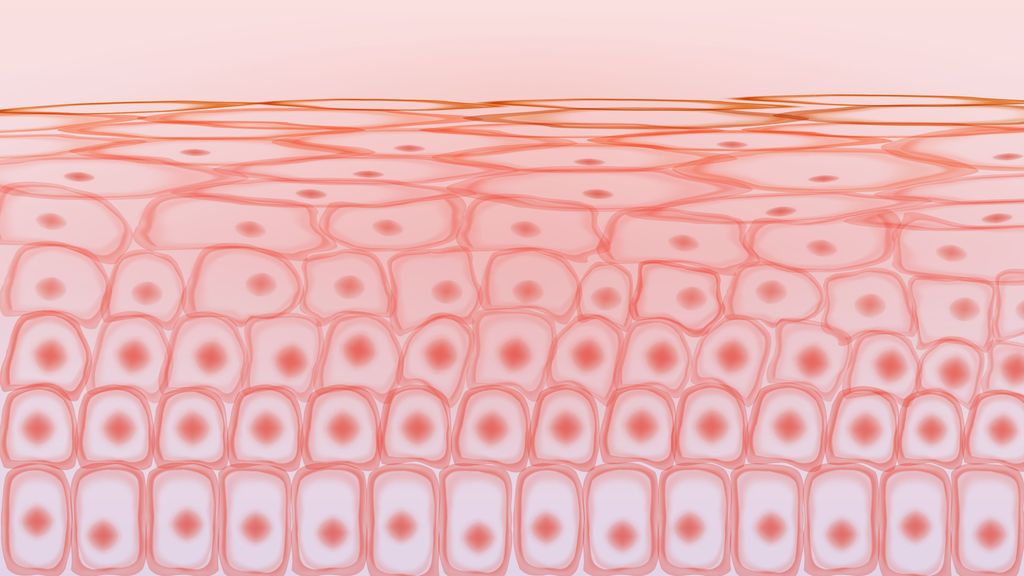<p class="article-intro">Dermatologen und Dermatochirurgen werden in ihrem täglichen Handeln mit unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert. Neben chirurgischer Fertigkeit nehmen hier vor allem die diagnostische Genauigkeit und das ästhetische Ergebnis eine zentrale Rolle ein. Durch mikrochirurgisch kontrollierte OP-Verfahren kann bei Tumorresektionen sowohl die Defektgröße verkleinert als auch die Anzahl der Lokalrezidive minimiert werden.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Um den entstehenden Defekt nach Exzision, bei höchstmöglicher Sicherheit für den Patienten so klein wie möglich zu halten, wurden verschiedene Konzepte der hautsparenden Operationen entwickelt. Gemein ist allen hierfür beschriebenen Methoden die Mehrzeitigkeit, also der chirurgische Defektverschluss erst nach histologisch gesicherter Tumorfreiheit (R0-Resektion). Damit ist es möglich, nur das eigentliche Tumorgewebe zu exzidieren und gesundes Gewebe zu schonen. Für die zwingend mit einem solchen chirurgischen Ansatz verbundene histologische Aufarbeitung stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, von denen neben der Mohs-Chirurgie vor allem die mikrografisch kontrollierte Chirurgie in Form der 3D-Histologie von Bedeutung ist. Werden die Exzisionspräparate mittels 3D-Histologie aufgearbeitet, zeigten sich beim Basalzellkarzinom (BZK) nach histologischer Tumorfreiheit in 0,7 % der Fälle ein Lokalrezidiv, beim Plattenepithelkarzinom (PEK) in 3 % der Fälle; und werden nur PEK ohne desmoplastischen Subtyp herangezogen, zeigen sich sogar nur in 1 % der Fälle Lokalrezidive. <br /> Die Exzision mittels 3D-Histologie ist besonders bei ausgedehnten und schwierig abgrenzbaren Tumoren der konventionellen Aufarbeitung mit Serienschnitten in der Brotlaibtechnik überlegen, da diese falsch negative Befunde besonders bei infiltrativem Wachstum aufweist. Da bei großen Tumoren teils erhebliche „Lücken“ zwischen den Schnitten anfallen, steigt in diesen Fällen die Wahrscheinlichkeit für falsch negative Befunde.</p> <h2>Mikrografisch kontrollierte Chirurgie</h2> <p>Da vor allem nicht melanozytäre Tumoren der Haut („non-melanoma skin cancer“, NMSC) gehäuft im Gesichts- und Kopfbereich auftreten, ist neben der größtmöglichen Sicherheit für den Patienten auch die Rekonstruktion entstandener Defekte nach funktionellen und ästhetischen Gesichtspunkten besonders wichtig. Einen enormen Beitrag zur histologisch gesicherten vollständigen Entfernung eines Tumors unter größtmöglicher Schonung des umgebenden, gesunden Gewebes kann die mikrografisch kontrollierte Chirurgie liefern. In einer Fragebogen-basierten Untersuchung ein sowie vier Jahre nach dem Eingriff beurteilten über 80 % der weiterbehandelnden Ärzte das ästhetische Ergebnis der Operation nach 3D-histologisch kontrollierter Exzision von BZK und PEK mit „exzellent“ (40,5 % ) oder „gut“ (40,9 % ).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Derma_1603_Weblinks_Seite46.jpg" alt="" width="383" height="367" /></p> <h2>3D-Histologie</h2> <p>Bei der praktischen Durchführung der 3D-Histologie ist es wichtig, die topografische Orientierung des Tumors bei 12 Uhr (z.B. durch einen tieferen Einschnitt oder Faden; Abb. 1) zu markieren. Die Orientierung entspricht dann je nach Konvention z.B. bei „12 Uhr“ am Präparat dem Kopf (Scheitel) des Patienten. Anschließend erfolgt die Exzision bis in die Subkutis mit einem Sicherheitsabstand (meist 2–5mm), welcher je nach klinischer Diagnose oder Tumorausdehnung gewählt wird. Der Sicherheitsabstand sollte dabei umso größer gewählt werden, je größer der horizontale Tumorausmesser ist und je eher eine subklinische Ausbreitung zu erwarten ist, wie beispielsweise beim sklerodermiformen BZK oder beim desmoplastischen PEK. Der entfernte Tumor wird nun direkt vom Operateur aufgearbeitet, indem die Seitenränder und die Basis vom entnommenen Gewebe abgetrennt werden und die Ränder im Uhrzeigersinn in gleich große Stücke geschnitten werden (Abb. 2, Abb. 3). Beim Einbetten in die Kassette ist es wichtig, dass die Außenränder mit der Epidermis nach rechts plan zu liegen kommen (Abb. 4). Das eingebettete Präparat wird im Anschluss in Formalin eingelegt und zur weiteren histologischen Aufarbeitung an das Labor versandt.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Derma_1603_Weblinks_Seite47_1.jpg" alt="" width="386" height="369" /></p> <h2>Operative Therapiemöglichkeiten</h2> <p>Das Ziel der chirurgischen Therapie ist eine leitliniengerechte R0-Resektion. Allerdings kann gerade bei aktinischen Keratosen sowie superfiziellen BZK neben der konventionellen Exzision die Horizontalexzision (Shave-Exzision) oder Curettage angewandt werden. Das sind Verfahren mit geringem zeitlichem und organisatorischem Aufwand, die dennoch eine histologische Untersuchung ermöglichen. Dabei wird der Tumoren im mittleren Korium mit einem Saum gesunder Epidermis flach abgetragen, wobei Tumore bis zu einer Tumordicke von etwa 0,4mm erfasst werden können. Ein Defektverschluss ist nicht notwendig, es kommt zur Sekundärheilung mit einem in der Regel ästhetisch ansprechenden Ergebnis. Lokalrezidive zeigen sich bei dieser Methode in etwa 9 % der Fälle.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Derma_1603_Weblinks_Seite47_2.jpg" alt="" width="" height="" /></p> <p>Bei der chirurgischen Exzision wird nach Applikation von Lokalanästhesie zunächst die klinische Tumorgrenze markiert und der individuelle Sicherheitsabstand festgelegt. Was die Tiefe betrifft, ist in der Regel die Resektion in der Subkutis ausreichend, wobei bei Invasion des Tumors auch die Resektion von Knorpel oder Knochen nötig sein kann. Erst nach histologischer Tumorfreiheit sollte die Planung des Defektverschlusses stattfinden. Es hat sich außerdem bewährt, Defekte annähernd rund oder oval zu planen und bei primären Verschlusstechniken die Burrow’schen Dreiecke („dog ears“) erst nach einer ersten Wundrandadaptierung zu resezieren („dog ear repair“).<br /> <br /> Eine Vielzahl von Techniken und Möglichkeiten steht zur Defektdeckung zur Verfügung. Neben exotischen Lappenplastiken und heroischen Defektverschlüssen sollten jedoch einfache Techniken nicht vergessen werden. Bei ausreichender Verschiebbarkeit der Haut bietet sich zum Beispiel ein primärer Verschluss durch eine Dehnungslappenplastik an – eine häufig unterschätzte Technik, die sich durch einfache Durchführbarkeit und häufig exzellente ästhetische Ergebnisse auszeichnet. Wichtig ist eine ausreichende Wundrandmobilisation, um eine spannungsfreie Adaption zu gewährleisten. Selbstverständlich sollte entlang von Narbenlinien beziehungsweise innerhalb natürlicher Faltenlinien geplant werden.<br /> <br /> Eine weitere wichtige Möglichkeit des Defektverschlusses ist die Verschiebelappenplastik, bei der die Schnittrichtung parallel zum Defekt geführt und Haut ohne Drehkomponente in den Defekt verlagert wird. Im Gegensatz dazu wird bei der Rotationslappenplastik der Schnitt vom Defekt annähernd bogenförmig um einen Drehpunkt geführt, wodurch Gewebe zur Defektdeckung rotiert werden kann; dadurch kann die Spannung über die gesamte Länge des Schnittes verteilt werden. Eine häufige Indikation für eine komplexere Verschlusstechnik, den Tranpositionslappen, ist der Nasenflügelbereich, wobei die Narbe des Hebedefekts in die Nasolabialfalte gelegt werden kann. Durch eine Transpositionslappenplastik ist es möglich, einen Lappen aus der Umgebung über ein gesundes Hautareal in den Operationsdefekt zu schwenken.<br /> <br /> Als eine Erweiterung einer Transpositionslappenplastik kann die Stiellappenplastik gesehen werden, die gute funktionelle und ästhetische Ergebnisse beispielsweise im Bereich des Ohrläppchens oder der Nase zeigt. Allerdings ist bei dieser Operationstechnik zwingend ein zweitzeitiges Vorgehen mit Stiellappendurchtrennung nach etwa drei bis sechs Wochen notwendig.<br /> <br /> Weitere Möglichkeiten zur Defektdeckung bieten freie Hauttransplantate, wobei zwischen Spalthaut- und Vollhauttransplantat unterschieden wird. Dabei wird ein 0,2–0,8mm dickes Transplantat aus der Epidermis mit unterschiedlich dicken Anteilen der Dermis entnommen und anschließend gegebenenfalls zusammen mit einer steril angebrachten Operationsfolie auf dem Defekt fixiert.<br /> Bei anatomisch anspruchsvolleren Defekten kann ein die gesamte Dicke des Koriums bis zur Subkutis umfassendes Vollhauttransplantat indiziert sein. Sollen komplexe Strukturen wie Ohrmuschel, Nasenflügel oder Nasenspitze rekonstruiert werden, ist häufig sogar ein sogenanntes „composite graft“ (ein freies Transplantat aus Haut und Knorpel) indiziert. Die Entnahmestelle liegt hier meist in der Ohrmuschel.</p> <h2>Fazit</h2> <p>Durch mikrochirurgisch kontrollierte OP-Verfahren wird ein Maximum an gesundem Gewebe geschont, während die Defektgröße minimiert wird und dadurch ein optimales ästhetisches Ergebnis erzielt werden kann. Werden die Tumorresektionen mithilfe der 3D-Histologie aufgearbeitet, kommt es bei Basalzellkarzinomen lediglich in 0,7 % und bei Plattenepithelkarzinomen in 3 % zu Lokalrezidiven. Diese Zahlen zeigen, dass nicht nur ein ästhetisch besseres Ergebnis durch diese Technik möglich ist, sondern auch die Sicherheit für den Patienten gesteigert werden kann. Die Wahl der geeigneten Methode zur Defektdeckung nach R0-Resektion ist sehr individuell und muss nicht nur auf den Defekt, sondern auch auf die Tumor­entität und die Erwartungen des Patienten abgestimmt werden.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>• Boehringer A, Leiter U, Metzler G et al: Extramammary paget´s disease: extended subclinical growth detected using three-dimensional histology in routine paraffin procedure and course of disease. Dermatol Surg 2011; 37(10): 1417-26 • Breuninger H, Eigentler T, Bootz F et al: S2k Kurzleitlinie-Plattenepithelkarzinom der Haut. J Dtsch Dermatol Ges 2013; 11: 39-47 • Häfner HM, Moehrle M, Eder S et al: 3D-Histological evaluation of surgery in dermatofibrosarcoma protuberans and malignant fibrous histiocytoma: differences in growth patterns and outcome. Eur J Surg Oncol 2008; 34(6): 680-6 • Häfner HM, Breuninger H, Moehrle M et al: 3D histology-guided surgery for basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma: recurrence rates and clinical outcome. Int J Oral Maxillofac Surg 2011; 40: 943-8 • Häfner HM, Schnabl S, Breuninger H, Schulz C: Surgical treatment of epithelial skin tumors and their precursors. Hautarzt 2013; 64: 558-66 • Hauschild A, Breuninger H, Kaufmann R et al: S2k Kurzleitlinie Basalzellkarzinom der Haut. Dtsch Dermatol Ges 2013; 11: 11-6 • Leverkus M: Malignant epithelial tumors: Part I. Pathophysiology and clinical features. J Dtsch Dermatol Ges 2012; 10: 457-71 – quiz 472 • Lichte V, Breuniger H, Metzler G et al: Acral lentiginous melanoma: conventional histology vs. three-dimensional histology. Br J Dermatol 2009; 160(3): 591-9 • Madan V, Lear JT, Szeimies RM: Non-melanoma skin cancer. Lancet 2010; 375: 673-85 <br />• Moehrle M, Dietz K, Garbe C, Breuninger H: Conventional histology vs. three-dimensional histology in lentigo maligna melanoma. Br J Dermatol 2006; 154(3): 453-9 <br />• Mohs FE: Chemosurgery: A microscopically controlled method of cancer excision. Arch Surg 1941 • Richtig E et al: Follow-up of actinic keratoses after shave biopsy by in-vivo reflectance confocal microscopy--a pilot study. J Eur Acad Dermatol Venereol 2010; 24: 293-8 • Trakatelli M, Ulrich C, del Marmol V et al: Epidemiology of nonmelanoma skin cancer (NMSC) in Europe: accurate and comparable data are needed for effective public health monitoring and interventions. Br J Dermatol 2007; 156(Suppl 3): 1-7</p>
</div>
</p>