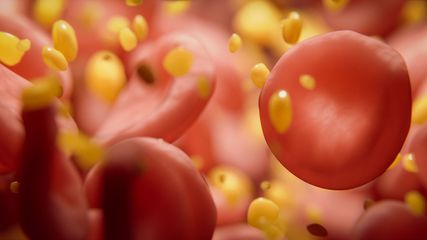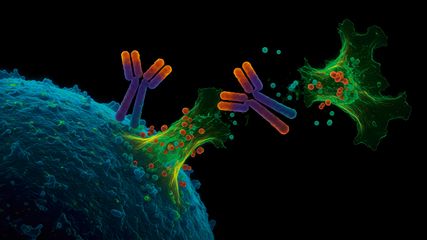mRNA-Technologie: neue Impfstoffe mit Vor- und Nachteilen
Bericht:
Reno Barth
Im Zuge der Covid-19-Pandemie hatten die ersten mRNA-Impfstoffe Premiere. Die erzielten Erfolge haben dazu beigetragen, dass derzeit mRNA-Vakzine für eine Vielzahl von Indikationen entwickelt werden. Ein großer Vorteil liegt in der einfachen Entwicklung und leichten Skalierbarkeit der Produktion.
Klassische Impfstofftechnologien präsentieren das Antigen, gegen das eine Immunisierung erzeugt werden soll, auf unterschiedliche Weise demImmunsystem. Das können Totimpfstoffe sein, attenuierte Lebendimpfstoffe, rekombinante Proteinimpfstoffe oder Toxoid- und Glykokonjugat-Impfstoffe. „So hat man mehr als 100 Jahre lang Impfstoffe hergestellt“, erklärte Univ.-Prof. Dr. Florian Krammer, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York City, und Medizinische Universität Wien. „mRNA-Impfstoffe sind anders – sie enthalten kein Antigen, sondern basieren auf einer mRNA, die zwar für das Antigen codiert, selbst aber kein Antigen ist. Weiters enthalten sie Lipide, in die die mRNA verpackt ist, sowie Exzipienten, die man für die Formulierung braucht. Man stellt den Impfstoff also nicht in einem Bioreaktor her, sondern man verwendet den Körper der geimpften Person als Bioreaktor.“
Große Impfstoffmengen können in kurzer Zeit produziert werden
mRNA, die für das gewünschte Antigen codiert, wird enzymatisch hergestellt. DieseMethode hat dem Vorteil, so Krammer, dass sich damit große Mengen an Impfstoff in kurzer Zeit herstellen lassen. Im Anschluss wird die mRNA aufgereinigt und in Fettpartikel („lipid nanoparticles“; LNP) verpackt. Diesem Vorgang kommt hohe Bedeutung zu, da Verunreinigungen in Form von RNA-Bruchstücken die Wirksamkeit des Impfstoffs beeinträchtigen. Nach der Impfung wird die RNA von Zellen aufgenommen. Die Zellen stellen in der Folge das Antigen her, gegen das der Körper eine Immunantwort entwickelt. Vier mRNA-Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 bzw. das humane respiratorische Synzytial-Virus (RSV) sind mittlerweile zugelassen (Moderna, Pfizer/BioNTech, Arcturus Therapeutics).
Die Idee, mRNA oder DNA für die Herstellung von Impfstoffen zu nützen, ist nicht neu. Die Umsetzung scheiterte bis vor Kurzem jedoch an technischen Problemen. Es wird nämlich ein Trick benötigt, um das angeborene Immunsystem zu überlisten, damit dieses nicht bereits auf die mRNA reagiert unddamit die Produktion von Antigen unterbindet. Dazu wird das Nukleosid Uridin in der RNA durch Pseudouridin ersetzt, das eine etwas andere Struktur aufweist. In der Folge wird die RNA vom Immunsystem nicht als RNA erkannt. Gleichzeitig kommt es zu einer sehr starken Expression des Antigens.1
Die ersten bis zur Zulassung und zum klinischen Einsatz entwickelten mRNA-Impfstoffe richten sich gegen Covid-19, indem sie in den Zielzellen die Produktion des Spikeproteins von SARS-CoV-2 induzieren, gegen das es in der Folge zu einer Immunreaktion durch T- und B-Zellen kommt. Der Impfstoff wird intramuskulär injiziert, gelangt jedoch kaum in Muskelzellen, da diese wenig mit LNP interagieren. Stattdessen kommt es zur Infiltration mit dendritischen Zellen und Makrophagen, die die LNP samt mRNA aufnehmen und in die Lymphknoten migrieren. Zusätzlich diffundieren LNP auch direkt in die Lymphknoten. Im Zuge dieses Prozesses ist mRNA transient auch im Blut, in der Leber und in der Milz nachweisbar. Die Präsentation der Antigene an T- und B-Zellen erfolgt im Falle der Covid-19-Impfung v.a. im Lymphknoten.2
Allerdings können LNP auch mit Affinität zu anderen Zielorganen konstruiert werden, erläuterte Krammer. Damit besteht die Möglichkeit, mRNA gezielt in bestimmte Gewebe und Organe zu bringen, was vor allem bei therapeutischen Anwendungen der mRNA-Technologie großes Potenzial hat. Beispielsweise ist es mittlerweile möglich, mittels geeigneter LNP die Blut-Hirn-Schranke zu durchdringen.
Weiterentwickelte mRNA-Technologie bereits in der Klinik
Bereits die Phase-III-Studiendaten des Pfizer-Impfstoffs gegen SARS-CoV-2 zeigten, wie gut mRNA-Impfstoffe funktionieren, so Krammer. Mittlerweile wurde die Technologie der klassischen mRNA-Impfung weiterentwickelt. So ist beispielsweise in Japan ein von der Firma Arcturus Therapeutics entwickelter Covid-Impfstoff auf Basis einer SAM(„self-amplifying“)-RNA zugelassen. Diese enthält zusätzlich zu den für das Antigen codierenden Sequenz noch ein Replikon eines Alphavirus. Gelangt diese mRNA in eine Zelle, so wird das Virus-Replikon exprimiert und es amplifiziert in der Folge auch die für das Antigen codierende Sequenz. Krammer: „Das heißt, man kann mit einer sehr viel niedrigeren Dosis arbeiten, da die RNA sich in der Zelle selbst repliziert. Typischerweise bekommt man mit SAM-RNA starke CD8+-T-Zell-Antworten, was diese Technologie für die Krebstherapie interessant macht.“ Zurzeit werden auch transamplifizierende mRNA-Impfstoffe entwickelt. Diese beruhen auf der Applikation zweier unterschiedlicher RNA-Stränge, vondenen einer die Sequenz enthält, die für dasAntigen codiert, der andere das Virus-Replikon. Die Vorteile liegen darin, so Krammer, dass das Verhältnis der beiden Sequenzen variiert werden kann. Weiters kann die RNA mit dem Amplikon hergestellt und vorrätig gehalten werden, wenn das Antigen noch gar nicht bekannt ist. Einen weiteren Schritt könnte in Zukunft zirkuläre RNA bringen, die derzeit noch präklinisch getestet wird, dabei aber sehr gute Ergebnisse bringt.
Aufgrund der Erfolge des mRNA-Vakzins gegen Covid-19 werden diese Impfungen aktuell in den verschiedensten Indikationenuntersucht. Ein mRNA-Impfstoff gegen RSVwurde bereits zugelassen. Ein weiterer neuer mRNA-Impfstoff in der Pipeline richtet sich gegen das Zytomegalievirus (CMV), das ein Problem für Neugeborene darstellt und bei Erstinfektionen in der Schwangerschaft sowie bei Immunsupprimierten gefährlich sein kann. Der von Moderna entwickelte Impfstoff wird derzeit in Phase-III-Studien untersucht. Weitere Impfstoffkandidaten (Phase I; Moderna) richten sich gegen das Epstein-Barr-Virus (EBV), den Erreger des Pfeifferschen Drüsenfiebers, der auch mit Krebs und vor allem Multipler Sklerose assoziiert ist, gegen Herpes-simplex-Viren (HSV-1, HSV-2), die Lippenherpes, Genitalherpes, Herpes-simplex-Enzephalitis oder Herpes neonatorum verursachen (Phase I; Moderna). Untersucht werden auch Kombinationsimpfstoffe gegen respiratorische Viren. Kombinierte Impfungen gegen Influenza und Covid-19 werden von Pfizer und Moderna entwickelt und aktuell in klinischen Studien der Phase III untersucht.
Des Weiteren wird an Impfungen gegen HIV, Zika- und Nipah-Virus sowie gegen bakterielle Erreger und Parasiten gearbeitet. Mehrere Firmen treiben mittlerweile die Entwicklung voran. Es bestehe sogar die Gefahr,so Krammer, dass sich die gesamte Impfstoffforschung zunehmend auf mRNA-Technologie konzentriert, was insofern problematisch sei, als diese Technologie nicht gegen alle Erreger gleichermaßen gut funktioniert.
Schwierigkeiten bei der Entwicklung der Influenzaimpfung
Eine Erkrankung, bei der mit mRNA-Impfstoffen bislang nicht der gewünschte Erfolg erzielt wurde, ist die Influenza. Zwar konnte hier beispielsweise gegen den Vogelgrippe-Stamm H10 in Frettchen (dem wichtigsten Tiermodell für die Influenza) eine extrem gute Immunantwort erreicht werden, dies ließ sich allerdings nicht auf den Menschen umlegen.3 In der ersten Humanstudie wurde lediglich ein niedriger Antikörpertiter erreicht, der obendrein nicht einmal ein halbes Jahr anhielt.4 Krammer: „Dieses Problem ist bei mRNA-Impfstoffen leider nicht selten. Man bekommt im Tiermodell eine spektakuläre Immunantwort, die sich dann beim Menschen nicht erzeugen lässt. Daher bin ich im Fall der Influenza etwas skeptisch.“
Insbesondere bei Influenza B kam man mit den mRNA-Vakzinen anfangs nicht wunschgemäß voran. So zeigte eine Studie mit einem quadrivalenten mRNA-Impfstoff, dass damit zwar gegen zwei Influenza-A-Stämme bessere Wirksamkeit erreicht wird als mit dem inaktivierten saisonalen Impfstoff, dass dies bei zwei Influenza-B-Stämmen jedoch nicht gelang.5 Krammer: „Das ist vermutlich der Grund, warum es noch keine zugelassenen mRNA-Impfstoffe gegen Influenza gibt. Bei Influenza B funktionierte die Technologie bisher noch nicht wunschgemäß.“ Das Problem wurde allerdings mittlerweile gelöst und die aktuellen Phase-III-Effizienzdaten von Moderna zeigen eine erhöhte Wirksamkeit im Menschen gegenüber herkömmlichen Influenzaimpfstoffen.6
Ein weiteres ungelöstes Problem der mRNA-Technologie ist die mukosale Immunantwort. Ein respiratorischer Infekt führt dazu, dass in der Schleimhaut T-Zellen und sekretorisches Immunglobulin A eine Immunität gegen den Erreger erzeugen und dieser bei neuerlichem Kontakt überhaupt nicht in den Organismus gelangt. Dies tritt nach einer mRNA-Impfung nicht ein. Krammer: „Das ist ein Problem, denn ich will mich ja nicht bloß vor einer Erkrankung schützen, sondern am besten vor der Infektion. Daher wird an mukosalen Formulierungen gearbeitet.“ Ein mRNA-Impfstoff per Nasenspray appliziert könnte dieses Problem lösen.
Leichtere Entwicklung von Impfstoffen gegen Parasiten
Letzlich wies Krammer jedoch auf die Vorteile der mRNA-Impfstoffe hin. Diese liegenunter anderem in der einfachen Entwicklungund Produktion neuer Vakzine. Im Gegensatz zur konventionellen Impfstoffherstellung können unterschiedliche mRNA-Impfstoffe mit dem gleichen Produktionsprozess hergestellt werden. Krammer: „Damit wird es einfacher, unterschiedliche Impfstoffe in die Klinik zu bringen.“ Ein weiterer Vorteil der mRNA-Technologie liegt darin, dass sich damit sehr viele Antigen-Targets relativ schnell testen lassen. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn Impfstoffe gegen relativ komplexe Organismen wie Parasiten entwickelt werden sollen.
Die Technik hat auch therapeutisches Potenzial. So kann durch entsprechende mRNA die Produktion therapeutischer Antikörper im Organismus angestoßen werden. Dazu ist keine Immunantwort erforderlich. Vielmehr werden zwei RNA appliziert, die für die leichte und die schwere Kette eines Antikörpers codieren. Der potenzielle Vorteil liegt darin, dass sich auf diesem Weg die Kosten für Antikörpertherapien massiv reduzieren lassen und damit eine breitere Anwendung therapeutischer oder protektiver Antikörper ermöglicht werden könnte. Die Forschung dazu befindet sich allerdings noch im präklinischen Stadium.2 Ebenfalls gearbeitet wird an mRNA-Impfstoffen mit reduzierter Reaktogenität, da aktuell deutlich spürbare Immunreaktionen nach den Impfungen relativ häufig sind.
Quelle:
„mRNA basierte Technologien – was ist möglich?“; Vortrag von Univ.-Prof. Dr. Florian Krammer, NYC und Wien, im Rahmen des ÖIK am 21.März 2025 in Saalfelden
Literatur:
1 Karikó K et al.: Mol Ther 2008; 16(11): 1833-40 2 Pardi N, Krammer K: Nat Rev Drug Discov 2024; 23(11): 838-61 3 Bahl K et al.: Mol Ther 2017; 25(6): 1316-27 4 Feldman RA et al.: Vaccine 2019; 37(25): 3326-34 5 Ananworanich J et al.: J Infect Dis 2025; 231(1): e113-e122 6 https://feeds.issuerdirect.com/news-release.html?newsid=4899326521164266&symbol=MRNA ; zuletzt aufgerufen am 18.8.2025
Das könnte Sie auch interessieren:
Lipidtherapie bei Menschen mit HIV
Patienten mit Human-Immunodeficiency-Virus(HIV)-Infektion haben ein erhöhtes Risiko für Atherosklerose-bedingte kardiovaskuläre Krankheiten. Zusätzlich können die antiretrovirale ...
Infektionen in der Schwangerschaft: Zikavirus, Parvovirus, CMV & Co
Das Thema viraler Schwangerschaftsinfektionen präsentiert sich wie ein Eisberg, so Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Lukas Weseslindtner, Zentrum für Virologie der Medizinischen Universität ...
Mit Antikörpern gegen bakterielle Infektionen
In Zeiten zunehmender Antibiotikaresistenzen werden innovative Strategien gegen bakterielle Erreger dringend benötigt. Als eine der potenziellen Lösungen bieten sich therapeutische ...