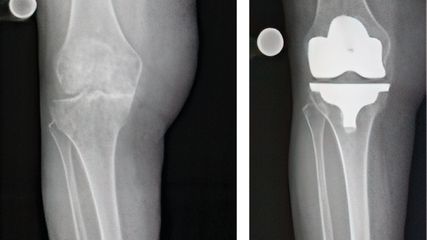<p class="article-intro">Nach erfolgreicher Grundlagenforschung und ersten klinischen Erfahrungen besteht erstmals berechtigte Hoffnung, Patienten nach frischen Querschnittverletzungen eine kausale Therapie anbieten zu können.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Bereits in den späten 1980er-Jahren wurde die extrakorporale Stoßwelle erstmals am Patienten zur Desintegration von Nierensteinen eingesetzt. Mittlerweile ist die Nierensteinlithotripsie „GoldStandard“ in der Urologie geworden. Die Behandlung ist nicht invasiv und weitgehend komplikationslos.</p> <p>1986 beschrieb der Urologe Gerald Haupt bei Röntgenkontrollen nach Uretersteinbehandlungen Verdickungen der Darmbeinschaufel, womit sich erstmals eine stimulierende Interaktion zwischen Stoßwellen und biologischem Gewebe (in diesem Fall Knochen) zeigte. Auch bei der Behandlung von chronischen Tendinopathien zeigte die Stoßwelle gute klinische Ergebnisse, sodass sie sich primär in der Orthopädie und Unfallchirurgie durchzusetzen begann.</p> <h2 class="Zwischentitel-1">Gesundes und pathologisches Gewebe reagieren unterschiedlich</h2> <p>Erst als – durch Zufall – der regenerative Einfluss der Stoßwelle bei Wundheilungsstörungen und chronischen Wunden beobachtet wurde, begann man zunehmend, den Wirkmechanismus der Stoßwelle zu untersuchen. Mittlerweile gibt es über 500 Arbeiten, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Ganz offensichtlich werden durch die Stoßwelle Zug-, Druck- und Scherkräfte ins Gewebe eingebracht, die dort eine biologische Reaktion auslösen. Dieser Effekt wird als Mechanotransduktion bezeichnet. Die Umwandlung von mechanischen Kräften in biologische Reaktionen ist uns durchaus bekannt und vertraut, man denke nur an die Vermehrung der Muskelmasse durch körperliches Training oder den Einfluss von mechanischer Belastung auf den Metabolismus des Knochens: Schon Aufenthalte von 10 bis 12 Wochen im Weltraum verändern die knöcherne Struktur der Betroffenen dermaßen, dass nach Rückkehr auf die Erde Spontanfrakturen bei alltäglicher Belastung beobachtet wurden.</p> <p>So konnte die Grundlagenforschung nachweisen, dass unter dem Einfluss der Stoßwelle Wachstumsfaktoren freigesetzt werden, die die Gefäßneubildung anregen. Man stellte fest, dass Gewebe nicht stereotyp reagieren, sondern unterschiedlich, je nach Ausprägung der Pathologie. So reagiert ischämisches Gewebe deutlich stärker als gesundes. Zusätzlich konnte ein entzündungsmodulierender Effekt der Stoßwelle nachgewiesen werden. Besonders faszinierend sind die Arbeiten, die zeigen, dass unter dem Einfluss der Stoßwelle auf pathologisches Gewebe körpereigene Stammzellen rekrutiert werden, sich vermehrt im behandelten Gewebe ansiedeln („homing“) und dort auch ihre Differenzierung gefördert wird.</p> <h2 class="Zwischentitel-1">Erste Studie bei Querschnitt­patienten begonnen</h2> <p>Die Grundlagenforschung konnte diese regenerativen Effekte auch am peripheren Nerven nachweisen, sodass bereits der erste klinische Versuch bei frisch verletzten Fingernerven im AUVA-Traumazentrum Wien begonnen wurde. Es ist daher nur allzu verständlich, dass auch die Wirkung der Stoßwelle am Rückenmark sowie am zentralen Nervensystem zunehmend Aufmerksamkeit gewann. Auch bei diesen Geweben konnte nachgewiesen werden, dass die Stoßwelle die Heilung beschleunigt und zum Teil erst ermöglicht. Deshalb wurde unter der Ägide der AUVA die erste prospektive, randomisierte, doppeltgeblindete Studie bei chronischen Querschnittpatienten begonnen. Da es sich um eine „Proof of principles“-Studie handelt, wurden Patienten ausgewählt, bei denen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine spontane Verbesserung zu erwarten war. Es wurden nur Patienten mit kompletten Querschnittläsionen (ASIA A) mindestens ein Jahr nach dem Trauma ohne Zeichen einer Spontanremission in den letzten 6 Monaten in diese Studie eingeschlossen. Die Studie wurde 2015 begonnen und bisher schloss man 32 von den insgesamt 50 geplanten Patienten darin ein. Da es sich um eine geblindete Studie handelt, gibt es noch keine Ergebnisse. Wesentlich aber ist, dass es zu keinen unerwünschten Nebenwirkungen gekommen ist. Die Studie kann voraussichtlich 2019 abgeschlossen werden. Abbildung 1 zeigt an einem Modell, wie einfach die Stoßwellenbehandlung durchzuführen ist. Es werden paravertebral je 2500 Impulse ins Gewebe eingebracht, was einer Behandlungsdauer von knapp 17 Minuten entspricht.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Ortho_1804_Weblinks_s32.jpg" alt="" width="250" /></p> <p>Zwischenzeitlich hat sich die Grundlagenforschung, vor allem im Ludwig Boltzmann Institut für experimentelle und klinische Traumatologie in Wien und an der Herzchirurgie der Universität Innsbruck, intensiv mit der Applikation der Stoßwelle bei der akuten Schädigung des Rückenmarks auseinandergesetzt. Die Effekte in Zellkulturen, vor allem aber im Tiermodell, zeigten Ergebnisse, die unsere Erwartung bei Weitem übertrafen.</p> <h2 class="Zwischentitel-1">Herzchirurgen entdecken kausale Therapie nach ischämischen Rückenmarksschädigungen</h2> <p>Im Rahmen von Aneurysmaoperationen kann es in bis zu 30 % der Fälle zur ischämischen Schädigung des Rückenmarks mit entsprechender Querschnittsymptomatik kommen. Für diese Patienten gibt es derzeit keine kausale Therapie. An der Herzchirurgie der Universität Innsbruck wurde unter der Führung von PD Dr. Johannes Holfeld in einem Tiermodell nachgewiesen, dass unmittelbar nach ischämischer Schädigung des Rückenmarks (Klemmen der Aorta) die applizierte Stoßwellentherapie die Schäden signifikant reduzieren kann (Abb. 2–4). Die Ergebnisse dieser Studie wurden im „Journal of the American Heart Association“ veröffentlicht.<sup>1</sup></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Ortho_1804_Weblinks_s32_2.jpg" alt="" width="1456" height="1997" /></p> <p>Diese Ergebnisse waren so überzeugend, dass nun eine prospektive, nicht kontrollierte Studie begonnen wurde, bei der Patienten nach ischämischem Spinaltrauma möglichst frühzeitig mit Stoßwellen behandelt werden. Die ersten Ergebnisse sind sehr ermutigend, wenngleich aus verständlichen Gründen keine Vergleichsgruppe gebildet werden kann.</p> <h2 class="Zwischentitel-1">Laufende Studie erforscht Wirkmechanismus der Stoßwelle am Rückenmark</h2> <p>Parallel dazu startete eine experimentelle Rückenmarkstudie im Ludwig Boltzmann Institut für experimentelle und klinische Traumatologie in Wien, in der die Effekte einer Stoßwellenbehandlung in der subakuten (2 Wochen post Trauma) und chronischen Phase nach einem Kontusionsschaden untersucht werden (Abb. 5).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Ortho_1804_Weblinks_s32_3.jpg" alt="" width="250" height="332" /></p> <p>Abgesehen von einer umfangreichen funktionellen und morphologischen Auswertung, besteht ein wesentlicher Fokus dieser Studie in der Erforschung der zugrunde liegenden Mechanismen, welche durch die Stoßwellenbehandlung induziert werden. Dabei wird den Tieren zu bestimmten Zeitpunkten vor, während und nach der Therapie Blut abgenommen und ein microRNA-Screening durchgeführt. Durch die Analyse der verschiedenen microRNA- Expressionsmuster werden Veränderungen auf zellulärer und subzellulärer Ebene aufgedeckt und damit wird ein Rückschluss auf die Wirkung der Stoßwelle gezogen.</p> <p>Mithilfe einer innovativen und hochauflösenden µCT-Bildgebung können, nach Färbung mit Lugol’scher Lösung, Veränderungen auf morphologischer Ebene detailliert dargestellt und im Anschluss histologisch bzw. immunhistochemisch analysiert werden (Abb. 6).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Ortho_1804_Weblinks_s32_4.jpg" alt="" width="1417" height="944" /></p> <p>Erste Ergebnisse der noch laufenden Studie zeichnen ein vielversprechendes Bild. Im Modell der chronischen Kontusion konnte ein signifikant verbessertes funktionelles Ergebnis im „open field walking test“, dem sogenannten BBB-Score, im Vergleich zur Kontrollgruppe festgestellt werden. Erste Ergebnisse des microRNA-Screenings werden in den kommenden Tagen erwartet.</p> <p>Die komplette Auswertung des subakuten und chronischen Versuchsaufbaus ist bis Ende 2018 vorgesehen. Anhand der bereits vorliegenden Ergebnisse sind wir sehr zuversichtlich, einen wesentlichen Beitrag zur Erforschung der zugrunde liegenden Mechanismen einer Stoßwellenbehandlung zu einem subakuten und chronischen Zeitpunkt nach einem Kontusionstrauma des Rückenmarks leisten zu können.</p> <h2 class="Zwischentitel-1">Klinische Studie zur Behandlung des akuten Spinaltraumas für 2019 geplant</h2> <p>Eine Übersicht über diese zum Teil wirklich spektakulären Entdeckungen wurde im Rahmen der ASCIS-Sitzung im Oktober 2017 während des Kongresses der ÖGU einem breiteren Publikum vorgestellt. Aufgrund der überzeugenden Datenlage und der Tatsache, dass derzeit keine andere kausale Therapie für eine klinische Anwendung beim akuten Spinaltrauma zur Verfügung steht, haben sich alle Vorstände der Universitätskliniken Österreichs sowie die Primare der AUVA-Unfallkrankenhäuser bereit erklärt, an einer solchen klinischen Studie teilzunehmen. Um österreichweit eine möglichst flächendeckende Versorgung aller Patienten mit frischen Querschnittverletzungen zu ermöglichen, haben auch die Vorstände des Landeskrankenhauses Feldkirch und des Donauspitals in Wien ihre Teilnahme zugesagt.</p> <p>Die Realisierung dieser Studie wird durch die Unterstützung der AUVA und der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg gewährleistet. Dies zeigt, dass die AUVA nicht nur in der Unfallheilbehandlung und Rehabilitation von Patienten, sondern auch in der traumatologischen Forschung eine ganz zentrale, unersetzbare Rolle spielt. An dem Studiendesign wird bereits intensiv gearbeitet und wir hoffen, es bis zum Spätherbst den zuständigen Ethikkommissionen vorlegen zu können.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Lobenwein D et al.: Shock wave treatment protects from neuronal degeneration via a toll-like receptor 3 dependent mechanism: implications of a first-ever causal treatment for ischemic spinal cord injury. J Am Heart Assoc 2015; 4(10): e002440</p>
</div>
</p>