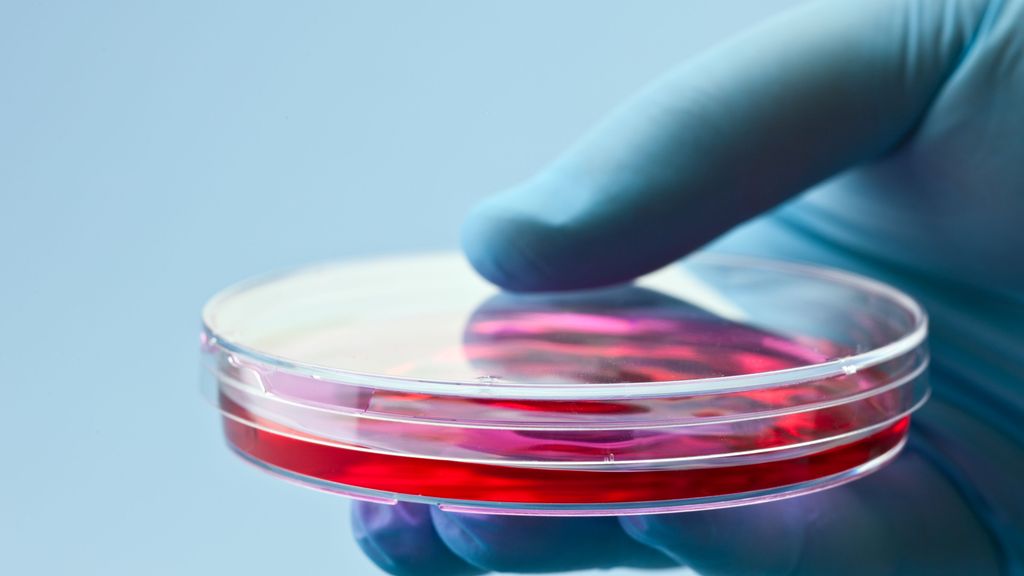<p class="article-intro">Im Zusammenhang mit der Tatsache, dass bei vielen soliden Tumoren dank innovativer Therapien immer höhere Überlebensraten erzielt werden können, nimmt die wiederherstellende Chirurgie beim onkologischen Patienten zunehmend eine bedeutende Rolle ein. Die Planung und Durchführung von rekonstruktiven Verfahren stellen das interdisziplinäre Team vor spezielle fachliche und logistische Herausforderungen. Nicht zuletzt ist auch der psychische Leidensdruck der Patienten zu berücksichtigen.</p>
<hr />
<p class="article-content"><h2>Rekonstruktive Chirurgie – eine Herausforderung</h2> <p>Rekonstruktive Operationen stellen transdisziplinäre Situationen dar und können alle Alters- und Patientengruppen betreffen. Die damit verbundenen Herausforderungen erfordern ein komplexes Setting sowie eine aufwendige Logistik und Ablauforganisation. Auch in der Planung von plastisch-chirurgischen rekonstruktiven Verfahren in fortgeschrittenen onkologischen Situationen ergeben sich Spannungsfelder, die sich auf Fragen wie technische Möglichkeiten vs. realistische Anwendung und die Sinnhaftigkeit von machbaren Eingriffen beziehen. Nicht unberücksichtigt bleiben darf in diesem Zusammenhang die Erwartungshaltung der Patienten, welche sich oft ein unrealistisches Bild von den Ergebnissen des rekonstruktiven Eingriffes machen. Um potenziellen Enttäuschungen vorzubeugen, sollten die geplanten Verfahren im Rahmen des Aufklärungsgesprächs unbedingt evaluiert und erörtert werden.<br /> Je nach Umfang und funktioneller Anforderung an das rekonstruktive Verfahren ergeben sich häufig auch von plastisch-chirurgischer Seite Probleme, die auf die kompromittierte Immunsituation, das Vorliegen von Komorbiditäten oder konkomitante Infektionen zurückzuführen sein können. Lokal finden sich meist komplexe Wunden in Bestrahlungsfeldern mit Durchblutungsstörungen und Infekten bei kataboler Stoffwechsellage. Postoperative Wundheilungsstörungen oder partielle Gewebenekrosen treten daher bei rekonstruktiven Operationen an onkologischen Patienten gehäuft auf und machen die Situation zusätzlich komplexer bzw. verlängern den stationären Aufenthalt.<br /> Bei der Planung einer (semielektiven) Rekonstruktion unter erschwerten Voraussetzungen ergeben sich einige Probleme, die im Vorfeld erörtert werden müssen. Häufig handelt es sich um ein palliatives Setting – demnach ist keine kurative Intention gegeben und die Lebenserwartung limitiert. Die Durchführung rekonstruktiver Verfahren ist häufig aufwendiger und mit mehr Risiken für das Auftreten von Komplikationen assoziiert als die ablative Primäroperation. Das onkologische Team muss dieser Situation und auch dem psychischen Druck seitens des Patienten Rechnung tragen.<br /> Zu Rekonstruktion und Gewebeersatz können alle Verfahren der plastisch-rekonstruktiven Chirurgie Anwendung finden, dies kann von einfachen lokalen Methoden oder Transplantaten bis hin zu aufwendigen Fernlappen oder mikrochirurgisch transferierten Kompositelappen aus mehreren Gewebebestandteilen reichen. Diese müssen je nach Bedarf und Lokalisation des zu sanierenden Gebietes ausgewählt und verwendet werden. In der Planung und Durchführung der plastisch-chirurgischen Strategie hat sich die Wahl von sicheren Standardverfahren unter Verwendung möglichst großer Lappen als hilfreich erwiesen. Grundsätzlich gilt dabei, dass einstufige Konzepte gegenüber mehrstufigen bevorzugt werden sollten. Mehrzeitige Verfahren haben nur bei gesicherter onkologischer Situation mit entsprechender Lebenserwartung ihre Berechtigung.<br /> Entscheidend ist dabei auch die präoperative Optimierung der allgemeinen Ausgangssituation (Korrektur einer Anämie, Verbesserung einer Malnutrition etc.), bevor entsprechende Eingriffe durchgeführt werden. Komplikationen sollten weitestgehend antizipiert und entsprechende prophylaktische Maßnahmen getroffen werden.</p> <h2>Conclusio</h2> <p>Die plastisch-chirurgische Wiederherstellung nach ausgedehnter Metastasenchirurgie kann heute technisch mit einem großen Methodenspektrum mit guten Ergebnissen durchgeführt werden. Der sinnvolle Einsatz muss jedoch individuell unter Abwägung der Risiken und des zu erwartenden Benefits entschieden werden. Die Vorteile für die betroffenen Patienten müssen dabei überwiegen und das Verfahren zu einer Verbesserung der Lebensqualität führen.</p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: Univ.-Klinik für Plastische, Rekonstruktive
und Ästhetische Chirurgie<br/>
Medizinische Universität Innsbruck<br/>
E-Mail: gerhard.pierer@uki.at
Quelle: 2. Jahreskongress des DONKO
(Dachverband onkologisch tätiger
Fachgesellschaften Österreichs),
27. März 2015, Wien
</p>