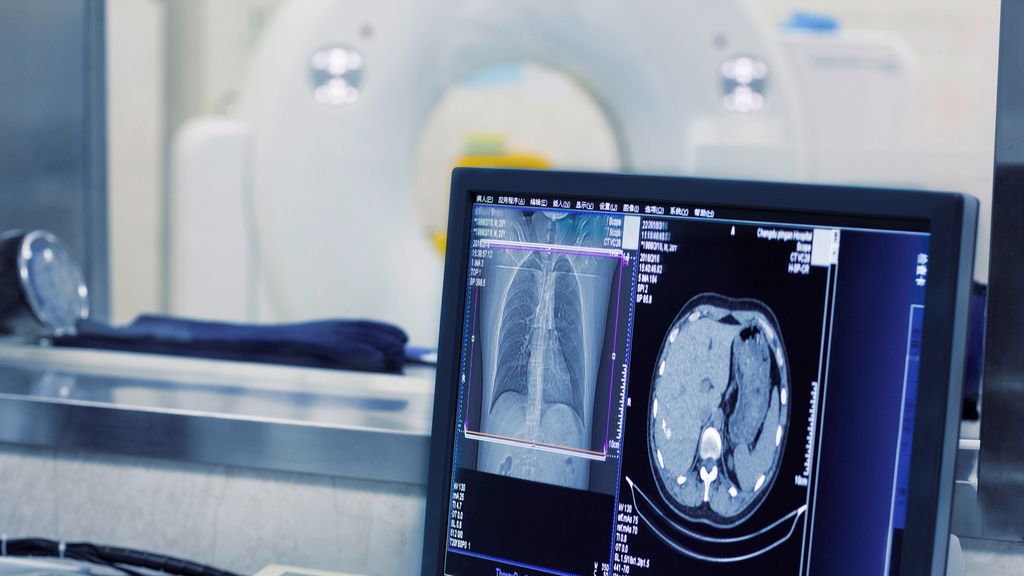
Tirolung Screen – ein Pilotprojekt
Autoren:
Dr. Florian Kocher, PhD
Assistenzarzt
E-Mail:
florian.kocher@i-med.ac.at
Universitätsklinik für Innere Medizin V
Innsbruck
Dr. Georg Pall
Oberarzt
E-Mail:
georg.pall@tirol-kliniken.at
Universitätsklinik für Innere Medizin V
Innsbruck
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Unter der Schirmherrschaft der Innsbruck Thoracic Oncology Group (ITOG) wird derzeit im Zentralraum Tirol ein Screening-Projekt zur Lungenkrebsfrüherkennung entwickelt. Wir möchten hier auf wichtige Aspekte und konkrete Überlegungen in diesem Zusammenhang eingehen.
In den letzten Jahren konnten zwei randomisierte Phase-III-Studien eine Senkung der Bronchialkarzinom-Mortalität durch Früherkennung mittels Low-Dose-CT belegen.1,2 Somit stellt die Etablierung von qualitativ hochwertigen, praktikablen und kosteneffektiven Screening-Programmen eine gesundheitspolitisch und medizinisch prioritäre Aufgabe dar. Attraktiv scheint dabei die Strategie, anhand von räumlich begrenzten Pilotprojekten die Machbarkeit in der klinischen Praxis zu evaluieren. In weiterer Folge könnten die so gesammelten Erfahrungen als Grundlage für die Ausrollung bundesweiter Projekte dienen.
Screening-Population
In der NELSON-Studie erfüllten 30959 von 148730 gescreenten Personen im Alterssegment von 50–74 Jahren die Einschlusskriterien. Das entspricht in etwa einem Anteil von 20% im Kollektiv der Personen mit vollständig retournierten Fragebögen.1 Unter der Annahme, dass in Österreich ein ähnliches Rauchverhalten wie in Belgien und den Niederlanden (Durchführungsregion der NELSON-Studie) vorliegt, würden sich über 500000 Österreicher für ein Lungenkarzinom-Screening mittels Low-Dose-CT qualifizieren. Eine derart große Anzahl an potenziellen Screening-Probanden würde mit großer Wahrscheinlichkeit sowohl logistische als auch personelle Ressourcen im Land sprengen.
In der NLST- und NELSON-Studie wurden Risikokollektive anhand ihres Rauchverhaltens und ihres Alters definiert. Die Inzidenz detektierter Lungenkarzinome betrug im Low-Dose-CT-Arm 0,9% bzw. 1,1%. Mittlerweile wurden mehrere Risikoscores publiziert, die anhand umfangreicherer Parameter in der Lage sind, das spezifische Lungenkarzinomrisiko potenzieller Screening-Probanden exakter zu definieren. Es hat sich gezeigt, dass die meisten dieser Risikomodelle (u.a. PLCOm2012, LLPv2, Bach) eine – im Vergleich zu den Einschlusskriterien der NLST- und NELSON-Studie – bessere Definition eines Risikokollektivs ermöglichen.3 Hierbei scheint vor allem das PLCOm2012-Modell den anderen Risikoscores überlegen zu sein.4 An einer externen Validierungskohorte konnte gezeigt werden, dass durch den Einschluss von Patienten mit einem 6-Jahres-Lungenkarzinom-Risiko von ≥1,51% (errechnet anhand des PLCOm2012-Scores) die „number needed to screen“ deutlich gesenkt werden könnte und dennoch ausreichend Sicherheit besteht, um keine Personen auszuschließen, die potenziell von Screening-Interventionen profitieren.5 Insgesamt ist durch eine Optimierung der Probandenselektion eine Steigerung der Screening-Effizienz zu erwarten. Aus diesem Grund ist auch im Rahmen des Tirolung-Screen-Projekts eine Teilnehmerselektion anhand des PLCOm2012-Risikoscores geplant.
Screening-Intervalle
Während sich die Probanden in der NLST-Studie drei Screening-Runden in jährlichen Abständen unterzogen, wurden in der NELSON-Studie vier Screening-Untersuchungen in verschiedenen Intervallen durchgeführt (Baseline, Jahr 1, Jahr 3, Jahr 5,5). Dieses Studiendesign ermöglichte auch die Analyse des Einflusses der Zeitintervalle auf die Effizienz des Screenings. In einer Auswertung der NELSON-Studie aus dem Jahr 2017 wurde berichtet, dass hinsichtlich der Stadienverteilung und der detektierten Intervalltumoren im Vergleich vom 1-Jahres- und 2-Jahres-Screening-Intervall kein signifikanter Unterschied bestand.6 Im Gegensatz dazu traten im 2,5-Jahres-Intervall signifikant mehr Intervallkarzinome auf. Ebenso hat es den Anschein, dass durch ein Screening-Intervall von 2,5 Jahren ein Stadienshift in Richtung fortgeschrittener Stadien auftritt. Somit ist anzunehmen, dass ein verlängertes Screening-Intervall von 2,5 Jahren die Effektivität des Screenings vermindern könnte. Unter Berücksichtigung der Auswertung der NELSON-Daten ist im Tiroler Pilotprojekt ein zweijähriges Screening-Intervall nach unauffälligem 1-Jahres-Screen geplant.
Auswertung CT-Untersuchungen
In der NLST-Studie wurde jeder nicht kalzifizierte Herd >4mm als positives Screening-Ergebnis gewertet. Das hatte zur Folge, dass bei 24,2% der Patienten im Low-Dose-CT-Arm ein positives Screening-Ergebnis vermerkt wurde, aber nur bei 0,9% tatsächlich ein Lungenkarzinom detektiert werden konnte. Dementsprechend lag der positiv prädiktive Wert eines positiven Screening-Ergebnisses in der NLST-Studie bei lediglich 3,8%. Im Gegensatz dazu verwendete die NELSON-Studie eine andere Definition für positive Screening-Ergebnisse. Darüber hinaus erfolgte die Auswertung der CT-Untersuchungen mittels semiautomatischer Software. Durch die Miteinbeziehung stringenterer Definitionen, semiautomatischer Auswertung, Volumetrie pulmonaler Rundherde und der Errechnung der Verdoppelungszeit des Volumens gelang es, den positiven prädiktiven Wert für Lungenkarzinome auf 41% zu steigern. Dies gibt Anlass dazu, ein ähnliches Untersuchungsprotokoll im Tiroler Pilotprojekt zu verwenden. Die Untersuchungen erfolgen zentralisiert an der Universitätsklinik für Radiologie in Innsbruck unter Zuhilfenahme semiautomatischer Auswertungsmodalitäten durch erfahrene Thorax-Radiologen. Dadurch wird zum einen eine qualitativ hochwertige CT-Befundung sichergestellt und zum anderen ist durch die zusätzliche Verwendung volumetrischer Analysemethoden in Kombination mit den diagnostischen Kriterien der Fleischner Society eine Verbesserung des positiven prädiktiven Wertes bei pulmonalen Raumforderungen zu erwarten.
Kosteneffizienz
Ein wichtiger und nicht zu vernachlässigender Faktor bei Screening-Programmen ist deren Kosteneffizienz. Bis dato sind Kosteneffizienzanalysen aus der NELSON-Studie noch ausständig. Gemäß einer Analyse der NLST-Daten betrugen die Kosten für 1 Jahr Lebenszeitzugewinn 81000 US-Dollar. Als Hauptkostentreiber ließen sich die durchgeführten CT-Untersuchungen identifizieren. Im Rahmen des Tirolung-Screening-Projekts ist ein zusätzliches Health-Technology-Assessment geplant, um die tatsächlichen Kosten bzw. die Kostenersparnis zu evaluieren. Durch die Verwendung eines individuell risikoadaptierten Probandeneinschlusses erwarten wir eine bessere Definition des Risikokollektivs, das von Screening-Interventionen profitieren könnte. Zusätzlich erlaubt eine qualitativ hochwertige zentralisierte CT-Befundung eine Steigerung der diagnostischen Präzision und sie hilft, weitere Follow-up-Untersuchungen zu minimieren. Es hat sich gezeigt, dass der Anteil aktiver Raucher in Lungenkarzinom-Screening-Studien über den Lauf der Zeit rückläufig ist.7 Allerdings besteht eine hohe Rückfallquote. Aus diesem Grund wird im Rahmen des Tirolung-Screening-Projekts ein Raucherentwöhnungsprogramm angeboten, um die Morbidität und die Rückfallquote zusätzlich zu verringern.
Wichtige Aspekte in der praktischen Umsetzung
Für die erfolgreiche Durchführung eines Screening-Pilotprojekts ist die Kooperation vieler verschiedener medizinischer Disziplinen notwendig. Vor allem ist auch die Mithilfe der Kollegen im niedergelassenen Bereich essenziell, da im Rahmen von Routineuntersuchungen ein hohes Aufkommen von Personen mit lungenkarzinomspezifischem Risikoprofil zu erwarten ist. Somit stellen Routineuntersuchungen das ideale Umfeld dar, um Patienten niederschwellig mittels Online-Tool hinsichtlich ihres lungenkarzinomspezifischen Risikos zu evaluieren. Sofern sich die Personen potenziell für das Screening-Pilotprojekt eignen und eine Teilnahme wünschen, erfolgt die Zuweisung an unser Zentrum. Im Falle eines auffälligen Screening-Ergebnisses werden die Befunde im bestehenden interdisziplinären Rundherdboard besprochen, welchesim Jahr 2020 am Campus Innsbruck implementiert wurde. In dem wöchentlich abgehaltenen Board wird die weitere Abklärung pulmonaler Rundherde basierend auf aktuellen Empfehlungen festgelegt. Aus diesem Grund sehen wir dieses Format als ideal an, um die weitere Abklärung von Teilnehmern im Tirolung-Screen-Pilotprojekt optimal zu gewährleisten. Durch eine enge Vernetzung der involvierten Disziplinen sowohl im Krankenhaus als auch im niedergelassenen Bereich erhoffen wir uns ein optimales Patientenmanagement.
Wir sind der Meinung, dass vorerst kleinere Pilotprojekte mit begrenzter Teilnehmerzahl der richtige Weg sind, um Screening-Interventionen in der klinischen Routine zu prüfen. Offensichtlich ist jedoch, dass aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl sicherlich kein statistisch valider Überlebensvorteil in der Tiroler Bevölkerung belegt werden kann. In Anbetracht der Wichtigkeit von Screening-Interventionen hoffen wir, dass durch eine Kofinanzierung durch die öffentliche Hand und die Industrie genügend Geldmittel akquiriert werden können, um dieses Projekt umzusetzen.
Literatur:
1 De Koning HJ et al.: Reduced lung-cancer mortality with volume CT screening in a randomized trial. N Engl J Med 2020; 382(6): 503 2 National Lung Screening Trial Research Team et al.: Reduced lung-cancer mortality with low-dose computed tomographic screening. N Engl J Med 2011; 365: 395-409 3 Ten Haaf K et al.: Risk prediction models for selection of lung cancer screening candidates: aretrospective validation study. PLoS Med 2017; 14: e1002277 4 Weber M et al.: Identifying high risk individuals for targeted lung cancer screening: Independent validation of the PLCOm2012 risk prediction tool. Int J Cancer 2017; 141: 242-53 5 Tammemagi MC et al.: Evaluation of the lung cancer risks at which to screen ever- and never-smokers: screening rules applied to the PLCO and NLST cohorts. PLoS Med 2014; 11(12): e1001764 6 Yousaf-Khan U et al.: Final screening round of the NELSON lung cancer screening trial: the effect of a 2.5-year screening interval. Thorax 2017; 72: 48 7 Tammemägi MC et al.: Impact of lung cancer screening results on smoking cessation. J Natl Cancer Inst 2014; 106: dju084
Das könnte Sie auch interessieren:
Highlights zu Lymphomen
Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1
ASH 2020 – Highlights zu den aggressiven Lymphomen
Highlight-Themen der virtuellen ASH-Jahrestagung im Dezember 2020 waren an erster Stelle die Immunonkologika in all ihren Variationen, aber auch Beispiele für innovative Sequenztherapien ...
Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten
Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...


