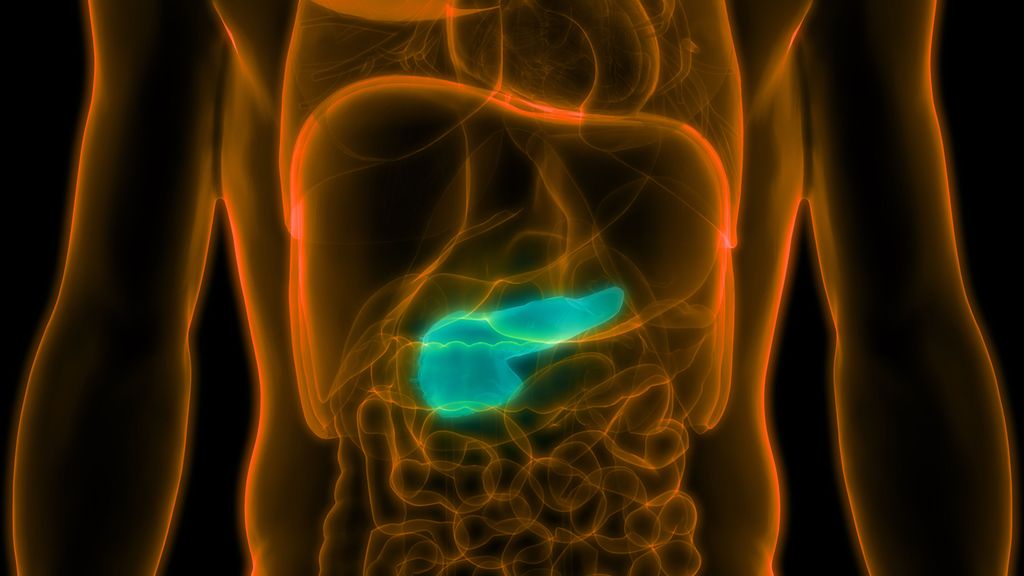
Pankreaskarzinom und Gallengangskarzinom: „Present and Future“
Autor:
Priv.-Doz. OA Dr.
Konstantin Schlick
Onkologische Ambulanz
Universitätsklinikum Salzburg
E-Mail: k.schlick@salk.at
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Für Palliativpatienten mit Pankreas- oder Gallengangskarzinom bieten zielgerichtete Therapien mithilfe von „Next-generation sequencing“(NGS)-Analysen die Chance, auch dann noch die Prognose zu verbessern, wenn andere Therapiemöglichkeiten bereits ausgeschöpft sind. Neue Studien hierzu betreffen zwar nur einen kleinen Prozentsatz dieser Patienten, gestalten sich jedoch vielsprechend.
In Bezug auf Ansprechraten und Dauer einer palliativen Systemtherapie beim Pankreaskarzinom (PC) und Gallengangskarzinom (CCC) wurde mit zwei neueren Studien anscheinend vorläufig die therapeutische Obergrenze erreicht. In der NAPOLI-1-Studie handelt es sich um die Einführung von nanoliposomalem Irinotecan in Kombination mit 5-Fluoruracil (5-FU) als Erstlinientherapie beim PC, in der NIFTY-Studie um die gleiche Kombinationstherapie in zweiter Linie beim CCC. Weiters brachten viele zusätzliche Untersuchungen bei beiden Entitäten in weit gefassten „All Comer“-Studien keine neuen therapeutischen Erkenntnisse.
Zuletzt wurde jedoch intensiv versucht, mittels „Next-generation sequencing“(NGS)-Analysen von Tumoren neue Therapietargets für eine individualisierte tumor-bezogene Therapie zu finden. Solche genetischen Targets treten vor allem beim PC reichlich auf: zum Beispiel die KRAS-Mutation, die bei 94% aller Patienten mit PC nachweisbar ist, die BRCA1- und BRCA2-Mutation bei 3–5% und die SMAD4-Mutation bei ca. 5% aller Patienten.
Folgend soll ein kurzer Überblick über den Status quo der zielgerichteten Therapien und über zukünftige Therapieoptionen für ein selektioniertes Patientenkollektiv gegeben werden.
Die KRAS-Mutation als Angriffspunkt
Für Tumoren mit KRAS-Mutation spielt der Subtyp KRAS-G12C zunehmend eine wichtige therapeutische Rolle. So sind zur Behandlung von KRAS-G12C-mutiertem nicht kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) bereits zwei Medikamente, Sotorasib und Adagrasib, zugelassen. Die Mutation kommt bei rund 40% aller Patienten mit Lungenkrebs vor und konnte nun auch bei gastrointestinalen Tumoren nachgewiesen werden, wenn auch in deutlich geringerer Häufigkeit. 2–3% aller Pankreastumoren verfügen über diesen speziellen Subtyp der KRAS-Mutation. In der CodeBreaK100-Studie, in die unter anderen auch 15 Patienten mit gastrointestinalen Tumoren eingeschlossen wurden, fanden sich sechs Patienten mit PC, die eine Krankheitsstabilisierung unter Sotorasib zeigten. Ähnliche Resultate lieferte die KRYSTAL-1-Studie mit 30 Patienten mit gastrointestinalen Tumoren. Hier zeigten alle zwölf Patienten mit PC eine Stabilisierung des Tumorwachstums. 50% wiesen überdies eine partielle Remission auf.
Sonderfall KRAS-wild-type-Status
Zuletzt wurde vermehrt ein wissenschaftlicher Fokus auf Patienten mit KRAS-wild-type(KRASwt)-Status gelegt. Bei Patienten mit diesem Status lassen sich mikrosatelliteninstabile (MSI) Tumoren, neurotrophe Tyrosin-Rezeptor-Kinase(NTRK)-Fusionen und Neuregulin-1(NRG1)-Fusionen finden. Für Patienten mit MSI-Tumoren gibt es bereits eine Zulassung für den PD-1-Inhibitor Pembrolizumab in der Erstlinienbehandlung (KEYNOTE-181).
Weiters können Patienten mit einer NTRK-Fusion mit Larotrectinib oder Entrectinib therapiert werden. Diese neuen zielgerichteten Substanzen zeigten eine Gesamtansprechrate (ORR) von 75%. In den jeweiligen Studien waren jedoch nur wenige Patienten mit PC inkludiert.
Die neueste Medikamentenzulassung wurde für Patienten mit einer NRG1-Mutation erteilt, die sich in der KRASwt-Gruppe findet, also ein Ausschlusskriterium einer reinen KRAS-Mutation darstellt. Hierzu wurden beim Kongress der American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2021 Daten von zwölf Patienten mit PC präsentiert, von denen 42% ein partielles Ansprechen (PR) und 50% eine Stabilisierung der Erkrankung zeigten.
Hohe Ansprechraten bei BRAF- und RET-Inhibitoren
Zukünftig könnte es auch Therapiemöglichkeiten für Patienten mit einer BRAF-V600E-Mutation geben. Am letzten Kongress der American Association for Cancer Research (AACR) wurde eine Studie vorgestellt, in der Patienten mit nicht melanozytärem Hautkrebs mit dem selektiven BRAF-Kinase-Inhibitor Vemurafenib behandelt wurden. Einige dieser Patienten wiesen auch ein PC auf, das auf diese Therapie ansprach.
Für Patienten mit NSCLC gibt es bereits zwei für die Zweitlinientherapie zugelassene Substanzen: die RET-Rezeptortyrosinkinase-Inhibitoren Pralsetinib und Selpercatinib. Diese zeigten Ansprechraten von 60%. Auch zu dieser neuen Substanzklasse wurden erste vielversprechende Daten für das PC veröffentlicht (ARROW-Studie, LIBRETTO-001-Studie).
Targets beim Gallengangskarzinom
Beim CCC finden sich Variationen mit Mutationen von FGFR2 (<20%), BRAF (<5%), IDH (<20%), HER2 (<15%) und NTRK (<5%). Zugelassene Substanzen bzw. Substanzen, die kurz vor einer Zulassung stehen, sind die beiden FGFR-Inhibitoren Erdafitinib und Pemegatinib (FIGHT-202-Studie) sowie der IDH-Hemmer Ivosidenib (ClarIDHy-Studie). Diese Wirkstoffe erweitern das Armentarium zur Behandlung von CCC wesentlich.
Am ASCO-Symposium zu gastrointestinalen Krebserkrankungen 2022 wurden die ersten Ergebnisse der TOPAZ-1-Studie vorgestellt, die eine Immuntherapie mit Durvalumab in Kombination mit Gemcitabin/Cisplatin mit alleiniger Chemotherapie verglich. Das mediane Gesamtüberleben (OS) betrug 12,8 versus 11,6 Monate (HR: 0,80; p=0,021). Die Gesamtüberlebensrate lag bei 54,1% versus 48,0% nach zwölf Monaten. Das ORR betrug 26,7% unter der kombinierten Immunchemotherapie versus 18,7%.
Hoffnungsträger neue Zulassungen
Aktuell befindet sich eine Vielzahl an zielgerichteten Substanzen unmittelbar vor dem Einzug in die klinische Routine. Für eine Minderheit an Patienten mit PC bzw. CCC können so die bestehenden Therapiemöglichkeiten erweitert werden.
Literatur:
beim Verfasser
Das könnte Sie auch interessieren:
Highlights zu Lymphomen
Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1
ASH 2020 – Highlights zu den aggressiven Lymphomen
Highlight-Themen der virtuellen ASH-Jahrestagung im Dezember 2020 waren an erster Stelle die Immunonkologika in all ihren Variationen, aber auch Beispiele für innovative Sequenztherapien ...
Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten
Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...


