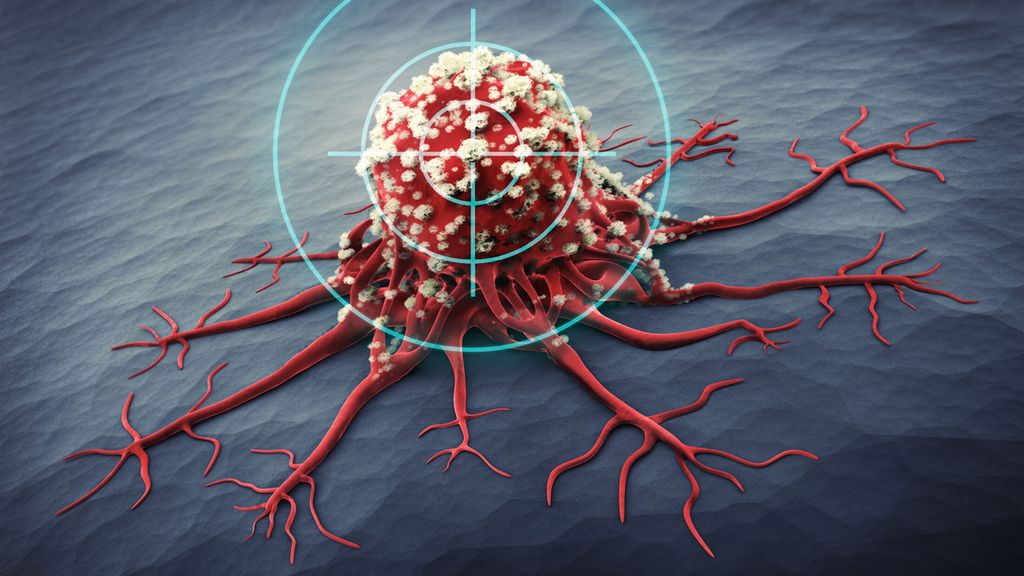<p class="article-intro">Der ASH 2017 bot einige spannende Präsentationen sowohl zur haploidenten Stammzelltransplantation als auch zur autologen SZT bei AML. Themen wie Lebensqualität von Patienten in Langzeitremission nach allogener SZT wurden ebenso behandelt wie Ernährungsstandards in der SZT. Der folgende Bericht gibt einen Überblick über die präsentierten Studienergebnisse.</p>
<hr />
<p class="article-content"><h2>Entwicklung der haploidenten Stammzelltransplantation</h2> <p>Bezüglich der haploidenten Stammzelltransplantation gibt es immer validere klinische Daten. Der Vorteil der Stammzellspende und -transplantation liegt in der raschen Identifikation eines passenden Spenders innerhalb der Familie, die eine zeitnahe Organisation und Durchführung einer Stammzelltransplantation möglich macht. Bei fehlenden HLA-identen Geschwisterspendern muss somit keine Fremdspendersuche eingeleitet werden.<br /> In einer Analyse der Acute Leukemia Working Party (ALWP) der EBMT<sup>1</sup> war die haploidente Stammzelltransplantation mit der Transplantation von Stammzellen von 10/10 match und 9/10 mis-match Stammzellspendern bei Hochrisikopatienten mit AML sowohl bezüglich des 2-Jahres-Überlebens, „non-relapse mortality“ und „relapse incidence“ vergleichbar.<br /> In Seattle wurden durch Fatobene et al.<sup>2</sup> 396 konsekutiv transplantierte Patienten ausgewertet, die zwischen 2006 und 2015 entweder haploident transplantiert wurden, „cord blood“ oder einen „mismatch“-unverwandten Spender als Stammzellquelle erhielten. Es zeigte sich, dass die Inzidenz und der Schweregrad der GvHD bei den alternativen Spendern vergleichbar war, während die Patienten, die unverwandt „mismatch“ transplantiert wurden, extensivere GvHDs entwickelt hatten und auch im funktionellen Status deutlich mehr beeinträchtigt waren. Granata et al.<sup>3</sup> konnten ebenfalls zeigen, dass bei 181 Patienten, die haploident transplantiert wurden, das progressionsfreie Überleben nach 2 Jahren bei 62 % lag und dass von den langzeitüberlebenden Patienten 96 % keine Immunsuppression mehr benötigten bzw. auch keine GvHD mehr hatten. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass bei Patienten mit dringlicher Transplantindikation ohne verfügbaren Spender so rasch wie möglich eine haploidente Stammzelltransplantation (z.B. mit einem Kind als Spender) durchgeführt werden sollte.</p> <h2>Autologe SZT bei AML – eine Option als Konsolidierung bei Intermediate-Risk-AML in erster Remission?</h2> <p>Gorin et al. präsentierten interessante Ergebnisse der ALWP der EBMT, die die Option einer konsolidierenden autologen SZT bei Intermediate-Risk-AML mit FLT3- Negativität unterstreichen. Das Langzeitüberleben von 2600 Patienten mit AML ohne passenden Familienspender wurde retrospektiv analysiert. Bei den Intermediate- Risk-Patienten, die FLT3-negativ waren, war das Überleben bei Patienten nach autologer SZT vergleichbar mit den Ergebnissen bei Patienten, die mit einem passenden unverwandten Spender transplantiert wurden (5-Jahres-OS von jeweils 72 % ). Bei unverwandten Spendern mit einem „HLA mismatch“ war das Überleben der Patienten im Vergleich zur autologen Stammzelltransplantation sogar schlechter. Die RIC allogen transplantierten Patienten hatten ein gleiches leukämiefreies Überleben wie die myeloablativ autolog transplantierten Patienten. Bei Hochrisiko- AML-Patienten war, wie zu erwarten, die autologe SZT der unverwandten SZT klar unterlegen.<br /> Ältere Patienten oder Patienten mit einem höheren Komorbiditätsscore, die an einer Intermediate-Risk-Leukämie erkranken, könnten daher von einer konsolidierenden ASZT profitieren. Das Konditionierungsschema mit i.v. Busulfan/Melphalan scheint dabei der Busulfan/Cyclophosphamid- Kombination überlegen zu sein. Ein Update beim ASH 2017 von Gorin<sup>4</sup> zeigte, dass das Rezidivrisiko bei Hochrisikopatienten, die mit Bu/Cy konditioniert worden waren, bei 70 % lag, während Patienten, die mit Bu/Mel transplantiert wurden, zu 53 % rezidivierten. Wenn man sich für eine ASZT als Konsolidierung bei AML entscheidet, sollte als Konditionierung also Bu/Mel gewählt werden.</p> <h2>Wie ist die Lebensqualität von Patienten in Langzeitremission nach allogener Stammzelltransplantation?</h2> <p>Bereits beim ASH 2016 wurden Langzeitergebnisse bezüglich des funktionellen Status und der Lebensqualität von Patienten nach allogener Stammzelltransplantation präsentiert.<sup>5</sup> Bei 1000 Patienten, die in Langzeitremission waren, wurden funktioneller Status, Muskelmasse, Grundumsatz, Gehgeschwindigkeit und Muskelkraft erhoben. Ca. 10 % der Patienten mit Langzeitüberleben nach allogener Stammzelltransplantation waren funktionell schwer beeinträchtigt und in der Lebensqualität deutlich eingeschränkt. Das Risiko für eine vorzeitige Vergreisung war bei langzeitüberlebenden Patienten 10-mal höher als bei den vergleichbaren gesunden Geschwisterspendern. Besonders TBI in der Konditionierung sowie Entwicklung einer GvHD waren signifikante Risikofaktoren für eine frühzeitige funktionelle Vergreisung (HR 5!). Verglichen mit Patienten nach ASZT war das Risiko für eine Vergreisung bei allogener Geschwisterstammzelltransplantation 3-fach und bei Transplantierten mit unverwandten Spendern 6-fach erhöht.<br /> Diese Daten sollten im klinischen Alltag beim Vergleich zwischen allogener und autologer Stammzelltransplantation zusätzlich zur „transplant-related mortality“ in Betracht gezogen werden.</p> <h2>ASZT und Myelom</h2> <p>Im Rahmen des ASH-Meetings wurden beeindruckende MRD-Ergebnisse nach ASZT kombiniert mit effizienter Tripeltherapie in der Induktion und Konsolidierung sowie ein Update der EMN02-Studie gezeigt, aber gibt es auch verbesserte Ergebnisse durch Bu/Mel in der ASZT bei MM?<br /> In der Studie GEM2012 (Abb. 1) wurden Patienten entweder mit Melphalan oder Bu/Mel konditioniert und jeweils vor und nach der autologen Transplantation sowie nach Ende einer zweimaligen VRDKonsolidierung wurden MRD-Daten erhoben.<sup>6</sup> Hierbei zeigte sich, dass die MRDNegativität nach der Konsolidierung bei 50 % der Patienten erreicht wurde (Abb. 2). Des Weiteren waren bei den MRD-positiven Patienten 23 % unter MRD von 10<sup>–4</sup>. Das progressionsfreie Überleben bei den MRD-negativen Patienten war eindrucksvoll (Abb. 3). In seltenen Fällen kann selbst bei MRD-Negativität ein extramedullärer Befall vorliegen. Hier empfiehlt es sich, ein PET-CT durchzuführen, sodass wahrscheinlich in Zukunft sowohl die MRD-Negativität als auch das bildgebende PET-Assessment ihren Stellenwert haben werden. Ob Patienten, die nach einer modernen Induktionstherapie, ASZT und Konsolidierung MRD- (unter 1x 10<sup>–5</sup>) und PET-negativ sind, überhaupt von einer Erhaltungstherapie profitierten, sollte noch in randomisierten Studien untersucht werden.<br /> Die Qualität der Remissionen, die durch moderne Therapien, eventuell auch mit Bu/Mel als Konditionierung in der autologen Stammzelltransplantation erzielt werden, ist nicht vergleichbar mit den historischen Studien, die in der Metaanalyse bezüglich eines Benefits von Lenalidomid- Erhaltung evaluiert wurden.<br /> Am MD Anderson Cancer Center<sup>7</sup> schnitt in einer randomisierten Studie die Konditionierung mit Bu/Mel im Vergleich zu Melphalan alleine (der goldene Standard bei der autologen Stammzelltransplantation) signifikant besser ab (Abb. 4). Das PFS war signifikant verlängert und besonders bei den Patienten mit ungünstiger Zytogenetik waren die Ergebnisse eindrucksvoll (Abb. 5) Die gefürchteten schweren Lebertoxizitäten waren mit dem i.v. Busulfan nicht beobachtbar, die Dysphagie lag etwas höher und die Transaminasenauslenkung war ebenfalls im Vergleich zu Melphalan erhöht, allerdings waren sonst keine signifikanten Auffälligkeiten bemerkbar.<br /> Zusammenfassend lässt sich sagen, dass zumindest bei Hochrisikopatienten künftig eine Bu/Mel-Konditionierung zu diskutieren ist.<br /> Ein Update der EMN02-Studie von Michele Cavo<sup>8</sup> bestätigte den Benefit der autologen Stammzelltransplantation im Vergleich zur konventionellen Chemotherapie in der Erstlinientherapie, Patienten wurden nach VCD-Induktion randomisiert und entweder mit VMP (4 Zyklen) weiterbehandelt oder mit einer autologen Stammzelltransplantation konsolidiert. In weiterer Folge erhielten die Patienten ohne Transplant eine effiziente Konsolidierung mit VRD, währenddessen im Hochdosisarm keine Konsolidierung durchgeführt wurde. Das „overall survival“ war in der Hochrisikogruppe und im Stadium 3 signifikant verlängert, weiters war das progressionsfreie Überleben deutlich länger. Die Tandem-Transplantation verbesserte ebenfalls das progressionsfreie Überleben bei Hochrisikopatienten.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Onko_1801_Weblinks_s38_abb1.jpg" alt="" width="1457" height="639" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Onko_1801_Weblinks_s38_abb2.jpg" alt="" width="1455" height="764" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Onko_1801_Weblinks_s38_abb3.jpg" alt="" width="1454" height="815" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Onko_1801_Weblinks_s38_abb4.jpg" alt="" width="1458" height="1064" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Onko_1801_Weblinks_s38_abb5.jpg" alt="" width="1457" height="968" /></p> <h2>ASZT und Lymphome</h2> <p>Bei den Lymphomen spielt die autologe Transplantation weiterhin als Rezidivtherapie eine zentrale Rolle. Die autologe SZT ist die einzige Therapie, welche in zweiter CR beim follikulären Lymphom Langzeitüberleben in Remission ermöglicht. Besonders Patienten, die innerhalb von zwei Jahren rezidivieren, müssen standardmäßig einer autologen Stammzelltransplantation unterzogen werden. Diese verbessert das Überleben dieser Patienten, gezeigt mit Real-World-Daten bei 397 Patienten, die mit R-Chemo behandelt wurden.<sup>9</sup> Jene Patienten, die konsolidierend eine Stammzelltransplantation erhielten, erreichten ein deutlich besseres Überleben (Abb. 6). Allerdings gibt es zu dieser Fragestellung keine randomisierten Studien.<br /> Bereits beim ASH 2016 konnte von Vindi Jurinovic<sup>10</sup> gezeigt werden, dass Patienten mit POD24 und neuerlicher Remission durch konventionelle Chemotherapie ein signifikant längeres Überleben haben, wenn sie in Remission konsolidierend autolog transplantiert werden.<br /> Weiterhin problematisch und unklar ist die Frage, wie Patienten mit „diffuse large B-Cell lymphoma“ (DLBCL) behandelt werden sollen, die eine ungünstige genetische Signatur haben. Neben der bekannten „Cell of origin“-Typisierung (oder GCBLymphomen) zeigt sich wiederum, dass besonders Patienten mit Hochrisikosignaturen wie BCL-2- und MYC-Expression an der Zelloberfläche sowie den klassischen Double-Hit-Lymphomen ein extrem schlechtes Überleben nach konventioneller Rituximab-CHOP-Therapie haben.<sup>11</sup> Frühzeitige Intensivierung mit Chemotherapie bei Hochrisikopatienten ist weiterhin eine Option, obwohl es dazu keine Daten aus randomisierten Studien gibt.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Onko_1801_Weblinks_s38_abb6.jpg" alt="" width="1459" height="830" /></p> <h2>Wie sollen wir adipöse Patienten therapieren? Gibt es Ernährungsstandards in der SZT?</h2> <p>Über die CIBNTR wurden 1700 Patienten mit multiplem Myelom und 781 mit Lymphomen analysiert, die einen BMI von ≥30kg/m<sup>2</sup> hatten.<sup>12</sup> Hierbei zeigte sich, dass Patienten, die ihrem Gewicht entsprechend volldosiert therapiert wurden, ein besseres progressionsfreies Überleben hatten. Umgekehrt war die Mortalität bei den Patienten, die eine gewichtsadaptierte Therapie erhalten hatten, nicht höher. Dies bedeutet, dass es nicht sinnvoll scheint, die Dosis der myeloablativen Chemotherapie bei adipösen Patienten zu reduzieren.<br /> Eine sehr essenzielle Fragestellung bezüglich der Ernährungsstandards wurde in 91 EBMT-Zentren analysiert,<sup>13</sup> die Auswertung durfte erstaunlicherweise nur in der Posterhalle präsentiert werden: 40 % der Transplant-Zentren führen kein Screening auf Ernährungsstandards durch, während 93 % eine keimarme, gekochte Kost verabreichen. Für beide Standards gibt es keine valide Evidenz. Während Mangelernährung ein relevanter prognostischer Faktor ist (dieser wurde nicht konsequent evaluiert),<sup>14</sup> gibt es wenige Daten, die belegen, dass eine keimarme, gekochte Ernährung einen Vorteil für transplantierte Patienten bringt. Es konnte zumindest bei Patienten mit akuter myeloischer Leukämie in einer randomisierten Studie<sup>15</sup> belegt werden, dass gekochtes Essen für die Patienten keinen Vorteil bezüglich OS brachte und die Rate der Infektionen bei den Patienten, die ausschließlich gekochte Nahrung erhielten, sogar höher war.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Lorentino F et al.: Haploidentical t-repleted stem cell transplantation (sct) has comparable survival to 10/10 and 9/10 unrelated SCT in poor-cytogenetics risk acute myeloid leukemia in first complete remission: a study on behalf of the Acute Leukemia Working Party (ALWP) of the European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). Blood 2017; 130(Suppl 1): 852. Accessed February 11, 2018 <strong>2</strong> Fatobene G et al.: Comparison of chronic graft-versushost disease severity and functional status after cord blood, haploidentical related and 1-allele mismatched unrelated donor hematopoietic cell transplantation. Blood 2017; 130(Suppl 1): 73. Accessed February 11, 2018. http://www. bloodjournal.org/content/130/Suppl_1/73 <strong>3</strong> Granata A e t al.: GvHD after PBSC-haploidentical stem cell transplantation (haplo-SCT) with post transplantation-cyclophosphamide (PT-Cy). Blood 2017; 130(Suppl 1): 1984. Accessed February 11, 2018 <strong>4</strong> Gorin NC et al.: Optimizing the pretransplant regimen for autologous stem cell transplantation in acute myelogenous leukemia: better outcomes with busulfan and melphalan compared with busulfan and cyclophosphamide in high risk patients autografted in first complete remission. 2017; 130(Suppl 1): 338. Accessed February 11, 2018. http://www.bloodjournal.org/content /130/ Suppl_1/338 <strong>5</strong> Arora M et al.: Physiologic frailty among hematopoietic cell transplantation (HCT) survivors suggests accelerated aging and is a predictor for premature mortality: a report from the Bone Marrow Transplant Survivor Study (BMTSS). Blood 2015; 126(23): 739. Accessed February 11, 2018. http://www.bloodjournal.org/content/ 126/23/739 <strong>6</strong> Paiva B et al.: ASH 2017; Abstract 2017 <strong>7</strong> Qazilbash MH et al.: A randomized phase III trial of busulfan + melphalan vs melphalan alone for multiple myeloma. Blood 2017; 130(Suppl 1): 399. Accessed February 11, 2018. http://www.bloodjournal.org/content/130/Suppl_1/399 <strong>8</strong> Cavo M et al.: Autologous stem cell transplantation versus bortezomib-melphalan-prednisone for newly diagnosed multiple myeloma: second interim analysis of the phase 3 EMN02/HO95 Study. Blood 2017; 130(Suppl 1): 397. Accessed February 11, 2018. http://www.bloodjournal.org/ content/130/Suppl_1/397 <strong>9</strong> Manna M et al.: Autologous transplantation improves survival rates for follicular lymphoma patients who relapse within 2-years of chemoimmunotherapy: a multi-centre retrospective analysis of consecutively treated patients in the real world. Blood 2017; 130(Suppl 1): 3298. Accessed February 11, 2018. http:// www.bloodjournal.org/content/130/Suppl_1/3298 <strong>10</strong> Jurinovic V.: Blood 2016; 128: 3464 <strong>11</strong> Melle F et al.: Molecular definition of activated B cell-like (ABC) DLBCL identifies patients who may benefit from front-line intensive R-HDS Chemotherapy with ASCT. Blood 2017; 130(Suppl 1): 3998. Accessed February 11, 2018. http://www.bloodjournal.org/ content/130/Suppl_1/3998 <strong>12</strong> Brunstein CG et al.: The effect of conditioning regimen dose reduction in obese patients undergoing autologous transplantation. Blood 2017; 130(Suppl 1): 3292. Accessed February 11, 2018. http:// www.bloodjournal.org/content/130/Suppl_1/3292 <strong>13</strong> Peric Z et al.: Variability of nutritional practices in peritransplant period after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: a survey by the Complications and Quality of Life Working Party of the EBMT. Blood 2017; 130(Suppl 1): 1954. Accessed February 11, 2018. http://www.bloodjournal.org/ content/130/Suppl_1/1954 <strong>14</strong> Deeg HJ et al.: Bone Marrow Transplant 1995; 15: 461-8 <strong>15</strong> Gardner A et al.: J Clin Oncol 2008; 26: 5684-8</p>
</div>
</p>