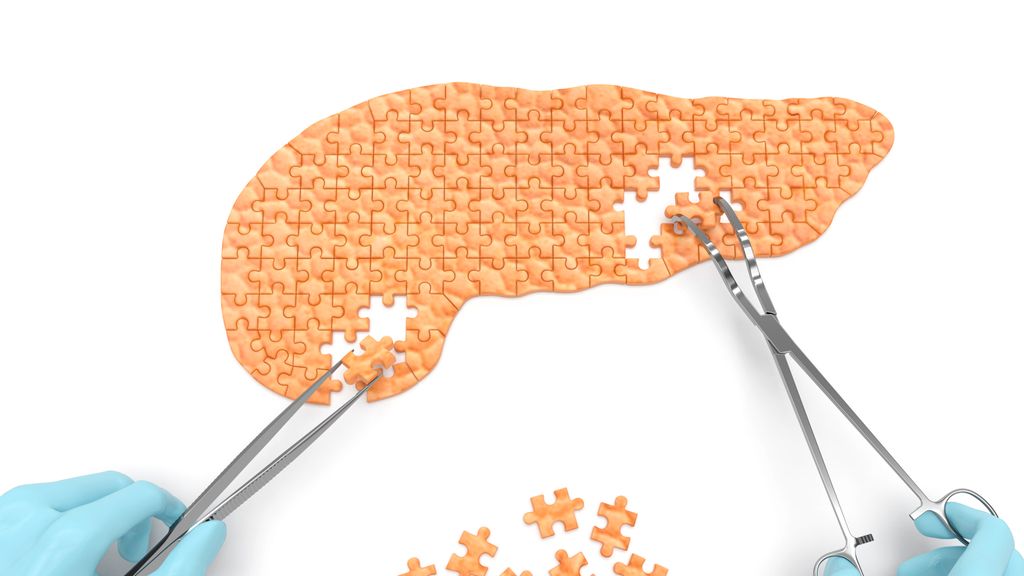
Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse mit Schwerpunkt Pankreaskarzinom und Vorstufen
Autor:
Univ.-Prof. Dr. Martin Schindl
Universitätsklinik für Allgemeinchirurgie
Klinische Abteilung für Viszeralchirurgie
Medizinische Universität Wien
E-Mail: martin.schindl@meduniwien.ac.at
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Am Pankreastag 2021 wurden zahlreiche aktuelle Themen zu Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse diskutiert – mit Schwerpunkt auf dem Pankreaskarzinom und Vorstufen und in einen nationalen Kontext gebracht.
Epidemiologie und Versorgung von Patienten mit Pankreaserkrankungen (Karzinom) in Österreich
DI Dr. Gerhard Fülöp (Gesundheit Österreich GmbH) und Assoc.-Prof. Priv.-Doz.Dr. Klaus Sahora (Medizinische Universität Wien) zeigten im Vortrag zu Epidemiologie und Versorgung von Patienten mit Pankreaserkrankungen (Karzinom) in Österreich, dass es in Österreich wie in vielen anderen Industrieländern in der Pankreaschirurgie einen eindeutigen Trend zur chirurgischen Behandlung in spezialisierten Zentren gibt. Pankreaschirurgie wird in Österreich immer häufiger an Abteilungen mit 10–39 Eingriffen pro Jahr („intermediate volume“) und 40 und mehr Eingriffen pro Jahr („high volume“) gemacht. Besonders in High-Volume-Zentren ist die perioperative Sterblichkeit nach Pankreasoperation geringer und die Überlebensprognose insgesamt besser als in Low-Volume-Zentren, die perioperative Sterblichkeit hat im Beobachtungszeitraum 2015–2020 auch insgesamt abgenommen. Die Daten unterstreichen, dass Spezialisierung und Zentrumsbildung in der Pankreaschirurgie eine Verbesserung in der Behandlungsqualität bringen.
Moderne radiologische Diagnostik an der Bauchspeicheldrüse
Prim. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Schima, Leiter der Radiologie in den Krankenhäusern der Vinzenzgruppe in Wien, gab einen Überblick über moderne radiologische Diagnostik an der Bauchspeicheldrüse einschließlich hybrider Bildgebung. Bei Verdacht auf Pankreaskarzinom ist die kontrastmittelverstärkte Multidetector-Computertomografie (MDCT) die Untersuchung der ersten Wahl zur Diagnose und Beurteilung der Resektabilität sowie zur Erkennung eventueller Metastasierung. Dabei ist eine neue Technik in Form des „Dual Energy“-CT hinzugekommen, welche monochromatische virtuelle Bilder aus Untersuchungen mit unterschiedlicher (niedriger) Spannung (kV) anfertigt und dabei einen höheren Kontrast zwischen Tumor und umgebendem Gewebe erzielt. Zusätzlich rät der Experte, bei Verdacht auf Lebermetastasen als ergänzende Untersuchung jedenfalls eine kontrastmittelverstärkte Magnetresonanztomografie (MRT) durchzuführen, weil diese Methode wesentlich sensitiver und spezifischer für die Beurteilung der Leber ist. Im Grunde wäre die Kombination von MDCT (Thorax und Abdomen) gemeinsam mit einem KM-MRT der Leber als umfassendes Staging bei allen Patienten mit primär resektablem Pankreaskarzinom in Betracht zu ziehen. Nach neoadjuvanter Therapie eines primär nicht resektablen Tumors ist die sichere Beurteilung des Therapieansprechens, konkret die Unterscheidung zwischen Narbengewebe und vitalem Tumorgewebe, durch radiologische Methoden nicht möglich. Daher sollte jedenfalls der Versuch einer Resektion unternommen werden, wenn radiologisch durch die Behandlung eine Stabilisierung der Erkrankung erreicht wurde und keine Metastasen vorliegen.
Zur Diagnose und Verlaufskontrolle von intraduktalen papillären muzinösen Neoplasien (IPMN) in der Bauchspeicheldrüse eignen sich sowohl MDCT wie auch KM-MRT. Dabei ist es wichtig, die Veränderungen anhand der Zystengröße, des Durchmessers des Pankreasganges und solider Knoten in der Zystenwand auf verdächtige Zeichen („worrisome features“ und High-Risk-Stigmata), zur beurteilen und daraufhin die individuelle Gefährlichkeit und notwendige Behandlung festzulegen.
Endoskopische Diagnostik
Univ. Prof. Dr. Maximilian Schöniger-Hekele von der Universitätsklinik für Innere Medizin 3 der Medizinischen Universität Wien wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die endoskopische Diagnostik mittels Endosonografie (EUS) besonders wichtig bei der detaillierten Abklärung zystischer Veränderungen in der Bauchspeicheldrüse ist. Diese Untersuchungsmethode erlaubt mit hochauflösendem Ultraschall das Bauchspeicheldrüsengewebe aus nächster Nähe zu beurteilen sowie mittels Nadelbiopsie Flüssigkeit aus der Zyste abzusaugen und auf Amylase- und CEA-Konzentration sowie Muzingehalt zu untersuchen. Diese Befunde erlauben es, zwischen den verschiedenen Differenzialdiagnosen – Pseudozyste, seröse zystische Neoplasie, muzinöse zystische Neoplasie, intraduktale papilläre muzinöse Neoplasien (IPMN) und solide pseudopapilläre Neoplasie – zu unterscheiden. Auch für die histologische Abklärung solider Raumforderungen im Pankreas ist die EUS aufgrund der Möglichkeit der ultraschallgezielten Biopsie sehr wichtig, und es wurde in den vergangenen Jahren verschiedene Biopsienadeln entwickelt, mit denen durch ein besonderes Design der Nadelspitze eine repräsentative Gewebeprobe verlässlicher als bisher gewonnen werden kann. Der Experte betont aber, dass bei einer radiologisch (CT, MRT) krebsverdächtigen Raumforderung in der Bauchspeicheldrüse, welche lokal begrenzt ist und primär resektabel und ohne Hinweis auf Metastasierung erscheint, keine Biopsie zur Diagnosesicherung erforderlich ist, sondern gleich die Operation durchgeführt werden sollte. Anders ist die Situation bei radiomorphologisch nicht resektablen Erkrankungen, bei denen eine neoadjuvante Behandlung notwendig ist und es davor unbedingt einer histologischen Diagnosesicherung bedarf. Die relative neue Technik der direkten endoskopischen Untersuchung des Pankreasganges mittels flexibler Endoskopie erlaubt es, den Befall von Haupt- und Seitengängen durch IPMN unmittelbar darzustellen und Gewebeproben zu entnehmen.
Update zu Pankreaszysten und anderen Krebsvorstufen
Assoc.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Klaus Sahora von der Universitätsklinik für Allgemeinchirurgie der Medizinischen Universität Wien zeigte in einem Update zu Pankreaszysten und anderen Krebsvorstufen, dass das Risiko für Bauchspeicheldrüsenkrebs bei Patienten mit Pankreaszysten nach 10 Jahren zwischen 1,7 und 2,4% liegt, und betonte in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit einer Erhebeung des individuellen Risikos in Bezug auf verdächtige Zeichen in den zystischen Veränderungen (Erweiterung des Hauptganges, wandständige Knoten, Zystengröße bzw. Wachstumstendenz und Tumormarker CA19.9). Derzeit gibt es weltweit zahlreiche Projekte, die den Stellenwert der detaillierten Analyse der Zystenflüssigkeit auf verschiedene Proteine untersuchen, um eine verlässlichere Vorhersage des weiteren Verlaufs, insbesondere des Auftretens von Krebsvorstufen, erlauben. Aktuell wird bei Vorliegen von IPMN eine lebenslange Kontrolle für Patienten mit und ohne Resektion empfohlen, weil bei IPMN auch nach 10 Jahren ein erhöhtes Risiko für das Auftreten eines Pankreaskarzinoms in der (Rest-)Bauchspeicheldrüse besteht.
Diagnostik und Therapie von seltenen Pankreastumoren
Prim. Univ.-Doz. Dr. Stefan Stättner von den Salzkammergut Kliniken, Standort Vöcklabruck, gab in seinem Vortrag zu Diagnostik und Therapie seltener Pankreastumoren zu bedenken, dass das Risiko für perioperative Komplikationen, insbesondere das Auftreten von Pankreasfisteln bei neuroendokrinen Tumoren des Pankreas (PNET), sehr hoch ist und daher die Operationsindikation für diese Tumorentität individuell sehr genau bestimmt werden muss. Tumoren unter 2cm Durchmesser und mit hoher Differenzierung (G1) bzw. niedrigem Mitose-Index (Ki-67 <3%) weisen nach aktueller Evidenz eine geringe Gefährlichkeit auf und müssen nicht chirurgisch entfernt werden, andererseits kann beim niedrig differenzierten neuroendokrinen Karzinom (NEC) mit hoher Proliferationsrate die chirurgische Behandlung keinen Überlebensvorteil erzielen. Besonders wichtig ist eine interdisziplinäre, multimodale Behandlung von PNET im Stadium II–IV und G3. Prof Raderer von der Universitätsklinik für Innere Medizin 1 der medizinischen Universität Wien ergänzte dazu, dass bei PNET bzw. NEC die systemische (Chemo-)Therapie eigentlich nur für palliative Therapiekonzepte angewandt wird. Dazu zählen Everolimus, Sunitinib, Temozolomid + Capecitabin sowie Streptozotocin. Vielversprechende Behandlungsmöglichkeiten könnten zukünftig durch die Peptid-Rezeptor-Radio-Therapie (PRRT) realisiert werden. Dabei wird eine radioaktiv wirksame Substanz (Lutetium oder Yttrium; β-Strahlung) mit einem künstlich hergestellten Eiweißmolekül kombiniert, welches selektiv an Somatostatinrezeptoren der Tumorzellen bindet und diese bestrahlt. Wurde dieses Konzept zunächst ausschließlich bei metastasierten, inoperablen Stadien eingesetzt, gibt es aktuelle Bestrebungen, PRRT auch für die neoadjuvante Therapie mit anschließender Resektion anzuwenden.
Update zur Chirurgie bei Pankreaskarzinom
Prim. Univ.-Prof. Dr. Reinhold Függer, Leiter der chirurgischen Abteilungen der Krankenhäuser der Elisabethinnen und Barmherzigen Schwestern in Linz, betonte in einem Update zur Chirurgie bei Pankreaskarzinom, dass der perioperative Behandlungserfolg wesentlich von dem Auftreten klinisch relevanter Pankreasfisteln nach der Operation (POPF) beeinflusst wird und daher Maßnahmen zur Vorbeugung und Behandlung von POPF von besonderer Bedeutung sind. Die Ergebnisse einer aktuellen Analyse aus Verona zeigen, dass bei einem hohen Fistelrisiko nach Pankreaskopfresektion die totale Pankreatektomie (TP) zu signifikant weniger postoperativen Komplikationen führt als eine Risikoanastomose zwischen dem Restpankreas und dem Dünndarm, andererseits aber nach TP die Lebensqualität durch die Notwendigkeit einer dauerhaften und kompletten Unterstützung der exokrinen und endokrinen Pankreasfunktion sowie die mitunter schwierige Einstellung des Diabetes signifikant beeinträchtigt ist.1 Das bedeutet, dass die TP nicht prinzipiell bei einem erhöhten Fistelrisiko gewählt werden sollte, sondern dem Erhalt des Restpankreas mit Anastomose der Vorzug zu geben ist. Im zweiten Teil seines Vortrages analysierte Prof. Függer die Ergebnisse einer multizentrischen Studie aus den Niederlanden zur neoadjuvanten Therapie von primär resektablen bzw. borderline-resektablen Pankreaskarzinom.2 Dabei zeigte sich, dass Patienten nach neoadjuvanter Chemoradiatio signifikant häufiger eine radikale (R0) Resektion und ein längeres erkrankungsfreies Überleben hatten, bei insgesamt geringerer Rate an Resektionen insgesamt. Weiters zeigte der Experte anhand einer Studie an PatientInnen mit Pankreaskarzinom, neoadjuvanter Therapie und Gefäßresektion, dass die Höhe des Tumormarkers CA-19.9 bei Diagnosestellung bzw. vor der Operation nach neoadjuvanter Therapie ein signifikanter Prognosefaktor ist.3
Minimal invasive und roboter-chirurgische Operationsmethoden am Pankreas
Univ.-Prof. Dr. Oliver Strobel, Leiter der Universitätsklinik für Allgemeinchirurgie an der Medizinischen Universität in Wien, gab in einem Vortrag über minimal invasive und roboterchirurgische Operationsmethoden am Pankreas zu bedenken, dass bei der Pankreaskopfresektion das Durchschreiten einer langen Lernkurve von 50–70 Fällen erforderlich ist, bis diese komplexe Operation minimal invasiv mit entsprechender Sicherheit durchgeführt werden kann. Obwohl für die minimal invasiven Methoden perioperative Vorteile durch geringere Schmerzen und raschere Erholung im Vergleich zur offenen Technik bestehen, sind Ergebnisse zu Eingriff-spezifischen Komplikationen (Blutung, Fistel) und damit die Sicherheit dieses Vorgehens noch nicht überzeugend. Bei der Pankreaslinksresektion hingegen sind die Vorteile minimal invasiver Methoden in Bezug auf raschere Erholung und geringere Liegedauer signifikant, bei vergleichbarer Sicherheit. Der Einsatz einer Roboter-unterstützten Technik im Vergleich zur laparoskopischen Operationsmethode ist bei dieser Art von Resektion selten erforderlich. Weiterhin müssen die onkologische Sicherheit, Radikalität und Rezidivrate sämtlicher minimal invasiver Operationsmethoden am Pankreas im Vergleich zur offenen Technik noch bewiesen werden.
Strahlentherapie beim Pankreaskarzinom
Im Vortrag zu Strahlentherapie, einschließlich Protonenbestrahlung, beim Pankreaskarzinom unterstrich Univ.-Prof. Dr. Joachim Widder, Leiter der Universitätsklinik für Strahlentherapie und des Comprehensive Cancer Centers, Wien, dass eine präoperative Radiotherapie sowohl das Gesamt- wie auch das erkrankungsfreie Überleben verlängert und die lokale Erkrankungskontrolle verbessert. In mehreren Studien war der Nutzen einer präoperativen Bestrahlung bei borderline-resektablen Tumoren zwar deutlicher ausgeprägt, aber nicht signifikant anders als bei resektablen Tumoren. Die lokal komplette Tumorentfernung (R0) zeigte sich als wesentlicher prognostischer Faktor und die Wahrscheinlichkeit einer R0-Resektion wird durch neoadjuvante Bestrahlung erhöht. Interessant ist, dass eine „Low dose“-Bestrahlung (37,2Gy) ausreichend für den positiven Effekt dieser Behandlung im Rahmen der neoadjuvanten Therapie zu sein scheint, hingegen bei lokal fortgeschrittenen, nicht resektablen Tumoren eine höhere Strahlendosis vermutlich vorteilhafter ist. Dazu ergänzt Priv.-Doz. Dr. Petra Georg vom MedAustron Ionentherapiezentrum, Wiener Neustadt, dass die Bestrahlung mit Protonen und Kohlenstoffionen Vorteile durch das scharf gegenüber der Umgebung abgegrenzten Bestrahlungsfeld hat, bei dem gesundes Gewebe davor und dahinter weitgehend von Schäden durch Bestrahlung verschont bleibt. Das ist bei der Bestrahlung der Bauchspeicheldrüse besonders wichtig, weil dieses Organ von empfindlichem Gewebe umgeben ist. Die Verwendung von Kohlenstoffionen zur Bestrahlung scheint einen zusätzlichen biologischen Vorteil zu haben, weil damit die Zerstörung der Tumorzell-DNA wesentlich ausgeprägter ist als bei Photonen und Protonen. Die Indikationen zur Partikelbestrahlung unterscheiden sich nicht von jenen zur Bestrahlung generell, also zur Verbesserung der R0-Resektionsrate bei borderline-resektablen Tumoren und der Konversion zur Resektabilität bei lokal fortgeschrittenen, nicht resektablen Tumoren.
Therapiesequenz beim Pankreaskarzinom
Asoc.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Gerald Prager von der Universitätsklinik für Innere Medizin 1 der Medizinischen Universität Wien betonte in seinem Vortrag über Therapiesequenz beim Pankreaskarzinom, „Wann neoadjuvant behandeln, wann primär operieren und adjuvant therapieren“, dass gegenwärtig mehr Patienten mit Pankreaskarzinom in den verschiedenen Stadien – resektabel, lokal fortgeschritten, nicht resektabel und metastasiert – denn je behandelt werden und die Ergebnisse der modernen multimodalen, interdisziplinären Therapie signifikant besser sind als in der Vergangenheit. Die neoadjuvante Therapie bei Patienten mit primär resektablem Pankreaskarzinom ist bislang nicht etabliert, sondern Gegenstand zahlreicher Studien. Derzeit sind für dieses Erkrankungsstadium die primäre Resektion und eine anschließende adjuvante (Chemo-)Therapie der Standard. Es hat sich kein einzelnes neoadjuvantes Konzept als signifikant besser erwiesen: Beide Chemotherapeutika-Kombinationen, FOLFIRINOX und Gemcitabin/Abraxan, sind hinsichtlich des Überlebens und der Möglichkeit zur Konversion auf Resektabilität vergleichbar. Auch die zusätzliche Radiatio hat in multimodalen Behandlungskonzepten zusammen mit Chemotherapeutika-Kombinationen einen Stellenwert, wenngleich dazu noch keine Favorisierung für das eine oder andere ausgesprochen werden kann. In Österreich läuft aktuell dazu eine multizentrische Studie, in welcher Patienten mit lokal fortgeschrittenem Pankreaskarzinom neoadjuvant entweder mit FOLFIRINOX-Kombinations-Chemotherapie alleine oder sequenziell kombiniert mit Radiochemotherapie behandelt werden und die Konversionsrate zu R0-Resektabilität, Rezidivrate und Überleben untersucht werden (P02-Studie).
Ernährung und Enzymersatz
Ass. Prof. Dr. Irene Kührer, onkologische Internistin an der Universitätsklinik für Allgemeinchirurgie der Medizinischen Universität Wien, wies in Bezug auf Ernährung und Enzymersatz bei Karzinom, Entzündung und perioperativ auf die Bedeutung einer adäquaten medikamentösen Substitution der exokrinen Pankreasfunktion in Form von Enzymen hin. Weiters ist die regelmäßige Überwachung des Ernährungszustandes wichtig, um Mangelernährung rechtzeitig zu entdecken und zu behandeln. Die Ernährung sollte energie- und eiweißreich sein und eine adäquate Fettmenge, je nach individueller Verträglichkeit, enthalten. Hochkalorische eiweißreiche Trinknahrungen liefern die erforderlichen Nährstoffe. Darüber hinaus ist bei Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse, Entzündung oder Karzinom sowie postoperativ eine fortlaufende Kontrolle des Blutzuckers wichtig, wobei der Blutzuckerspiegel nicht über 144mg/dl liegen sollte.
Bewegungstherapie
Univ.-Prof. Richard Crevenna, Leiter der Universitätsklinik für Physikalische Medizin, Rehabilitation und Arbeitsmedizin, Wien, betont in seinem Vortrag über Bewegungstherapie im Verlauf der Erkrankung die Wichtigkeit von allgemeiner körperlicher Aktivität und gezieltem körperlichem Training in der onkologischen Rehabilitation. Einem aktuellen Trend folgend verlagert sich die therapeutische Intervention bereits in die erste Phase der Behandlung, beginnend mit der Diagnosestellung und während der neoadjuvanten Behandlung, um so früh wie möglich damit zu beginnen, die körperliche Fitness zu erhalten bzw. zu verbessern. Dieses Konzept wird als onkologische Prähabilitation bezeichnet. Laut Prof. Crevenna kann (fast) jeder Patient sicher trainieren, es bedarf dazu eines individuell angepassten Trainingsplan und einer regelmäßigen Überprüfung des körperlichen Zustandes. Interessant sind in diesem Zusammengang telemedizinische Ansätze, also Telerehabilitation, wobei die Patienten speziell ausgewählte und angeleitete Übungen online über QR-Codes abrufen und das Training dokumentieren können. Therapieziele der onkologischen Prä-/Rehabilitation sind eine Verbesserung der Überlebensprognose und Lebensqualität, die Förderung der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und die Steigerung von Selbstvertrauen und Selbstbestimmung.
Moderne Schmerztherapie
Zum Abschluss gab Univ.-Prof. Dr. Sabine Sator-Katzenschlager im Vortrag „Moderne Schmerztherapie bei Karzinom, Entzündung und perioperativ“ einen aktuellen Überblick über moderne Konzepte der Schmerztherapie. Dabei ist es wesentlich, zunächst die Diagnose und das Behandlungsziel der Schmerztherapie konkret mit den Patienten zu besprechen und daraufhin eine passende Behandlung so einfach und effizient wie möglich umzusetzen.
In der ersten Stufe des WHO-Stufenschemas zur Schmerzbehandlung (nichtopiat-hältige Medikament) nennt die Expertin Paracetamol und Metamizol, die sich für die postoperative Phase eignen. In der nächsten Stufe ist der sogenannte Würzburger Tropf, eine Kombinationstherapie bestehend aus Tramadol, Metamizol und Droperidol, als kontinuierliche Infusion mit indiviueller Anpassung zur postoperativen Schmerzkontrolle hervozuheben. Bei starken Schmerzen wird Morphinsulfat oder Hydromorphon intravenös oder epidural über eine Patienten-kontrollierte Schmerzpumpe verbreicht. Dabei wird die tägliche bzw. stündliche Gesamtdosis des Medikaments im Gerät vorab eingestellt und der Patient kann die Zeitpunkte der Bolusgabe selbst bestimmen. Bei unerträglichen Schmerzen durch Tumor oder Entzündung der Bauchspeicheldrüse ist auch eine gezielte Blockade des Nervengeflechts am Truncus coelicus möglich, die sogenannte Zöliakusblockade. Bei Tumorschmerzen ist die Verwendung von Cannabinoiden wie Dronabinol, Cannabidiol zusätzlich zu Opioiden möglich, aber keinesfalls an deren Stelle. In der erweiterten Schmerzbehandlung finden auch Antikonvulsiva und Antidepressiva wie Pregabalin und Gabapentin Verwendung, die auch bei Schmerzen durch Pankreaserkrankungen eingesetzt werden.
Quelle:
8. Österreichischer Pankreastag
11. September 2021, Wien
Literatur:
1 Marchegiani G et al.: High-risk pancreatic anastomosis vs. total pancreatectomy after pancreatoduodenectomy: Postoperative outcomes and quality of life analysis. Ann Surg 2021, doi: 10.1097/SLA.0000000000004840 2 Versteijne E et al.: Preoperative chemoradiotherapy versus immediate surgery for resectable and borderline resectable pancreatic cancer: Results of the Dutch randomized phase III PREOPANC trial. J Clin Oncol 2020; 38(16): 1763-73 3 Garnier J et al.: Pancreatectomy with vascular resection after neoadjuvant FOLFIRINOX: Who survives more than a year after surgery? Ann Surg Oncol 2021; 28(8): 4625-34
Das könnte Sie auch interessieren:
Highlights zu Lymphomen
Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1
ASH 2020 – Highlights zu den aggressiven Lymphomen
Highlight-Themen der virtuellen ASH-Jahrestagung im Dezember 2020 waren an erster Stelle die Immunonkologika in all ihren Variationen, aber auch Beispiele für innovative Sequenztherapien ...
Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten
Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...


