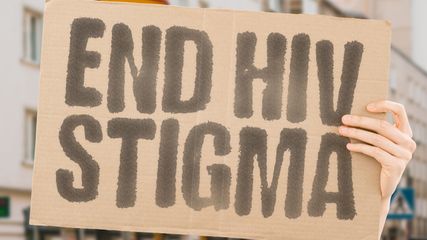Serologie: Grenzen einer Methode
Bericht:
Dr. Norbert Hasenöhrl
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Serologische Methoden haben auch heute noch ihren Platz in der Diagnostik. Man muss allerdings wissen, wann man sie sinnvoll einsetzen kann, und vor allem auch, wann nicht. Grundsätzlich gilt, dass eine Serologie ohne Zusammenschau mit der Klinik des Patienten niemals eine Therapie begründen sollte. Und sehr oft ist die Serologie auch nicht für eine Verlaufskontrolle geeignet, so Univ.-Prof. Dr. Petra Apfalter, Fachärztin für klinische Mikrobiologie aus Linz.
Keypoints
-
Serologie ist die Lehre von den Antigen-Antikörper-Reaktionen; in der klinischen Mikrobiologie ist damit eine Technik zum indirekten Erregernachweis gemeint.
-
Vorteile der serologischen Diagnostik: einfach, automatisierbar, rasche Befunderstellung, retrospektive Diagnosestellung.
-
Nachteile der serologischen Diagnostik: InadäquateIm- munreaktionen bzw. Kreuzreaktionen erschweren die Diagnostik bestimmter Erreger.
-
Prinzipiell müssen serologische Ergebnisse immer in Zusammenschau mit Klinik und Anamnese interpretiert werden.
-
Bei allen Titerbestimmungen ist zu beachten, dass dabei nur Informationen über die Antikörperbildung, nicht aber über die zelluläre Immunität gewonnen werden.
Wir sollten uns daran erinnern, was Serologie eigentlich bedeutet“, erklärte Prim. Univ.-Prof. Dr. Petra Apfalter, Leiterin des Instituts für Hygiene, Mikrobiologie und Tropenmedizin, Ordensklinikum Linz, und des Nationalen Referenzzentrums für antimikrobielle Resistenzen. „Es handelt sich dabei um die Lehre von den Antigen-Antikörper-Reaktionen, die nach einem Schlüssel-Schloss-Prinzip zusammenpassen.“
Grundbegriffe
Die Analogie von Schlüssel und Schloss ist allerdings eine zu starke Vereinfachung. Ein Antigen (Ag) ist in der Regel ein großes Molekül, das an seiner Oberfläche eine Reihe von Epitopen besitzt. Unter einem Epitop versteht man eine umschriebene, kleinere molekulare Struktur bzw. einen bestimmten Abschnitt eines Antigens, der alleine schon eine spezifische Immunantwort auslösen kann.
Ein Antikörper (Ak) kann nun komplementäre Strukturen für einen Teil der Epitope (partielle Komplementarität) oder für alle Epitope (vollständige Komplementarität) eines Ag besitzen. „Es kann auch sein, dass bestimmte Epitope unterschiedlicher Antigene gleich gut auf ein und denselben Antikörper passen – in diesem Fall spricht man von Kreuzreaktivität“, erklärte Apfalter.
Ein Antigen (bzw. seine Epitope) ist der Auslöser einer bestimmten Antwort des adaptiven Immunsystems und kann aus Proteinen, Lipiden oder Kohlenhydraten bestehen. Ein Antikörper bindet spezifisch an ein Ag, wobei es unterschiedliche Klassen gibt. IgA-Ak sind sekretorische Immunglobuline, wie sie an Schleimhäuten gebildet werden. IgM-Ak kommen vor allem in der Frühphase einer Infektion vor, IgG-Ak eher in der Spätphase; ihre Bedeutung liegt auch in der anhaltenden Immunität. IgE- und IgD-Ak haben – jedenfalls im Bereich der serologischen Diagnostik – eine geringe Bedeutung.
Serologie ist aber noch mehr. Vor allem in der klinischen Mikrobiologie ist damit eine Technik zum indirekten Erregernachweis gemeint, die Anwendung in der Bakteriologie, der Virologie, der Parasitologie und der Mykologie findet. Es kann sich dabei um den Nachweis von Antikörpern zur Infektionsdiagnostik oder zur Feststellung des Immunstatus handeln. „Dies ist allerdings nicht bei jedem Erreger möglich bzw. sinnvoll“, schränkte Apfalter ein. Die andere Möglichkeit ist der direkte (aber auch „serologische“ – weil Ak diagnostisch eingesetzt werden) Nachweis von Erregern oder Toxinen aus einer Probe (z.B. Pneumokokken-Ag aus dem Harn).
Serologie: Vor- und Nachteile
Vorteile der serologischen Diagnostik sind u.a. die Einfachheit von Probengewinnung und -transport und die automatisierbare Verarbeitung, was das rasche Abarbeiten vieler Proben ermöglicht und zu einer raschen Befunderstellung führt. Weiters ist oft eine sichere Diagnose von Erregern möglich, die sich nicht oder nur sehr schwer kultivieren lassen. Und die Ak-Bestimmung erlaubt in manchen Fällen auch eine retrospektive Diagnosestellung zu einem Zeitpunkt, wo der Betreffende bereits wieder symptomfrei ist. „In gewissen Fällen – allerdings bei Weitem nicht immer – lässt sich auch die Immunantwort auf Impfungen serologisch überprüfen“, so Apfalter.
Allerdings gibt es auch Nachteile. Inadäquate Immunreaktionen bzw. Kreuzreaktionen können die Diagnostik erschweren. Bestimmte Erreger (v.a. manche Parasiten und Bakterien) induzieren eine komplizierte Immunantwort gegen zahlreiche Antigene, was wiederum die Diagnostik erschwert. Kreuzreaktionen (z.B. zwischen verschiedenen Herpesviren) sind häufig. Ak-Titer sind meist nur im Verlauf sinnvoll interpretierbar. „Die Interpretation serologischer Ergebnisse ist oft schwierig bis unmöglich, vor allem in der Bakteriologie, besonders bei sehr geringer Vortestwahrscheinlichkeit“, warnte die Expertin. „Und wir sehen auch, dass bestimmte Tests gemacht werden, die eigentlich veraltet sind, aber von den Sozialversicherungsträgern weiterhin refundiert werden.“
Grundprinzipien und Anwendungen
„Prinzipiell müssen serologische Ergebnisse immer in Zusammenschau mit Klinik und Anamnese interpretiert werden. Dabei sind definierte, akzeptierte Falldefinitionen zu verwenden“, forderte Apfalter.
Die Beobachtung einer Serokonversion ist von Bedeutung, was natürlich nur möglich ist, wenn man mehrere Proben im zeitlichen Verlauf untersucht. Es gilt immer noch die Regel, dass ein Titeranstieg von IgG- oder Gesamt-Ak im Akut- sowie Rekonvaleszenzserum auf das Vierfache beweisend ist. Und auch die zeitliche Abfolge spielt eine Rolle: Es müssen zuerst IgM- und dann IgG-Ak auftreten.
Die Bestimmung eines Immunitätsstatus ist bei ausgewählten Erregern sinnvoll. Dazu gehören die Erreger von Diphtherie, Tetanus oder Virushepatitiden. „Was derzeit definitiv nicht dazugehört, ist SARS-CoV-2, weil uns hier ganz einfach das Schutzkorrelat fehlt, d.h., wir wissen nicht, welcher Ak-Titer einen Schutz – und wenn ja, wovor – bedeutet“, warnte Apfalter.
Bei bestimmten Populationen, wie immunsupprimierten Patienten, werden häufiger Titerbestimmungen durchgeführt, um zu sehen, wie weit die Betreffenden überhaupt in der Lage sind, Ak zu bilden. „Bei allen Titerbestimmungen muss man immer daran denken, dass wir dadurch nur eine Information über die Antikörperbildung, nicht aber über die zelluläre Immunität erhalten.“
„In der Infektionsdiagnostik wird die Serologie häufig eingesetzt und leider oft auch missinterpretiert“, so die Expertin. In vielen Fällen werden serologische Methoden heute durch molekularbiologische Tests ersetzt. „Diese werden aber häufig nicht refundiert, was zu durchaus problematischen Situationen führt“, sagte Apfalter. „Unstrittig ist die Serologie am ehesten noch in der Virologie, während sie bei Pilzen, Protozoen und Bakterien durchaus problematisch sein kann.“
„Was nicht passieren sollte, ist, dass ein Patient, der angibt, müde zu sein und einen Leistungsknick zu haben, kreuz und quer auf alle nur erdenklichen Erreger mittels Serologie getestet wird“, betonte die Expertin. „Und zwar schon deshalb, weil die dabei erhobenen Befunde in der Regel nicht vernünftig interpretierbar sind. Hier haben sich – man muss es leider sagen – regelrechte Geschäftsmodelle entwickelt.“ In diesem Zusammenhang sollte man sich an Grundbegriffe wie Sensitivität, Spezifität, positiver und negativer prädiktiver Wert, Prävalenz und Inzidenz und nicht zuletzt Vortestwahrscheinlichkeit erinnern. „Serologische Untersuchungen sollten nur im Kontext präziser Falldefinitionen durchgeführt werden“, wiederholte Apfalter.
ASLO, Chlamydien, Borrelien und Yersinien
ASLO steht für „Anti-Streptolysin O“. Bei Streptolysin O handelt es sich um einen Virulenzfaktor von Gruppe-A-Streptokokken (GAS), ein Zytolysin, das imstande ist, körpereigene Zellen wie Makrophagen, neutrophile Granulozyten oder Thrombozyten zu zerstören. „Wenn man nun ASLO-Titer bestimmt, so muss man wissen, dass etwa 80% aller Menschen hohe Titer haben, weil sie – oft schon in der Kindheit – GAS-Infektionen, wie Anginen, durchgemacht haben. Zudem variieren die Titer je nach Alter, Jahreszeit und geografischer Region“, warnte Apfalter. Außerdem sagt die Titerhöhe nichts über eine mögliche GAS-Aktivität aus. Bei hohem Serumcholesterin gibt es falsch hohe Werte. Umgekehrt haben asymptomatische Träger von GAS niedrige Titer. „Bei Patienten, bei denen man ein rheumatisches Fieber oder eine Glomerulonephritis vermutet, wäre eine ASLO-Titerbestimmung, die mindestens zweimal erfolgen müsste, bestenfalls ein diagnostischer Puzzlestein von vielen“, sagte die Infektiologin. „Hingegen ist eine ASLO-Bestimmung zur Diagnostik einer GAS-Angina gänzlich sinnlos.“
Zur Diagnostik von Chlamydieninfektionen ist die Ak-Diagnostik obsolet. Die Diagnostik beruht heute auf PCR oder ähnlichen Methoden.
„Was Borrelien angeht, so ist dies vermutlich diejenige Infektion in Österreich, die mit den meisten Fehldiagnosen einhergeht“, warnte die Expertin. Grundsätzlich ist die Borreliose (wenn auch zum Teil erst nach Jahren) eine selbstlimitierende Erkrankung. „Dies ist ein gutes Beispiel dafür, dass es zuerst einen einigermaßen starken klinischen Verdacht geben muss“, so Apfalter. Im Stadium des Erythema migrans haben nur 30% der Betroffenen eine IgM-Antwort. Nach vier bis acht Wochen haben hingegen alle Personen, die mit Borrelien in Kontakt gekommen sind, eine positive IgG-Antwort, die zumeist auch lang, manchmal lebenslang, persistiert. „Wenn jemand länger als zwei Monate krank ist und immer nur positive IgM-, aber keine IgG-Antikörper hat, kann man eine Borrelieninfektion ausschließen.“ Wegen der langen Persistenz ist eine Kontrolle mittels Serologie nach Behandlung einer Borreliose nicht zielführend.
Yersinien kommen in 18 verschiedenen Spezies vor. Während der Pesterreger heute keine Bedeutung mehr hat, spielt Y. enterocolitica noch eine gewisse Rolle. „Auch hier gibt es jedoch mit Stuhlkultur und PCR bessere diagnostische Möglichkeiten, als die Serologie sie bietet“, so Apfalter zum Schluss.
Quelle:
„Serologie: ASLO, Borrelien, Chlamydien, Yersinien – cui bono?“; Vortrag von Prim. Univ.-Prof. Dr. Petra Apfalter, Leiterin des Instituts für Hygiene, Mikrobiologie und Tropenmedizin, Ordensklinikum Linz, und des Nationalen Referenzzentrums für antimikrobielle Resistenzen, beim Giftigen Dienstag am 25.1.2022
Literatur:
bei der Vortragenden
Das könnte Sie auch interessieren:
Diskriminierung von Menschen mit HIV in Deutschland und Österreich
Leider müssen Menschen, die mit HIV leben, auch im Jahr 2025 noch mit Schlechterbehandlung und Ablehnung leben – überwiegend in Hinblick auf Leistungen im Gesundheitsbereich. Die ...
Bakteriämie mit Staphylococcus aureus
Jede Bakteriämie mit Staphylococcus aureus ist eine ernsthafte Erkrankung mit hoher Mortalität und erfordert eine genaue Abklärung. Die Therapie orientiert sich primär an der Resistenz ...
Hepatitis-C-Versorgungskaskaden von HIV-infizierten Personen in Österreich
Direkt wirkende antivirale Medikamente (DAA) haben die Behandlung des Hepatitis-C-Virus (HCV) revolutioniert und eine Eliminierung des HCV bei HIV-koinfizierten Menschen in Westeuropa ...